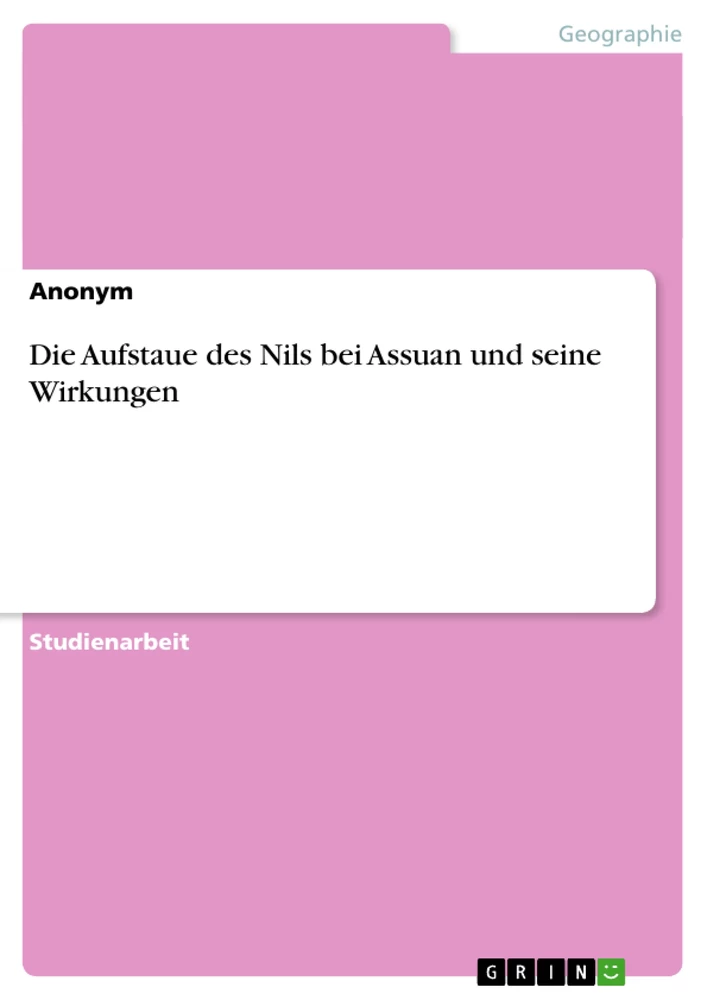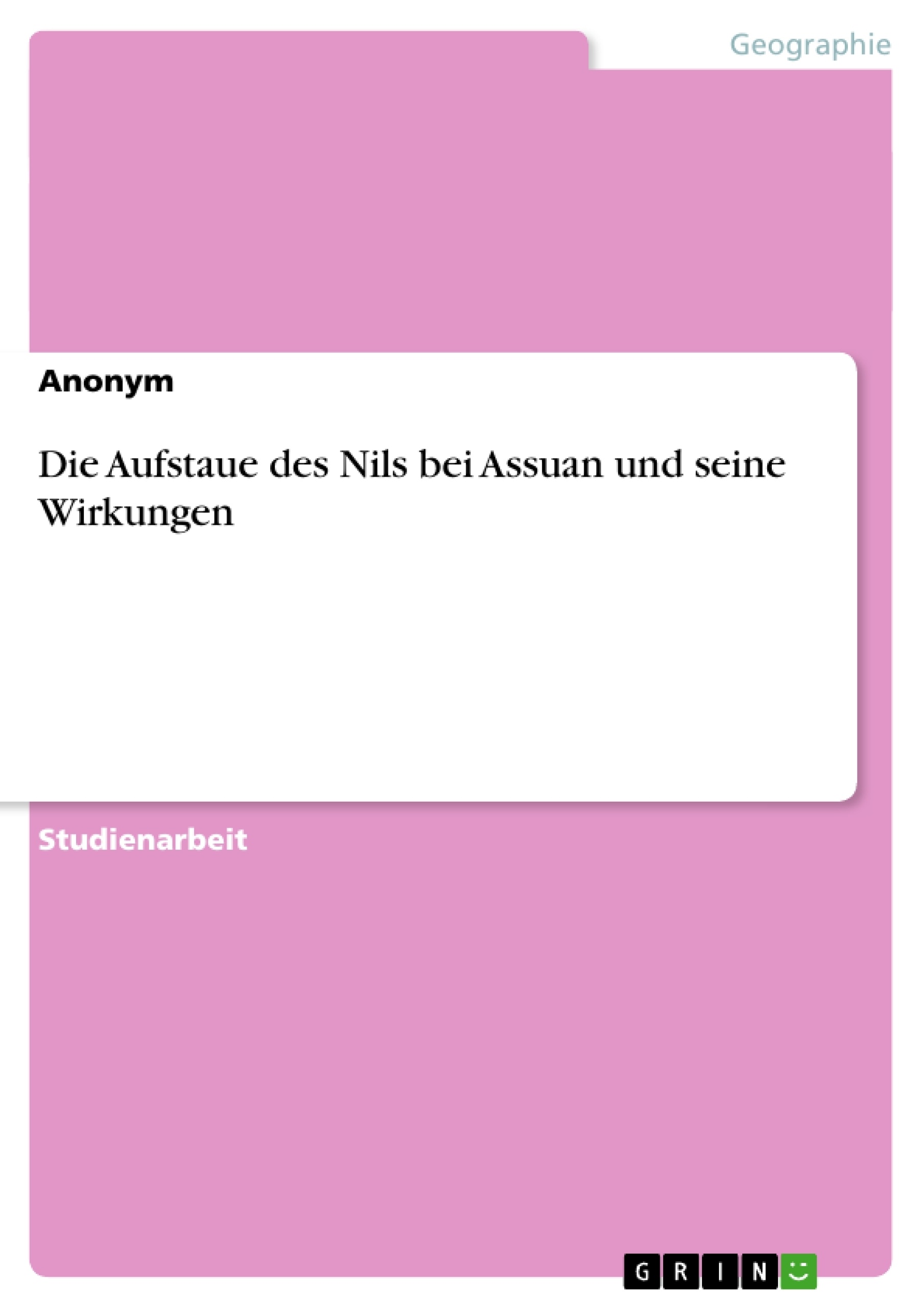Der Nil ist mit einer Länge von 6671 km der längste Fluß der Welt (vgl. RADY 1979:273). Er entspringt aus zwei hydrologischen Hauptsystemen. Der Weiße Nil fließt mit ganzjährig gleichmäßiger Wasserführung vom Victoriasee Richtung Norden und vereint sich bei Khartum im Sudan mit dem Blauen Nil, der im Hochland von Äthiopien entspringt.
Im Nordsudan und in Ägypten ist der Nil ein Fremdlingsfluß. 2700 km fließt er durch vollarides Klima ohne weitere Wasserzufuhr zu erfahren. Dabei sorgt das monsunale Klima im Hochland von Äthiopien für eine hohe Saisonalität der Wasserführung. 63% der jährlichen Wassermenge konzentrieren sich auf die drei Monate August bis Oktober.
Das Klima Ägyptens ist vollarid, so daß Landwirtschaft nur auf der Basis von Bewässerungswirt-schaft möglich ist. Diese hat in Ägypten eine lange Tradition. Von einer traditionellen Form der Beckenbewässerung gingen die Fellachen nach dem Bau des ersten Staudamms von Assuan 1902 vielfach zur Dauerbewässerung über. Schon in den 60er Jahren wurden 83,2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LNF) ganzjährig bewässert (vgl. IBRAHIM 1996:56). Heute stellt sich die Situation wie folgt dar: „No country in the world, however, is more dependent on irrigated agriculture than Egypt, where all cropland (100 per cent) is irrigated“ (HULTIN 1995:32). Dabei stammen 95% des Wassers, das in Ägypten verbraucht wird aus dem Nil (vgl. WOLFF 1986:3).
99% der Bevölkerung Ägyptens leben im Niltal (vgl. KfW 1984:2). Oder wie HULTIN es ausgedrückt: „With 98% of the country being desert, the growing population is concentrated in 2% of the land.“ (ebd. 1995:31). Das hier angesprochene Bevölkerungswachstum stellt ein besonders Problem in Ägypten dar. Von 1960 bis 1985 verdoppelte sich die Bevölkerung Ägyptens von 26 Mio. auf über 50 Mio. Einwohner. 1999 betrug die Bevölkerung Ägyptens 67,3 Mio. bei einer Wachstumsrate von 1,82% (vgl. www.odci.gov/cia/publications/factbook/eg.htm).
Vor diesem Hintergrund war der Bau des Assuan-Hochdammes eine Maßnahme, die die Tragfähigkeit des Niltals erhöhen und die Nahrung für die Bevölkerung durch Erhöhung der Erträge und die Möglichkeit einer zweiten Ernte im Jahr sichern sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Ausgangssituation
- Der Nil
- Landwirtschaft und Bevölkerung in Ägypten
- Die Aufstauung bei Assuan
- Der Staudamm von 1902
- Sadd El Ali – der Hochdamm von Assuan (AHD)
- Ziele des Hochdammbaus
- Technische Daten
- Folgen des Hochdammbaus (AHD)
- Vorbemerkung
- Ökonomische Auswirkungen
- Folgen für die Landwirtschaft
- Folgen für die Industrie
- Ökologische Auswirkungen
- Pedologische Effekte
- Hydrologische Effekte
- Geomorphologische Effekte
- Soziokulturelle und medizinische Auswirkungen
- Versuch einer abschließenden Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Assuan-Hochdamms auf Ägypten. Ziel ist es, die ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Folgen des Projekts umfassend darzustellen und zu analysieren, sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte zu beleuchten und die Kontroversen um dieses Großprojekt zu diskutieren.
- Ökonomische Auswirkungen des Assuan-Hochdamms auf Landwirtschaft und Industrie
- Ökologische Folgen des Dammbaus, insbesondere die Auswirkungen auf die Nilsedimente und das Ökosystem
- Soziokulturelle Veränderungen durch den Dammbau, inklusive der Umsiedlung der Nubier
- Kontroversen und unterschiedliche Perspektiven auf den Assuan-Hochdamm
- Langzeitfolgen und Nachhaltigkeit des Projekts
Zusammenfassung der Kapitel
Ausgangssituation: Dieses Kapitel beschreibt den Nil als längsten Fluss der Welt und seine hydrologische Beschaffenheit. Es hebt die Bedeutung des Nils für die Landwirtschaft und die Bevölkerung Ägyptens hervor, insbesondere im Kontext des ariden Klimas und des starken Bevölkerungswachstums. Die Abhängigkeit Ägyptens von der Bewässerungswirtschaft und die Geschichte der Bewässerungstechniken werden erläutert, um den Hintergrund für den Bau des Assuan-Hochdamms zu verdeutlichen. Die starke Konzentration der Bevölkerung im Niltal und das rasche Bevölkerungswachstum werden als zentrale Herausforderungen dargestellt, die den Bau des Damms als scheinbar notwendige Maßnahme erscheinen ließen.
Die Aufstauung bei Assuan: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Staudämme bei Assuan, beginnend mit dem ersten Damm von 1902. Es beschreibt dessen Funktion, seine technischen Daten und seine positiven Auswirkungen auf die Landwirtschaft, wie die Möglichkeit der Dauerbewässerung und zusätzliche Ernten. Im Anschluss wird der Bau des Sadd El Ali (Assuan-Hochdamm) detailliert dargestellt, einschließlich seiner Ziele – von der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion über die Energiegewinnung bis hin zur Hochwasserkontrolle – sowie seiner technischen Daten. Die politische Dimension des Projekts unter Präsident Nasser und die Rolle der Sowjetunion bei der Finanzierung werden ebenfalls thematisiert.
Folgen des Hochdammbaus (AHD): Dieses Kapitel analysiert die vielschichtigen Folgen des Assuan-Hochdamms. Es beginnt mit der Feststellung, dass der Dammbau zwangsläufig zu ökologischen Veränderungen führt. Die ökonomischen Auswirkungen auf die Landwirtschaft sind umstritten, mit Diskussionen über die tatsächliche Ausweitung der Anbaufläche und die Auswirkungen der Umstellung von Becken- auf Dauerbewässerung. Die positive Entwicklung der Energiegewinnung wird ebenso dargestellt wie die negativen Folgen der Pedologischen Effekte (der Verlust von Nilschlamm als Dünger und die zunehmende Bodendegradation), hydrologischen Effekte (verstärkte Verdunstung, steigender Grundwasserspiegel und Versalzung), geomorphologischen Effekte (Erosion, Salzwasserintrusion) und soziokulturellen und medizinischen Folgen (Umsiedlung der Nubier, Bilharziose). Die verschiedenen und oft widersprüchlichen Perspektiven der Wissenschaftler werden hier hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Assuan-Hochdamm, Sadd El Ali, Nil, Ägypten, Bewässerungswirtschaft, Landwirtschaft, Industrie, Energiegewinnung, ökologische Auswirkungen, soziokulturelle Auswirkungen, Nilschlamm, Bodendegradation, Versalzung, Bevölkerungswachstum, Nubier, Hochwasserkontrolle, Dürre, Kontroversen, Technikfolgenabschätzung.
Häufig gestellte Fragen zum Assuan-Hochdamm
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert umfassend die Auswirkungen des Assuan-Hochdamms auf Ägypten. Sie untersucht die ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Folgen des Projekts, beleuchtet sowohl positive als auch negative Aspekte und diskutiert die Kontroversen um dieses Großprojekt. Der Inhalt umfasst eine detaillierte Darstellung der Ausgangssituation, die Geschichte des Dammbaus (inklusive des Vorgänger-Damms von 1902), eine Analyse der Folgen für Landwirtschaft, Industrie, Ökologie und Gesellschaft sowie einen Versuch einer abschließenden Beurteilung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die ökonomischen Auswirkungen des Damms auf Landwirtschaft und Industrie, die ökologischen Folgen (insbesondere Auswirkungen auf Nilsedimente und das Ökosystem), soziokulturelle Veränderungen (einschließlich der Umsiedlung der Nubier), Kontroversen und unterschiedliche Perspektiven zum Hochdamm sowie die Langzeitfolgen und Nachhaltigkeit des Projekts. Spezifische ökologische Auswirkungen wie Pedologische, Hydrologische und Geomorphologische Effekte werden eingehend untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Ausgangssituation (mit Fokus auf den Nil, Landwirtschaft und Bevölkerung Ägyptens); Die Aufstauung bei Assuan (mit Beschreibung des Damms von 1902 und des Assuan-Hochdamms, inklusive Ziele und technische Daten); Folgen des Hochdammbaus (mit Analyse der ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Auswirkungen); und abschließend ein Versuch einer Beurteilung des Projekts.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die umfassende Darstellung und Analyse der ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Folgen des Assuan-Hochdamms. Die Arbeit soll sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte beleuchten und die Kontroversen um dieses Großprojekt diskutieren. Es geht darum, ein umfassendes Bild der Auswirkungen des Dammbaus zu liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Assuan-Hochdamm, Sadd El Ali, Nil, Ägypten, Bewässerungswirtschaft, Landwirtschaft, Industrie, Energiegewinnung, ökologische Auswirkungen, soziokulturelle Auswirkungen, Nilschlamm, Bodendegradation, Versalzung, Bevölkerungswachstum, Nubier, Hochwasserkontrolle, Dürre, Kontroversen, Technikfolgenabschätzung.
Wie wird die Ausgangssituation beschrieben?
Die Ausgangssituation beschreibt den Nil als Lebensader Ägyptens, seine Bedeutung für die Landwirtschaft und die starke Abhängigkeit der Bevölkerung von ihm. Das ariden Klima und das starke Bevölkerungswachstum werden als zentrale Herausforderungen dargestellt, die den Dammbau als scheinbar notwendige Maßnahme erscheinen ließen. Die Geschichte der Bewässerungstechniken wird ebenfalls erläutert.
Wie wird der Bau des Assuan-Hochdamms dargestellt?
Der Bau des Hochdamms wird im Kontext der Geschichte der Staudämme bei Assuan dargestellt, beginnend mit dem Damm von 1902. Die Ziele des Hochdammbaus (Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, Energiegewinnung, Hochwasserkontrolle) und seine technischen Daten werden detailliert beschrieben. Die politische Dimension des Projekts unter Präsident Nasser und die Rolle der Sowjetunion werden ebenfalls thematisiert.
Welche Folgen des Hochdammbaus werden analysiert?
Die Folgen des Hochdammbaus werden in ökonomische, ökologische und soziokulturelle Auswirkungen unterteilt. Ökonomisch werden die Auswirkungen auf Landwirtschaft und Industrie diskutiert, ökologisch werden Pedologische, Hydrologische und Geomorphologische Effekte analysiert (z.B. Verlust von Nilschlamm, Bodendegradation, Versalzung). Soziokulturelle Auswirkungen betreffen beispielsweise die Umsiedlung der Nubier und medizinische Folgen wie die Ausbreitung von Bilharziose. Die Arbeit hebt die oft widersprüchlichen wissenschaftlichen Perspektiven hervor.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2000, Die Aufstaue des Nils bei Assuan und seine Wirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14309