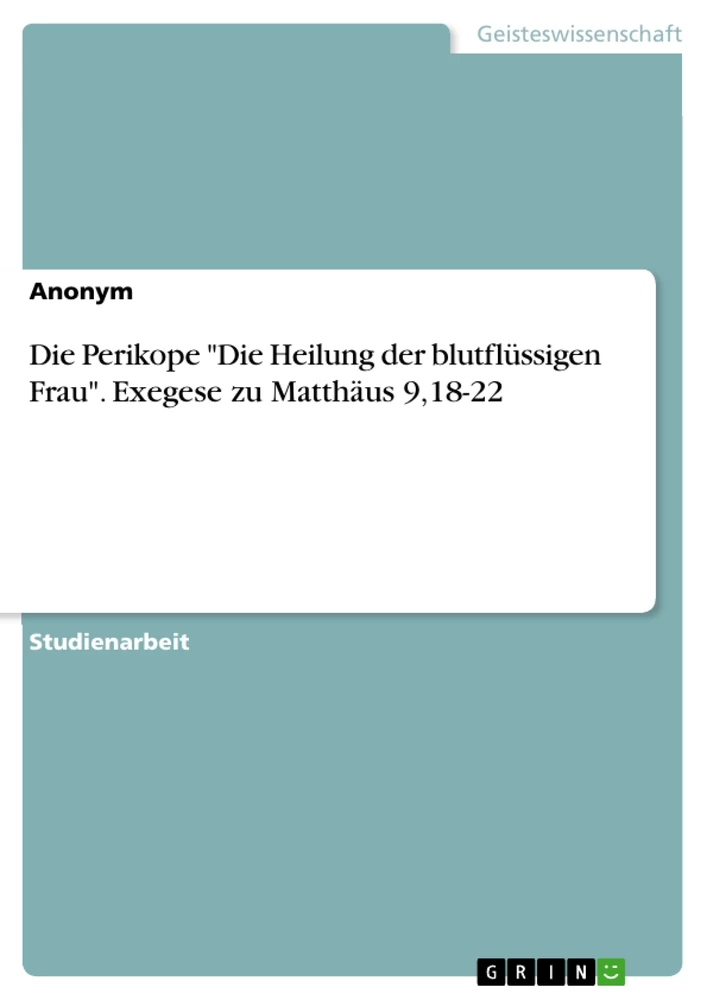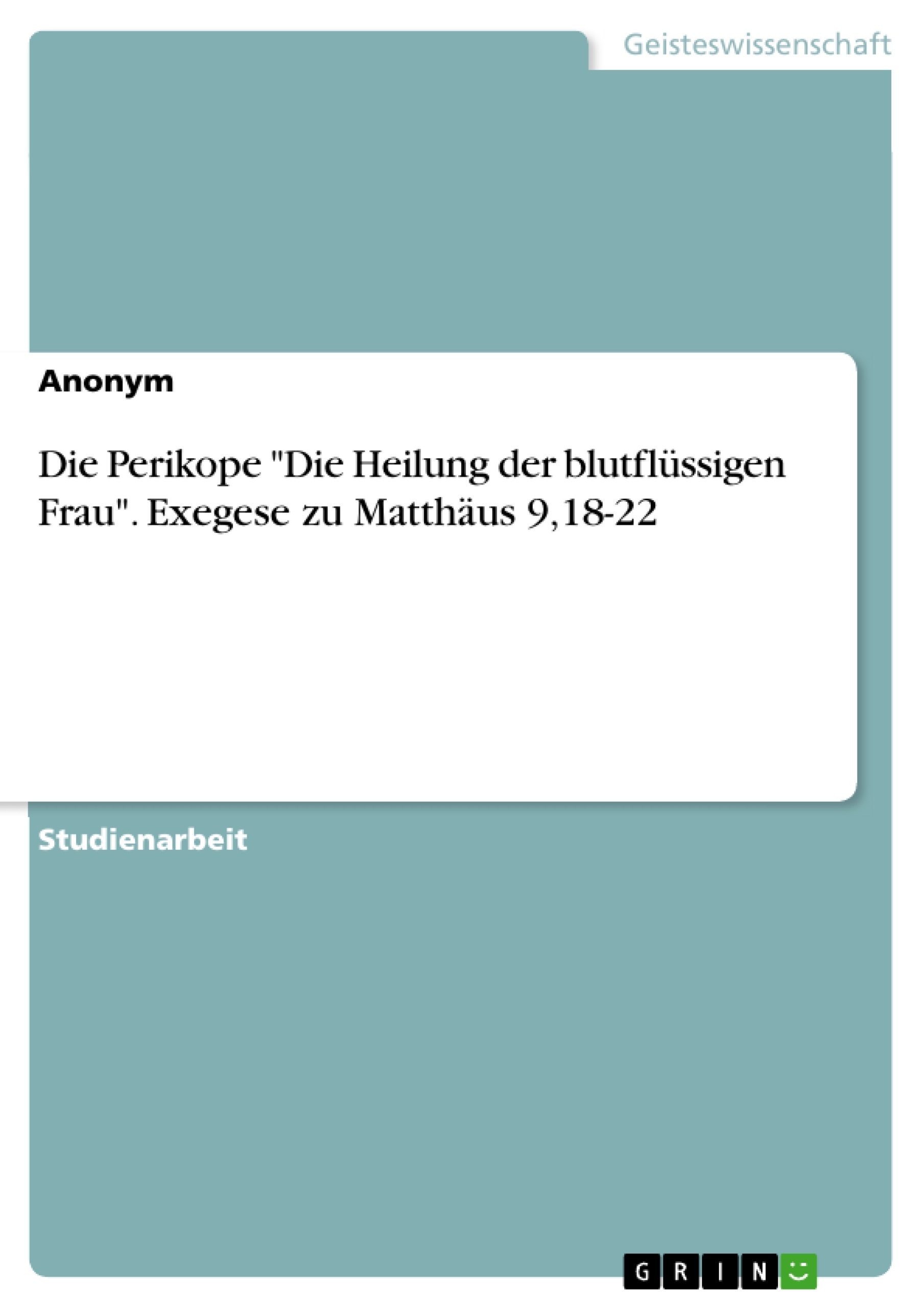Die vorliegende Arbeit behandelt die Perikope "Die Heilung der blutflüssigen Frau" aus Matthäus 9,18-22. Die Ausarbeitung erfolgt auf Grundlage des Münchener Neuen Testaments.
Die gewählte Perikope handelt von einer Frau, die an Blutfluss leidet und durch Jesus geheilt wird. Ich habe diese Perikope gewählt, da das große Vertrauen zu Jesus und die Heilungen Jesu mir sehr imponieren. Der Aspekt des Vertrauens ist auch heute noch aktuell und betrifft jeden Einzelnen in verschiedenen Bereichen des Lebens. Dabei spielt Vertrauen sowohl im alltäglichen Leben als auch bei Familien und Freunden eine entscheidende Rolle. Eindeutig zeigt sich die entscheidende Rolle von Vertrauen in der aktuellen Debatte um die Corona-Impfung und die Coronaregeln. Dabei stellt sich die Frage nach Vertrauen in die Politik, die Wissenschaft und Informationsquellen.
Beim erstmaligen Lesen der Perikope wirkt es zunächst als habe Jesus die Frau aufgrund ihres Glaubens von ihrer Krankheit geheilt. Unklar ist jedoch, warum die Frau sich so sicher ist, dass die Berührung der Kleidung Jesu zur Heilung ihrer Krankheit führen könne. Jesus sagt der Frau, dass sie Mut haben soll und ihr Glaube sie gerettet hat. Daraus folgend stellt sich die Frage, ob ihr Glaube ausreichend war, aber sie zunächst zu wenig Mut hatte. Deshalb untersucht diese Arbeit die Perikope unter der Leitfrage: Warum mangelt es der Frau, trotz ihres immensen Glaubens, an Mut?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Verordnung des Evangeliums
- 3. Übersetzungsvergleich
- 4. Kontextanalyse
- 4.1 Gliederung des Gesamtevangeliums
- 4.2 Kontextanalyse
- 5. Textanalyse
- 6. Form- und Gattungskritik
- 7. Einzelexegese
- 8. Synoptischer Vergleich
- 9. Redaktionskritik
- 10. Hermeneutische Besinnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perikope „Die Heilung der blutflüssigen Frau“ aus Matthäus 9,18-22. Die zentrale Fragestellung befasst sich mit dem scheinbaren Mangel an Mut der Frau trotz ihres starken Glaubens. Die Arbeit analysiert den Text im Kontext des Matthäusevangeliums, betrachtet verschiedene Übersetzungen und untersucht die historische Einordnung des Evangeliums. Die Ergebnisse sollen ein tieferes Verständnis der Perikope und ihrer theologischen Implikationen ermöglichen.
- Der Glaube der Frau und ihr Handeln
- Die historische und literarische Einordnung des Matthäusevangeliums
- Der Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen
- Die Rolle des Vertrauens im Kontext der Perikope und der heutigen Zeit
- Die theologische Bedeutung der Heilung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Perikope Mt 9,18-22 ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Mangel an Mut der Frau trotz ihres starken Glaubens. Die Auswahl dieser Perikope wird begründet durch die Relevanz des Themas Vertrauen in verschiedenen Lebensbereichen, mit Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Debatten (z.B. Corona-Impfung). Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Analyse.
2. Historische Verordnung des Evangeliums: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des Matthäusevangeliums. Es beleuchtet Fragen nach Verfasser, Adressaten, Entstehungszeit und -ort sowie der Intention des Evangeliums. Unter Bezugnahme auf verschiedene theologische Autoren (Luz, Schnackenburg, Luck) werden verschiedene Theorien zu den genannten Punkten diskutiert und abgewägt. Das Kapitel analysiert die Position des Evangeliums im Kontext des frühen Christentums und seiner Abgrenzung zum Judentum, wobei die Intention des Autors als Stärkung des christlichen Glaubens und Handelns hervorgehoben wird.
3. Übersetzungsvergleich: Dieses Kapitel vergleicht verschiedene Übersetzungen (Münchner Neues Testament, Zürcher Bibel, Das Evangelium nach Matthäus, Bibel in gerechter Sprache) von Mt 9,18-22. Es untersucht die jeweiligen Übersetzungsziele und deren Auswirkungen auf die Intention des Textes. Der Vergleich dient dazu, unterschiedliche Interpretationsansätze aufzuzeigen und den Einfluss der Übersetzung auf das Verständnis der Perikope zu beleuchten. Die Analyse zielt darauf ab, die Übersetzung zu identifizieren, die am ehesten die ursprüngliche Bedeutung des Textes wiedergibt.
Schlüsselwörter
Matthäus 9,18-22, Blutfluss, Heilung, Glaube, Mut, Vertrauen, Matthäusevangelium, Exegese, Kontextanalyse, Übersetzungsvergleich, Hermeneutik, Judentum, Christentum.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Perikope Matthäus 9,18-22
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Perikope „Die Heilung der blutflüssigen Frau“ (Matthäus 9,18-22). Der Fokus liegt auf dem scheinbaren Mangel an Mut der Frau trotz ihres starken Glaubens und untersucht dies im Kontext des Matthäusevangeliums.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen dem starken Glauben der Frau und ihrem vermeintlichen Mangel an Mut. Die Arbeit untersucht den Text kontextuell (innerhalb des Matthäusevangeliums und historisch), vergleicht verschiedene Übersetzungen und analysiert die theologischen Implikationen der Perikope.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Historische Verordnung des Evangeliums, Übersetzungsvergleich, Kontextanalyse (Gliederung des Gesamtevangeliums und Kontextanalyse der Perikope), Textanalyse, Form- und Gattungskritik, Einzelexegese, Synoptischer Vergleich, Redaktionskritik und Hermeneutische Besinnung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Glauben der Frau und ihr Handeln, die historische und literarische Einordnung des Matthäusevangeliums, den Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen, die Rolle des Vertrauens im Kontext der Perikope und in der heutigen Zeit sowie die theologische Bedeutung der Heilung.
Wie wird die historische Einordnung des Matthäusevangeliums behandelt?
Kapitel 2 untersucht die Entstehung des Matthäusevangeliums, beleuchtet Fragen nach Verfasser, Adressaten, Entstehungszeit und -ort sowie der Intention. Es bezieht sich auf theologische Autoren wie Luz, Schnackenburg und Luck und diskutiert verschiedene Theorien zur Position des Evangeliums im frühen Christentum und seiner Abgrenzung zum Judentum.
Wie wird der Übersetzungsvergleich durchgeführt?
Kapitel 3 vergleicht verschiedene Übersetzungen (Münchner Neues Testament, Zürcher Bibel, Das Evangelium nach Matthäus, Bibel in gerechter Sprache) von Matthäus 9,18-22. Es untersucht die Übersetzungsziele und deren Auswirkungen auf die Intention des Textes, um unterschiedliche Interpretationsansätze aufzuzeigen und den Einfluss der Übersetzung auf das Verständnis der Perikope zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Matthäus 9,18-22, Blutfluss, Heilung, Glaube, Mut, Vertrauen, Matthäusevangelium, Exegese, Kontextanalyse, Übersetzungsvergleich, Hermeneutik, Judentum, Christentum.
Welche konkreten Beispiele werden in der Einleitung genannt?
Die Einleitung begründet die Auswahl der Perikope mit der Relevanz des Themas Vertrauen in verschiedenen Lebensbereichen und bezieht aktuelle gesellschaftliche Debatten (z.B. Corona-Impfung) mit ein.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit biblischer Exegese, insbesondere dem Matthäusevangelium, auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die Perikope "Die Heilung der blutflüssigen Frau". Exegese zu Matthäus 9,18-22, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1430933