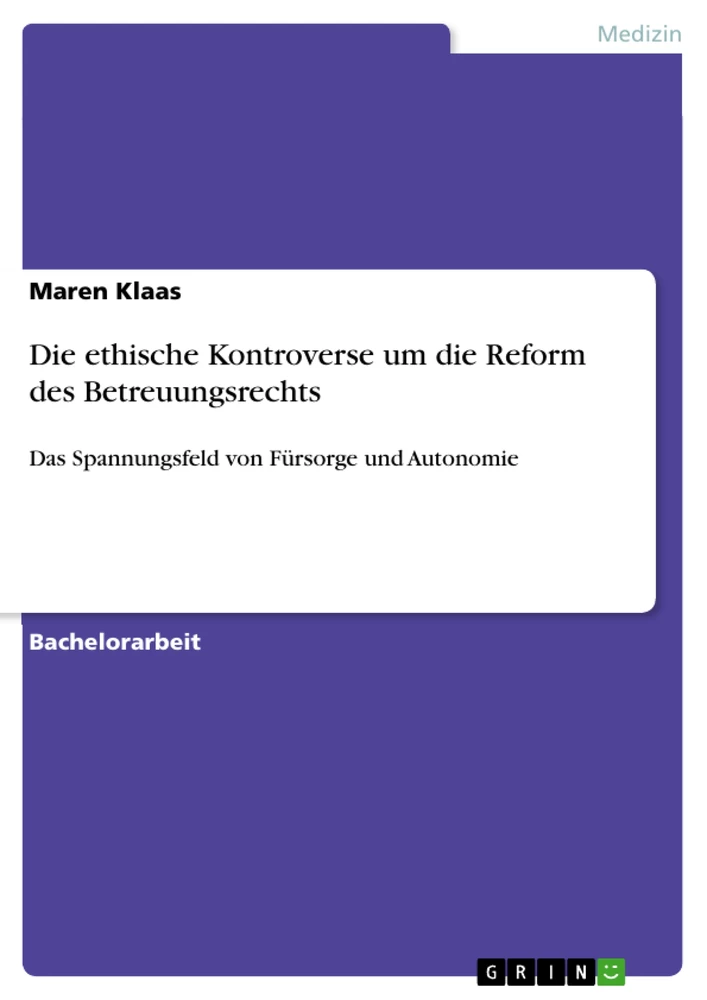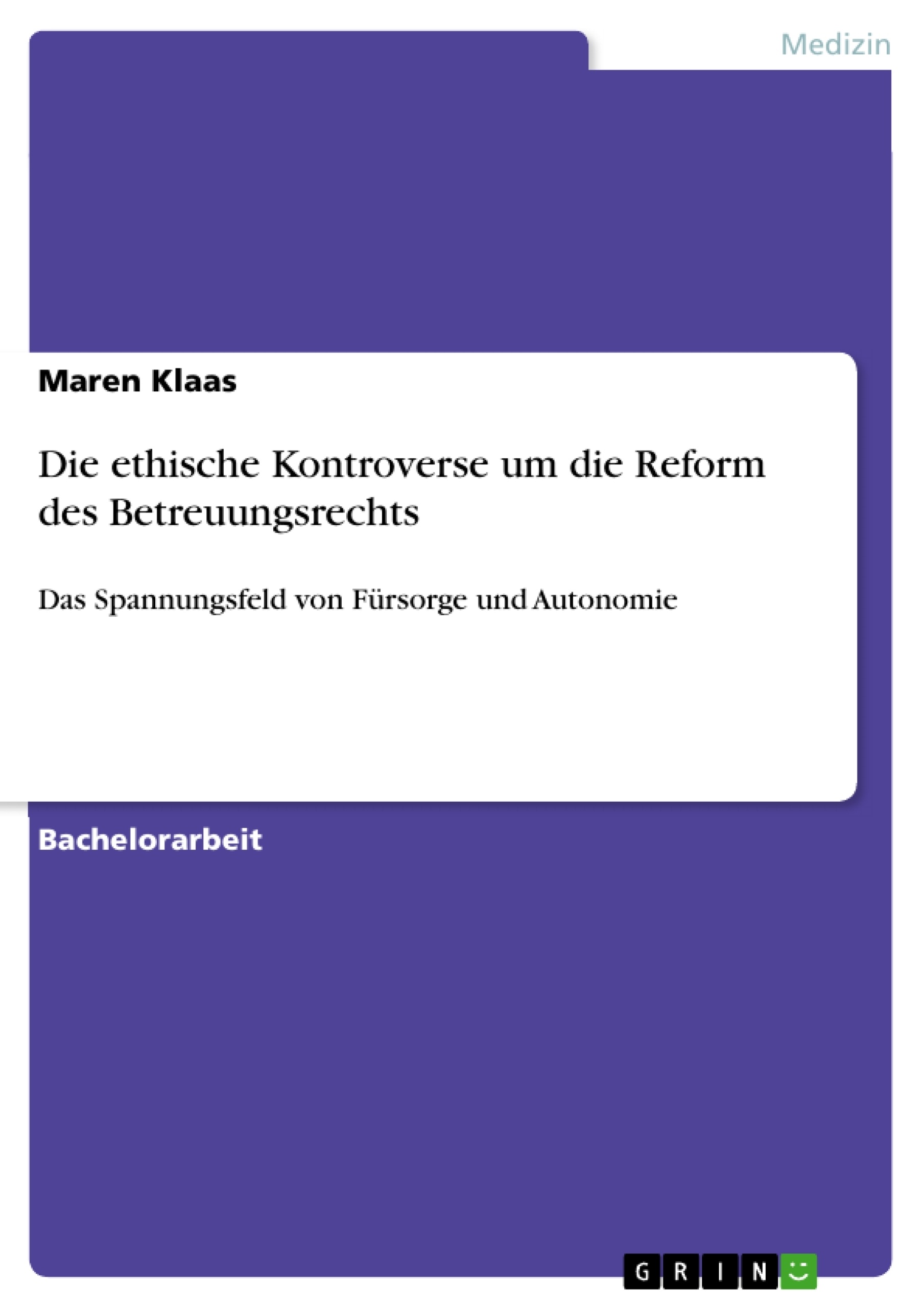Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der ethischen Kontroverse um die Betreuungsrechtsreform im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge.
In der EU, sowie auch vielen weiteren Ländern der Welt ist Autonomie ein selbstverständliches Menschenrecht und Fürsorge gilt im sozialen Umgang als menschlich und barmherzig. Doch was wird priorisiert, wenn der Mensch nicht mehr eigenverantwortlich entscheiden kann? Wenn der Mensch als autonomes Individuum nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln, greift das Prinzip der Fürsorge. Schließen sich diese beiden Prinzipien aus oder gehen sie Hand in Hand in dieselbe Richtung? Oftmals entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem Prinzip der Autonomie und dem Prinzip der Fürsorge und dieses wird auf Kosten derer entladen, die auf die Fürsorge der Gesellschaft angewiesen sind und gleichzeitig das Recht darauf haben, dass ihre Autonomie respektiert wird.
Zu Beginn des Jahres 2023 tritt eine Reform mit bis zu diesem Zeitpunkt unvergleichbaren Ausmaß im deutschen Betreuungsrecht (BtG) in Kraft. Die Qualität des Betreuungsrechts, welches als Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige eingeführt wurde, wird seit seinem Inkrafttreten zum 01.01.1992 stetig in Frage gestellt und ist bereits an vielen Stellen weiterentwickelt worden. Mittelpunkt der aktuellen Reformansätze des aktuellen Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG) bildet die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts im Gleichgewicht zu der Gewährleistung der Fürsorge für Personen mit Betreuungsbedarf und die Qualitätssteigerung des BtGs. Die Korrelation der Aspekte der Fürsorge und der Selbstbestimmung führt nicht selten zu der Herausforderung, beide Prinzipien sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Durchführung des Betreuungsrechts adäquat zu berücksichtigen. Schwerpunkt der in der Reform überarbeiteten Punkte soll sein, „größtmögliche Selbstbestimmung für betreute Menschen anstelle von Entmündigung und Bevormundung“ zu gewährleisten. Doch inwieweit schränkt das die Fürsorge als eines der ethischen Prinzipien der Betreuung ein?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ethische Auseinandersetzung mit den Prinzipien der Autonomie und der Fürsorge
- 2.1 Fürsorge als ethischer Handlungsrahmen
- 2.2 Autonomie als ethische Orientierungshilfe
- 2.3 Die biomedizinische Prinzipienethik
- 2.3.1 Das Prinzip des Wohltuns
- 2.3.2 Das Prinzip der Autonomie
- 2.4 Das Spannungsfeld von Fürsorge und Autonomie
- 3 Berufsethische Ansprüche und Prinzipien im gesetzlichen Betreuungsrecht
- 3.1 Berufsethische Ansprüche in der Berufsbetreuung
- 3.2 Prinzipien der rechtlichen Betreuung
- 4 Personen mit Betreuungsbedarf
- 4.1 Einwilligungsfähige Patient*innen
- 4.2 Nicht einwilligungsfähige Patient*innen
- 5 Die gesetzliche Betreuung bis zur Reform im Januar 2023 in der Kritik
- 5.1 Verweisketten zum Vormundschaftsrecht
- 5.2 Die Umsetzung der UN-BRK im Betreuungsrecht
- 5.3 Die Doppelkompetenz bei der Geschäftsfähigkeit
- 5.4 Der Sprachgebrauch im Betreuungsrecht
- 5.5 Ärztliche Zwangsmaßnahmen und Freiheitsentziehende Maßnahmen
- 5.6 Das Verhältnis zwischen Betreuer*in und betreuter Person
- 6 Die signifikanten Reformpunkte der Betreuungsrechtsreform
- 6.1 Die unterstützte Entscheidungsfindung und das Wunschbefolgungsprinzip
- 6.2 Die erweiterte Unterstützung
- 6.3 Die Stärkung des Erforderlichkeitgrundsatzes
- 6.4 Der Schutz des Wohnraums
- 6.5 Das Ehegattenvertretungsrecht
- 6.6 Die Überarbeitung der Wortwahl
- 6.7 Die Trennung des Betreuungsrechts vom Vormundschaftsrecht
- 6.8 Qualitätsanforderungen an die berufliche Betreuung
- 7 Die ethische Kohärenz von Kritikpunkten und Reforminhalten
- 7.1 Der ethische Einfluss der Betreuungsrechtsreform auf betroffene Personengruppen und das Spannungsfeld von Fürsorge und Autonomie
- 7.2 Weiterhin überarbeitungswürdige Kritikpunkte
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die ethische Kontroverse um das Spannungsfeld von Fürsorge und Autonomie im Betreuungsrecht (BtG) und besonders im aktuellsten BtÄndG. Die Arbeit untersucht, inwiefern die Reform des BtG geeignet ist, die Autonomie der Betreuten zu fördern und gleichzeitig dem Prinzip der Fürsorge gerecht zu werden. Die Analyse konzentriert sich auf die ethische Perspektive und berücksichtigt die Herausforderungen der Reform in Bezug auf die Balance von Autonomie und Fürsorge.
- Das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge im Betreuungsrecht
- Die ethischen Prinzipien der Autonomie und Fürsorge im Kontext der Betreuung
- Die Auswirkungen der Betreuungsrechtsreform auf die Selbstbestimmung von Betreuten
- Die ethischen Herausforderungen der Umsetzung des Wunschbefolgungsprinzips
- Die Bedeutung der Qualitätssteigerung in der beruflichen Betreuung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der ethischen Kontroverse um die Reform des Betreuungsrechts im Spannungsfeld von Fürsorge und Autonomie ein. Es stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Reformansätze.
- Kapitel 2: Ethische Auseinandersetzung mit den Prinzipien der Autonomie und der Fürsorge Dieses Kapitel analysiert die ethischen Prinzipien der Autonomie und Fürsorge im Kontext der Betreuung. Es betrachtet die biomedizinische Prinzipienethik und beleuchtet die Spannungen, die zwischen den beiden Prinzipien entstehen können.
- Kapitel 3: Berufsethische Ansprüche und Prinzipien im gesetzlichen Betreuungsrecht Dieses Kapitel untersucht die berufsethischen Ansprüche und Prinzipien, die im gesetzlichen Betreuungsrecht verankert sind. Es beleuchtet die Bedeutung der Berufsbetreuung und die ethischen Herausforderungen, denen Betreuer*innen im Alltag begegnen.
- Kapitel 4: Personen mit Betreuungsbedarf Dieses Kapitel betrachtet die verschiedenen Personengruppen, die einen Betreuungsbedarf haben, und differenziert zwischen einwilligungsfähigen und nicht einwilligungsfähigen Patient*innen. Es beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Personengruppen.
- Kapitel 5: Die gesetzliche Betreuung bis zur Reform im Januar 2023 in der Kritik Dieses Kapitel beleuchtet die Kritikpunkte am bisherigen Betreuungsrecht vor der Reform im Januar 2023. Es analysiert die Verweisketten zum Vormundschaftsrecht, die Umsetzung der UN-BRK im Betreuungsrecht und die Herausforderungen in Bezug auf die Geschäftsfähigkeit, den Sprachgebrauch, Zwangsmaßnahmen und das Verhältnis zwischen Betreuer*in und betreuter Person.
- Kapitel 6: Die signifikanten Reformpunkte der Betreuungsrechtsreform Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Reformpunkte des aktuellen Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG). Es betrachtet die Einführung der unterstützten Entscheidungsfindung und des Wunschbefolgungsprinzips, die Stärkung des Erforderlichkeitgrundsatzes, den Schutz des Wohnraums, die Überarbeitung des Sprachgebrauchs und die Trennung des Betreuungsrechts vom Vormundschaftsrecht.
- Kapitel 7: Die ethische Kohärenz von Kritikpunkten und Reforminhalten Dieses Kapitel untersucht die ethischen Implikationen der Reform und beleuchtet, inwieweit die Reform den Kritikpunkten am bisherigen Betreuungsrecht gerecht wird. Es analysiert den Einfluss der Reform auf die Selbstbestimmung von Betreuten und das Spannungsfeld von Fürsorge und Autonomie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen die ethische Kontroverse, die Reform des Betreuungsrechts, die Prinzipien der Autonomie und Fürsorge, die Selbstbestimmung von Betreuten, das Wunschbefolgungsprinzip, die Qualitätssteigerung der Betreuung, die Herausforderungen der Umsetzung der UN-BRK und die ethischen Implikationen der Reform.
- Quote paper
- Maren Klaas (Author), 2023, Die ethische Kontroverse um die Reform des Betreuungsrechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1430731