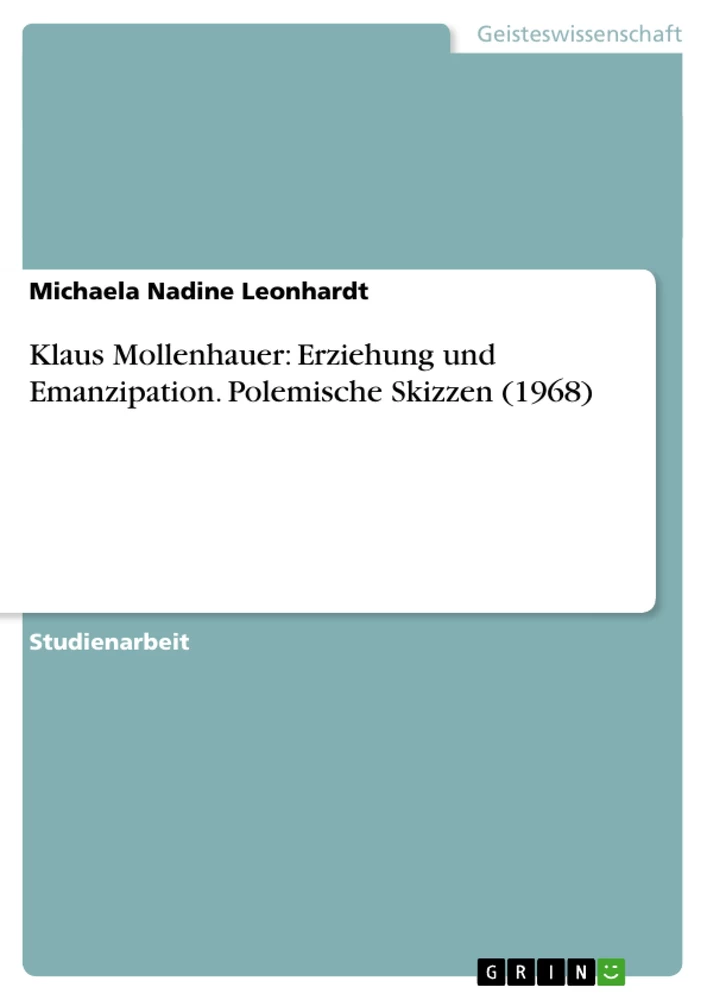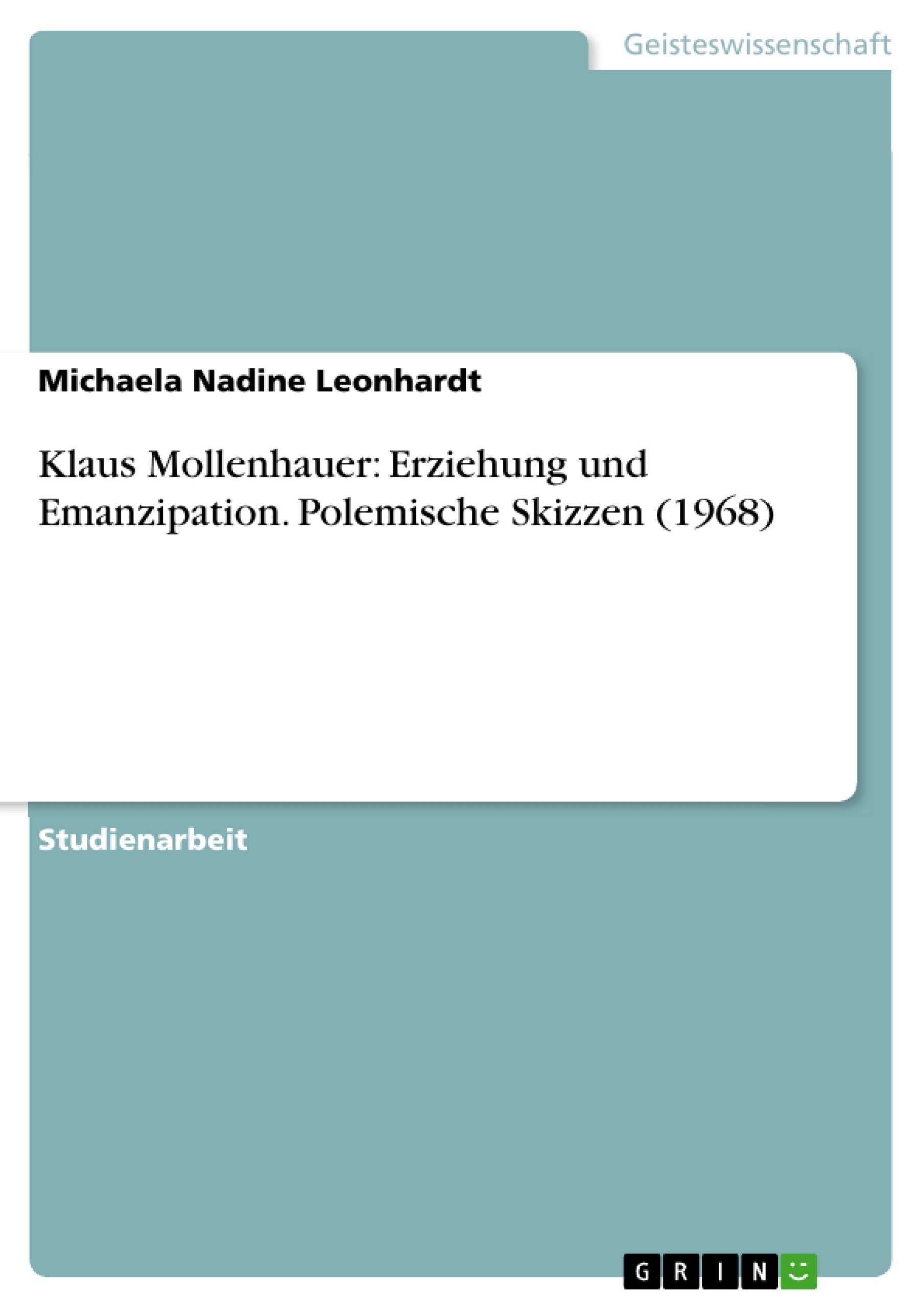Als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Sozialpädagogik im Deutschland der sechziger und frühen siebziger Jahre rief Klaus Mollenhauer (1928-1998) mit seinen Ansichten eine rege öffentliche Diskussion und kontroverse Reaktionen hervor. Gegenstand dieser Arbeit sollen die Grundtendenzen seiner Forschungstheorie sein, wobei das Hauptmerk auf sein im Jahr 1968 veröffentlichtes Werk Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen, in welchem er die Bedeutung und Wirkungsmöglichkeiten der geisteswissenschaftlichen Pädagogik hinterfragt, gerichtet ist.
Um Mollenhauers Forschungstheorie besser nachvollziehen zu können, wird in einem ersten Schritt zunächst ganz generell darzustellen sein, welche Tendenzen der Entwicklung der autonomen Pädagogik in Deutschland zugrunde lagen. Der folgende Abschnitt soll das zweite Kapitel aus Mollenhauers zuvor genanntem Werk behandeln, in welchem der Autor den Aspekt der „Funktionalität und Disfunktionalität von Erziehung“ erörtert. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Mollenhauers Hauptthesen aus diesem Kapitel so darzustellen, dass seine Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Sozialpädagogik nachvollziehbar erörtert und in Bezug zu anderen Autoren gesetzt wird. Dabei soll, wo dies angemessen erscheint, auf einige wenige persönliche und wissenschaftliche Lebensdaten Mollenhauers eingegangen werden. Denn die wissenschaftliche Prägung und die radikalen gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen, die der Autor in seinem Leben erfuhr, können bei einer Beschäftigung mit seinem Werk nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. In einem letzten Punkt soll abschließend die Bedeutung von Mollenhauers Thesen für die damalige aber auch die aktuelle wissenschaftliche Diskussion angeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklungsgeschichte der autonomen Pädagogik in Deutschland
- Klaus Mollenhauer: Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen (1968)
- Funktionalität und Disfunktionalität der Erziehung
- Werte und Konflikte
- Disfunktionale Momente der Erziehungswirklichkeit
- Die Bedeutung der Thesen Klaus Mollenhauers für die Kritische Erziehungswissenschaft
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grundtendenzen der Forschungstheorie von Klaus Mollenhauer, insbesondere sein Werk „Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen (1968)“, in welchem er die geisteswissenschaftliche Pädagogik kritisch hinterfragt. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der autonomen Pädagogik in Deutschland und setzt Mollenhauers Thesen in den Kontext der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen seiner Zeit. Das Ziel ist es, Mollenhauers Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Sozialpädagogik nachvollziehbar darzustellen und in Bezug zu anderen Autoren zu setzen.
- Entwicklung der autonomen Pädagogik in Deutschland
- Funktionalität und Disfunktionalität von Erziehung nach Mollenhauer
- Kritische Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Sozialpädagogik
- Bedeutung von Mollenhauers Thesen für die erziehungswissenschaftliche Diskussion
- Der Einfluss gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen auf Mollenhauers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Klaus Mollenhauer als bedeutende Persönlichkeit der Sozialpädagogik der 60er und 70er Jahre vor. Sie benennt das Hauptwerk „Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen (1968)“ als Gegenstand der Analyse und erläutert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Entwicklung der autonomen Pädagogik in Deutschland einbezieht und Mollenhauers Thesen im Kontext seiner Biographie und der gesellschaftlichen Umstände verortet.
Die Entwicklungsgeschichte der autonomen Pädagogik in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der autonomen Pädagogik in Deutschland, beginnend im 18. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre. Es beleuchtet den Kampf um die Unabhängigkeit der Pädagogik von kirchlichen und staatlichen Einflüssen und die zunehmende Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Konzepte im Zuge der gesellschaftskritischen Tendenzen der 1960er Jahre. Die Darstellung verdeutlicht, wie Kriegserfahrungen und gesellschaftliche Veränderungen die Bedeutung pädagogischer Autonomie hervorhoben und die autonome Pädagogik zu einem zentralen Thema der Nachkriegs- und 60er-Jahre-Diskussionen machten. Der Prozess der Etablierung der autonomen Pädagogik und ihre Forderungen nach wissenschaftlicher Anerkennung werden ausführlich dargestellt.
Klaus Mollenhauer: Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen (1968): Dieses Kapitel, das den Hauptteil der Arbeit bildet, analysiert Mollenhauers Werk „Erziehung und Emanzipation“. Es thematisiert seine kritische Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und seine Forderung nach einer realistischen Erziehungstheorie, die sich an den gesellschaftlichen Gegebenheiten orientiert. Mollenhauers persönliche und wissenschaftliche Prägung, geprägt von den radikalen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen seiner Zeit, wird als wichtiger Einflussfaktor auf seine Theorien betrachtet. Die Analyse fokussiert auf die zentralen Argumente und Thesen des Werkes, ohne jedoch explizit auf die Einzelheiten der Unterkapitel einzugehen.
Schlüsselwörter
Klaus Mollenhauer, Autonome Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Kritische Erziehungswissenschaft, Emanzipation, Geisteswissenschaftliche Pädagogik, Sozialpädagogik, Gesellschaftskritik, 1968er Bewegung, Funktionalität und Disfunktionalität von Erziehung, Realität, Gesellschaftliche Entwicklungen.
Häufig gestellte Fragen zu "Erziehung und Emanzipation: Klaus Mollenhauer und die Autonome Pädagogik"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Werk „Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen (1968)“ von Klaus Mollenhauer und untersucht dessen Bedeutung für die Entwicklung der autonomen Pädagogik in Deutschland. Der Fokus liegt auf Mollenhauers kritischer Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und seiner Forderung nach einer realistischen Erziehungstheorie, die gesellschaftliche Gegebenheiten berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklungsgeschichte der autonomen Pädagogik in Deutschland, Mollenhauers Kritik an der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, seine Konzepte von Funktionalität und Disfunktionalität von Erziehung, den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen (insbesondere der 68er-Bewegung) auf Mollenhauers Werk und die Bedeutung seiner Thesen für die erziehungswissenschaftliche Diskussion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklungsgeschichte der autonomen Pädagogik in Deutschland, ein Hauptkapitel zur Analyse von Mollenhauers „Erziehung und Emanzipation“, und eine Schlussbetrachtung. Das Kapitel zu Mollenhauer untersucht seine kritische Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und seine Forderung nach einer realistischen Erziehungstheorie.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit setzt einen methodischen Ansatz ein, der die Entwicklung der autonomen Pädagogik in Deutschland einbezieht und Mollenhauers Thesen im Kontext seiner Biographie und der gesellschaftlichen Umstände verortet. Sie verfolgt einen analytischen Ansatz, der Mollenhauers Werk im Detail untersucht und in einen breiteren Kontext einbettet.
Wer ist Klaus Mollenhauer?
Klaus Mollenhauer war eine bedeutende Persönlichkeit der Sozialpädagogik der 60er und 70er Jahre. Seine Arbeit „Erziehung und Emanzipation“ ist ein Schlüsselwerk der kritischen Erziehungswissenschaft und der autonomen Pädagogik.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Autonome Pädagogik, Kritische Erziehungswissenschaft, Emanzipation, Geisteswissenschaftliche Pädagogik, Sozialpädagogik, Funktionalität und Disfunktionalität von Erziehung, und der Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen auf pädagogisches Denken.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Mollenhauers Auseinandersetzung mit der geisteswissenschaftlichen Sozialpädagogik nachvollziehbar darzustellen und in Bezug zu anderen Autoren zu setzen. Sie möchte die Bedeutung seines Werkes für die aktuelle erziehungswissenschaftliche Diskussion herausstellen.
- Quote paper
- Michaela Nadine Leonhardt (Author), 2007, Klaus Mollenhauer: Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen (1968), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142776