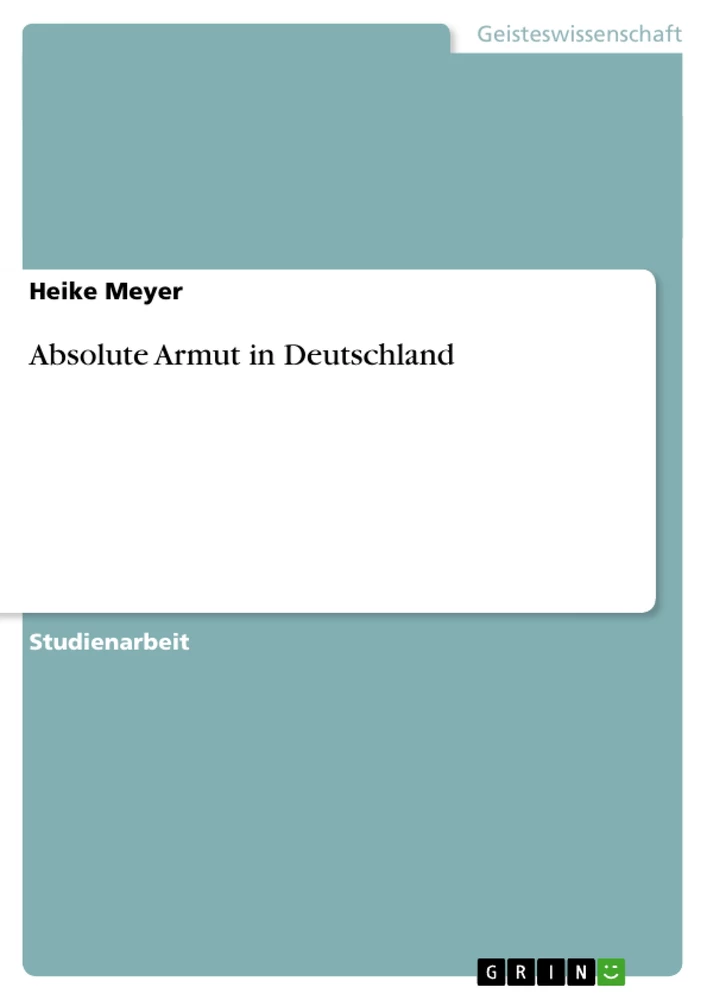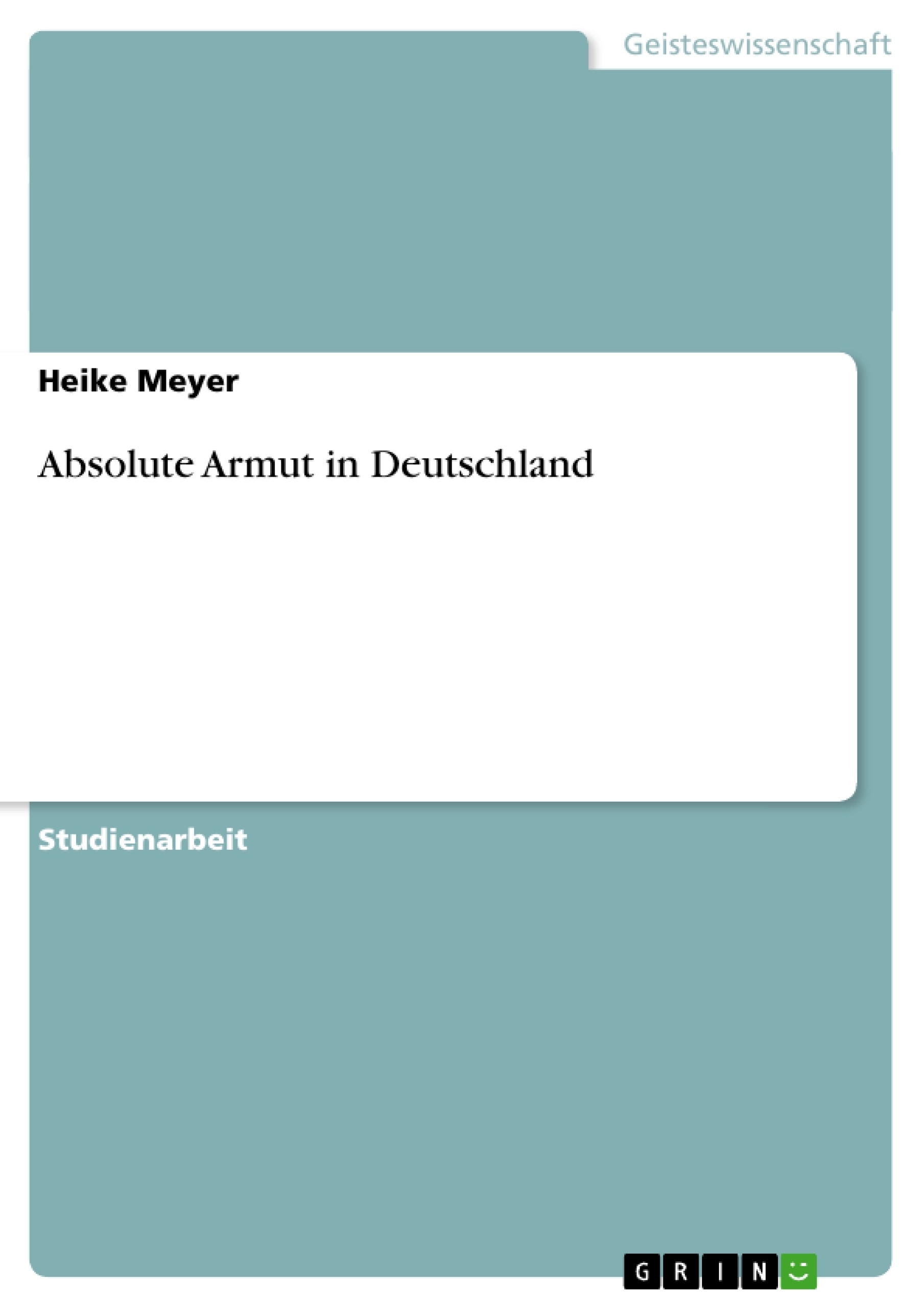Während einer Vorlesung fanden zwei Kommilitoninnen, dass es in Deutschland keine absolute Armut gibt. Sie erläuterten, wer in Mülltonnen nach Nahrung sucht, der bereichert sich zu¬sätzlich, denn es gibt genug Hilfsangebote für Bedürf-tige in Deutschland. Diese Hilfsangebote sind für Deutschland verpflichtend ge-setzlich festgelegt.
„Die Pflicht des Staates, Hilfsangebote anzubieten, lässt sich aus dem Grundge-setz ableiten: Aus Art. 1 GG - Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt – in Verbindung mit Art. 2 GG - dem Recht auf Leben - und dem Sozialstaatsgrundsatz - Art. 20 I GG - erwächst die Pflicht des Staates, ein menschenwürdiges Existenzminimum zu gewährleisten“ (WAGNER 2004: 54).
Sind die Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland wirklich wie ein dichtes Netz, durch das keine Betroffenen durchfallen können? Und falls Betroffene durch das soziale Netz fallen, wer sind sie und warum werden sie nicht von den Hilfsangeboten aufgefangen? Haben sie selbst Schuld, weil sie nicht auf die Hilfs-angebote zugehen?
Diese Arbeit definiert zuerst die hier zugehörigen wichtigsten Grundbegriffe, um dann zu überprüfen, ob die deutschen Sozialgesetze ausreichende gesetzlich ver-ankerte Hilfe anbieten. In einem dritten Schritt wird untersucht, welche betroffe-nen Personengruppen durch das letzte soziale Netz fallen und worin die Ursache begründet ist. Dabei wird die These verfolgt, dass es trotz genügenden gesetzli-chen Vorschriften Menschen gibt, die durch das soziale Netz fallen und das es keine zusätzliche Bereicherung für Personen ist, wenn sie in Mülltonnen nach Nahrung oder Gebrauchsgegenständen suchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 3. Rechtliche Grundlagen
- 4. Betroffene
- 5. Ursachen
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der absoluten Armut in Deutschland. Ziel ist es, die These zu überprüfen, dass trotz ausreichender gesetzlicher Regelungen Menschen in Deutschland in absolute Armut fallen und dies keine zusätzliche Bereicherung darstellt. Die Arbeit analysiert die Definitionen von Armut, die rechtlichen Grundlagen zur Existenzsicherung und die betroffenen Personengruppen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Armutsformen (absolute, relative, extreme Armut)
- Analyse der rechtlichen Grundlagen zur Existenzsicherung in Deutschland
- Identifizierung der betroffenen Personengruppen und deren Charakteristika
- Untersuchung der Ursachen für absolute Armut in Deutschland
- Bewertung der Wirksamkeit bestehender sozialer Hilfesysteme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die These in Frage, dass es in Deutschland keine absolute Armut gibt, da ausreichende Hilfsangebote existieren. Sie problematisiert die Aussage, dass das Aufsuchen von Mülltonnen nach Nahrung eine Bereicherung darstellt und fragt nach den Gründen, warum manche Menschen trotz bestehender Hilfesysteme in Armut leben. Die Arbeit kündigt die folgende Vorgehensweise an: Definition der zentralen Begriffe, Prüfung der deutschen Sozialgesetze, Untersuchung betroffener Personengruppen und deren Ursachen.
2. Definitionen: Dieses Kapitel differenziert zwischen relativer, bekämpfter und absoluter Armut. Relative Armut wird im Kontext des gesellschaftlichen Wohlstands definiert, während bekämpfte Armut den Bezug von Arbeitslosengeld II beschreibt. Absolute Armut hingegen charakterisiert den Mangel an grundlegenden Gütern wie Nahrung, Kleidung und Obdach. Das Kapitel erläutert die Definition von extremer Armut nach dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung und hebt den Unterschied zu absoluter Armut hervor. Der Begriff der Obdachlosigkeit wird ebenfalls definiert und mit der absoluten und extremen Armut in Verbindung gebracht.
3. Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel (nicht im Auszug enthalten, muss aus dem Originaltext erschlossen werden) würde die gesetzlichen Grundlagen der Existenzsicherung in Deutschland untersuchen. Es wird wahrscheinlich auf Artikel des Grundgesetzes eingehen und die Rolle des Sozialstaats bei der Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums beleuchten. Die Analyse würde die Frage aufgreifen, ob die gesetzlichen Regelungen tatsächlich ausreichend sind und alle Bedürftigen erreichen.
4. Betroffene: Dieses Kapitel (nicht im Auszug enthalten, muss aus dem Originaltext erschlossen werden) würde sich mit den Personengruppen auseinandersetzen, die von absoluter Armut betroffen sind. Es wird wahrscheinlich verschiedene Soziodemografische Faktoren untersuchen und möglicherweise auf statistische Daten zurückgreifen. Der Fokus liegt vermutlich auf der Beschreibung der betroffenen Bevölkerungsgruppen und ihren jeweiligen Herausforderungen.
5. Ursachen: Dieses Kapitel (nicht im Auszug enthalten, muss aus dem Originaltext erschlossen werden) würde die Ursachen von absoluter Armut in Deutschland analysieren. Mögliche Aspekte sind strukturelle Faktoren, wie Arbeitslosigkeit, fehlende Bildung oder Diskriminierung. Die Analyse würde möglicherweise verschiedene Ebenen betrachten – individuelle, soziale und politische Faktoren – und die Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzeigen.
Schlüsselwörter
Absolute Armut, relative Armut, extreme Armut, Obdachlosigkeit, Sozialhilfe, Sozialgesetzgebung, Existenzminimum, Grundgesetz, Deutschland, Hilfsangebote, soziale Netzwerke, Ursachen der Armut.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Absolute Armut in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der absoluten Armut in Deutschland und hinterfragt die These, dass trotz ausreichender gesetzlicher Regelungen Menschen in absolute Armut fallen. Sie analysiert Definitionen von Armut, rechtliche Grundlagen, betroffene Personengruppen und die Ursachen für absolute Armut.
Welche Arten von Armut werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen absoluter, relativer und extremer Armut. Absolute Armut beschreibt den Mangel an grundlegenden Gütern (Nahrung, Kleidung, Obdach). Relative Armut wird im Kontext des gesellschaftlichen Wohlstands definiert, während bekämpfte Armut den Bezug von Arbeitslosengeld II umfasst. Extrem Armut wird nach der Definition des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung erläutert und von absoluter Armut abgegrenzt. Der Begriff der Obdachlosigkeit wird ebenfalls definiert und mit absoluter und extremer Armut in Verbindung gebracht.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die gesetzlichen Grundlagen der Existenzsicherung in Deutschland. Dies beinhaltet wahrscheinlich Artikel des Grundgesetzes und die Rolle des Sozialstaats. Es wird analysiert, ob die gesetzlichen Regelungen ausreichend sind und alle Bedürftigen erreichen.
Welche Personengruppen sind von absoluter Armut betroffen?
Dieses Kapitel (im Auszug nicht enthalten) analysiert die Personengruppen, die von absoluter Armut betroffen sind. Es werden wahrscheinlich soziodemografische Faktoren untersucht und statistische Daten herangezogen, um die betroffenen Bevölkerungsgruppen und ihre Herausforderungen zu beschreiben.
Was sind die Ursachen für absolute Armut in Deutschland?
Dieses Kapitel (im Auszug nicht enthalten) analysiert die Ursachen von absoluter Armut. Es werden wahrscheinlich strukturelle Faktoren wie Arbeitslosigkeit, fehlende Bildung oder Diskriminierung untersucht. Die Analyse betrachtet verschiedene Ebenen (individuell, sozial, politisch) und die Zusammenhänge zwischen diesen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Definitionen, rechtlichen Grundlagen, betroffenen Personengruppen, Ursachen und eine Schlussbetrachtung. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Absolute Armut, relative Armut, extreme Armut, Obdachlosigkeit, Sozialhilfe, Sozialgesetzgebung, Existenzminimum, Grundgesetz, Deutschland, Hilfsangebote, soziale Netzwerke, Ursachen der Armut.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These hinterfragt die Annahme, dass in Deutschland keine absolute Armut existiert, da ausreichende Hilfsangebote vorhanden sind. Die Arbeit untersucht, warum Menschen trotz bestehender Hilfesysteme in Armut leben.
- Quote paper
- Bachelor Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (Uni) Heike Meyer (Author), 2006, Absolute Armut in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142722