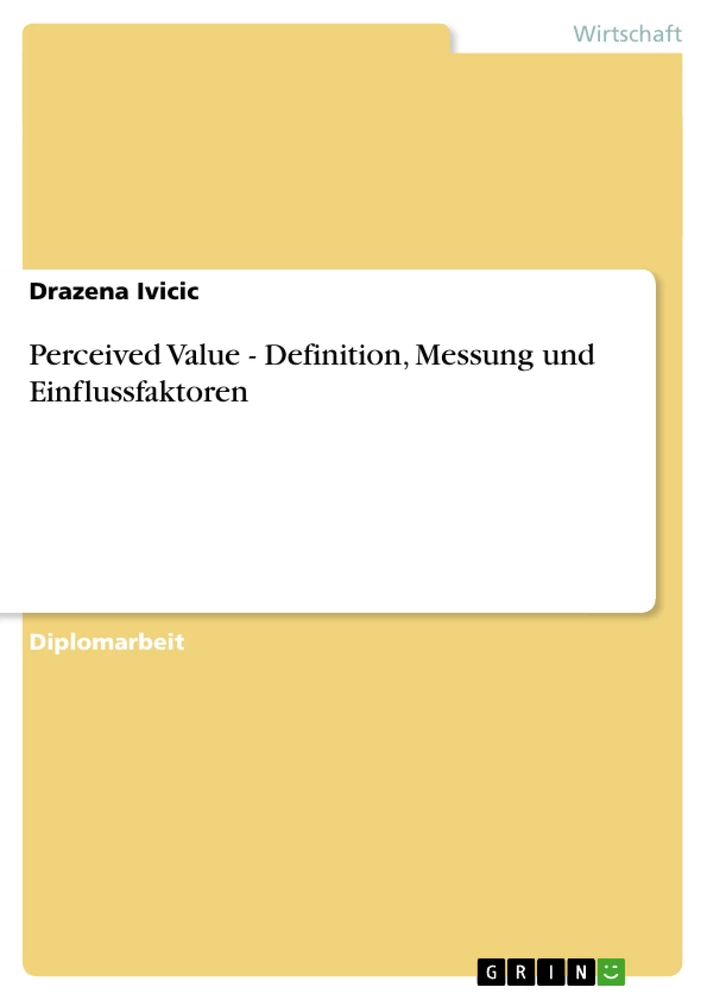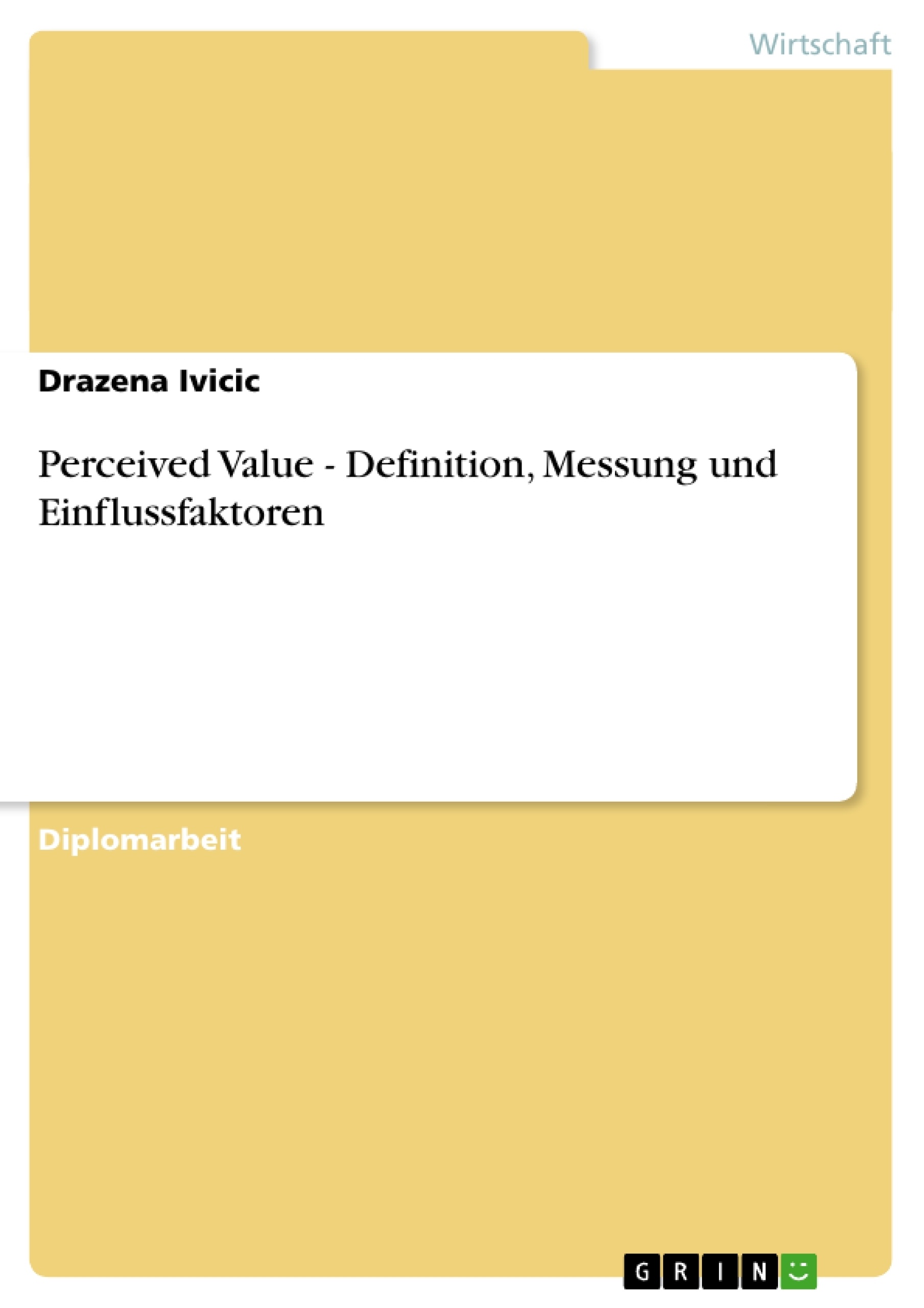In den heutigen wettbewerbsorientierten Märkten sind Produkte und Dienstleistungen innerhalb der gleichen Branche häufig sehr ähnlich. Die Unternehmen sind sich bewusst geworden, dass die Kundenorientierung die größte Quelle des Wettbewerbsvorteils dar-stellt (vgl. Woodruff 1997, S. 139; Sweeney/Soutar 2001, S. 204).
Aus Sicht der Konsumenten ist der Erhalt von Value das grundlegende Kaufziel und Zeichen einer erfolgreichen Transaktion (vgl. Patterson/Spreng 1997, S. 414). Die Entscheidung, wie man den Kunden den überlegenen wettbewerbsfähigen Value liefern kann, wirft jedoch schwierige Fragen auf. Diese sind u.a.: Was genau bewerten die Kunden? Welchen Dingen schreiben die Kunden einen Value zu? Auf welche dieser Dinge sollte sich ein Unternehmen fokussieren, um einen Vorteil erzielen zu können? Deshalb ist es für Unternehmen von großer Bedeutung zu verstehen, was sich Konsu-menten durch den Kauf und Gebrauch eines Produktes erhoffen bzw. erreichen wollen (vgl. Woodruff 1997, S. 140). Das Wissen darüber, wo der Value aus Sicht des Kunden verwurzelt ist, hat daher für das Management sehr große Bedeutung (vgl. Ulaga/Chacour 2001, S. 525-526). Infolgedessen hat sich das Konzept Perceived Value als strategischer Imperativ in den 1990er Jahren herausgebildet. Daher beschäftigen sich zahlreiche Studien mit der Konzeptualisierung und Messung von Perceived Value (vgl. Sweeney/Soutar/Johnson 1999, S. 78; Wang et al. 2004, S. 169).
Trotz des breiten Interesses wird Perceived Value in den Studien unterschiedlich definiert und gemessen (vgl. Zeithaml 1988, S. 2). Aus diesem Grund ist das wachsende Wissen über das Konzept stark fragmentiert und das Arbeiten in diesem Bereich er-schwert (vgl. Wang et al. 2004, S. 169). Zugleich wird den Studien vorgeworfen, die Konzeptualisierungen und Messungen wären inadäquat und inkonsistent (vgl. Zeithaml 1988, S. 2). Verschiedene Standpunkte werden befürwortet, ohne dass diese unterschiedlichen Ansichten in ein allgemein geltendes Rahmenkonzept zusammengefügt wurden (vgl. Wang et al. 2004, S. 169).
Generell wird in der Literatur zwischen zwei Forschungssträngen zur Konzeptualisierung, Operationalisierung und Messung von Perceived Value unterschieden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Begriffliche Abgrenzung und Einordnung von Perceived Value
- Definitionen von Perceived Value und ihre Abgrenzung
- Abgrenzung von Perceived Value, Acquisition Value und Transaction Value
- Nutzen- und Opferkomponenten von Perceived Value
- Definitionen der Dimensionen von Perceived Value
- Messung von Perceived Value als eindimensionales Konstrukt
- Perceived Value-Ansatz von Monroe
- Perceived Value-Konzept von Zeithaml
- Studien zur Konzeptualisierung und Messung von Perceived Value
- Operationalisierung von Perceived Value
- Messung von Perceived Value als mehrdimensionales Konstrukt
- Customer Value-Hierarchie nach Woodruff - Dynamik von Perceived Value
- Dimensionierung von Value nach Holbrook
- Utilitarian und Hedonic Value nach Babin/Darden/Griffin
- Dimensionierung von Value nach Sheth/Newman/Gross
- Einflussfaktoren von Perceived Value
- Einfluss extrinsischer Attribute auf den Perceived Value
- Einfluss der wahrgenommenen Qualität und Opfer auf den Perceived Value
- Einfluss der Einkaufserfahrung auf den Perceived Value
- Einfluss des wahrgenommenen Risikos auf den Perceived Value
- Einfluss der Preisgünstigkeit auf den Perceived Value
- Zusammenfassung und Implikationen
- Zusammenfassung
- Implikationen für die zukünftige Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept des Perceived Value, das in heutigen wettbewerbsintensiven Märkten von großer Bedeutung ist. Die Arbeit befasst sich mit der Definition, Messung und den Einflussfaktoren des Perceived Value und analysiert verschiedene Ansätze zur Konzeptualisierung und Operationalisierung dieses Konstrukts.
- Definition und Abgrenzung des Konzepts Perceived Value
- Analyse verschiedener Ansätze zur Messung des Perceived Value (eindimensional und mehrdimensional)
- Untersuchung der Einflussfaktoren auf den Perceived Value, wie z.B. extrinsische Attribute, Qualität, Opfer, Einkaufserfahrung, Risiko und Preisgünstigkeit
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Implikationen für die zukünftige Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in das Thema Perceived Value ein und stellt die Problemstellung der Arbeit dar.
- Kapitel 2 definiert Perceived Value und grenzt ihn von anderen Value-Konzepten ab. Es werden die Nutzen- und Opferkomponenten des Perceived Value erläutert und verschiedene Dimensionen des Konzepts diskutiert.
- Kapitel 3 beleuchtet die Messung des Perceived Value als eindimensionales Konstrukt und analysiert verschiedene Ansätze von Monroe und Zeithaml. Es werden Studien zur Konzeptualisierung und Messung des Perceived Value vorgestellt und die Operationalisierung des Konstrukts diskutiert.
- Kapitel 4 behandelt die Messung des Perceived Value als mehrdimensionales Konstrukt. Es werden verschiedene Modelle zur Dimensionierung des Perceived Value vorgestellt, wie z.B. die Customer Value-Hierarchie nach Woodruff, die Typologie von Holbrook, die Unterscheidung von Utilitarian und Hedonic Value nach Babin/Darden/Griffin sowie die Dimensionierung nach Sheth/Newman/Gross.
- Kapitel 5 untersucht die Einflussfaktoren auf den Perceived Value. Es werden verschiedene Einflussfaktoren analysiert, wie z.B. extrinsische Attribute, Qualität, Opfer, Einkaufserfahrung, Risiko und Preisgünstigkeit.
Schlüsselwörter
Perceived Value, Customer Value, Value-Konzepte, Messung, Dimensionierung, Einflussfaktoren, extrinsische Attribute, Qualität, Opfer, Einkaufserfahrung, Risiko, Preisgünstigkeit, Marketing, Konsumentenverhalten, Wettbewerb, strategisches Management
- Quote paper
- Drazena Ivicic (Author), 2009, Perceived Value - Definition, Messung und Einflussfaktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142706