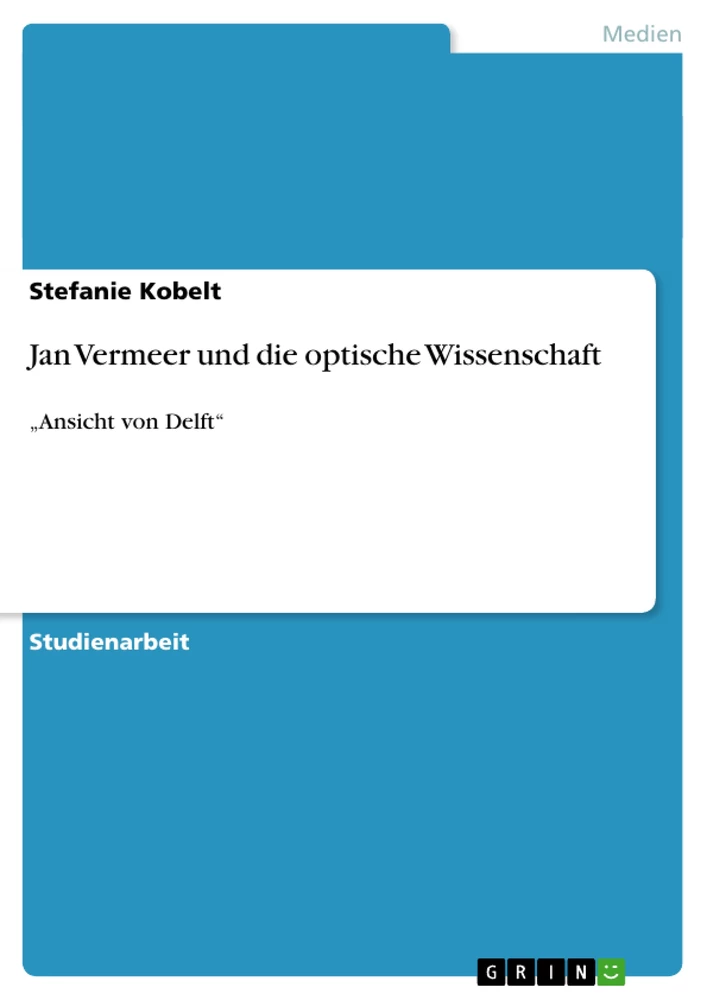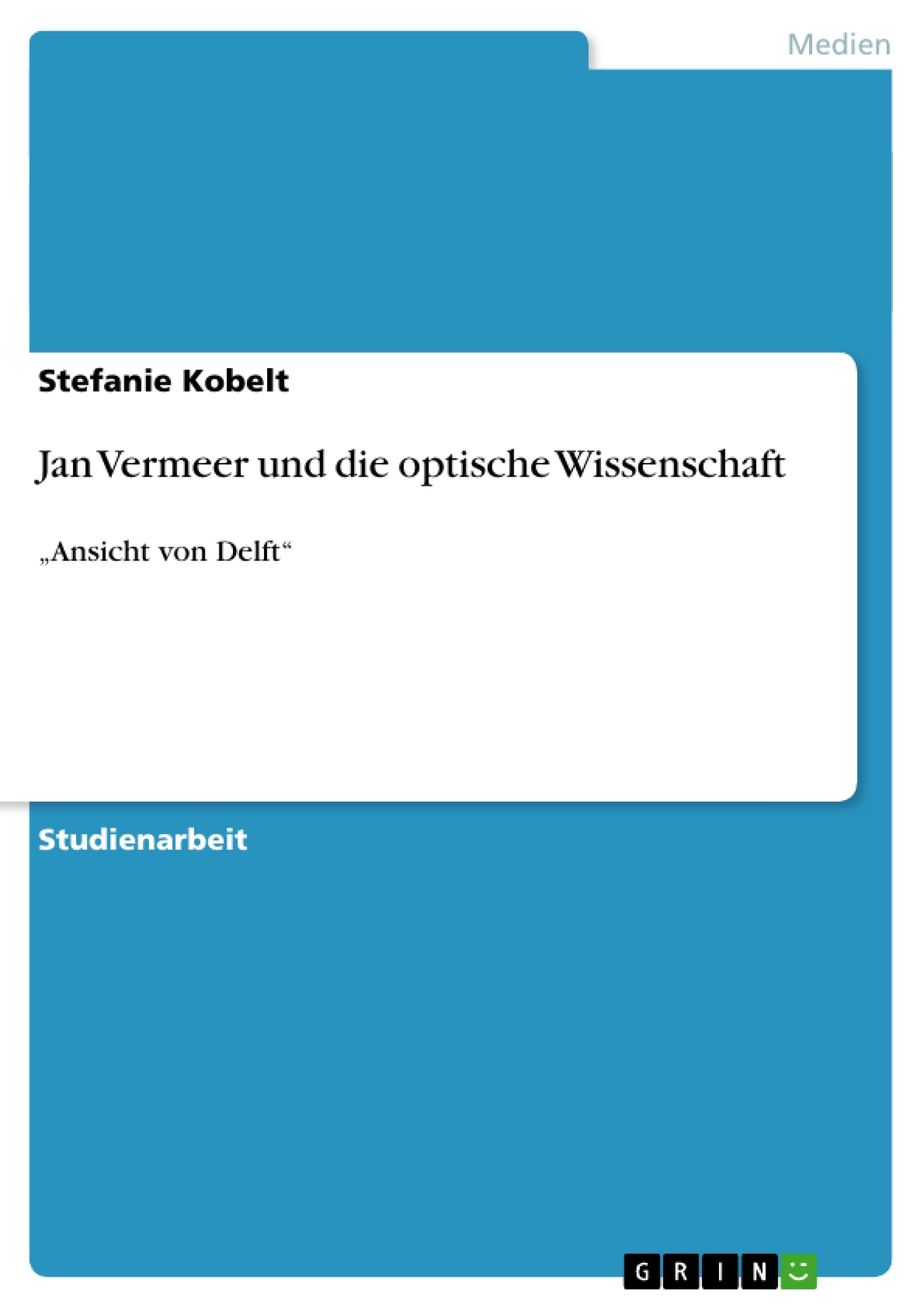In der „Ansicht von Delft“, eines der Hauptwerke von Jan Vermeer , wird die subjektive Betrachtung des Gemäldes vorbildhaft gelenkt. Besonderes durch den Einsatz von Farben, Licht und Schatten hinterlässt das Bild einen prägenden, lang anhaltenden, sich tief in der Erinnerung des Betrachters verankerten, Sinneseindruck. Vermeers Werke sind sehr ansprechend und erzeugen eine sensorische Interaktion, d.h. werden beim Betrachten seiner Bilder, verschiedenste menschliche Sinne stimuliert. Selbst der Geruchssinn wird „durch das würzige Aroma der feuchten Erde, des Wasser und der bewegten Luft“ stimuliert. Der holländische Maler versucht eine wirklichkeitsgetreue, maßstabsgerechte, photographische Momentaufnahme zu schaffen. Gegen diese Aussage spricht vor allem der ungewöhnlich, intensive Einsatz von Licht und Farben. Um Dies zu erklären, wird angenommen, dass Vermeer sich die Wirkungsweise einer Camera Obscura zu nutze gemacht hat. Das stellt eine rationale Erklärung für die neuartige und nur schwer herzuleitende Malweise dar. Denn es fallen einige maltechnische Besonderheiten in dem 1660/61 gemalten Bild auf. Helle Lichttupfer auf Booten und Wasser, die so genannten Pointellès , sind im Gemälde zu erkennen. Diese entstehen in der Camera Obscura, wenn gebündelte, vom Objektiv reflektierte Lichtstrahlen durch die Linse fallen. Aber solche Lichthöfe bilden sich nur auf reflektierenden Oberflächen, nicht aber auf verschatteten Flächen im Wasser oder an Booten. Das könnte heißen, dass Vermeer dieses Phänomen der Camera Obscura kannte, aber nicht eins zu eins übernahm, sondern es an seine Bedürfnisse angepasst verwendete. Durch die fehlende Auftraggebersituation und die ereignisfreie Darstellung, ist die eindeutige historische Funktion nur schwer nachvollziehbar. Dieses durch und durch kombinierte Bild, soll beim Betrachter verschiedene Assoziationen und Wahrnehmungen erzeugen. Der wahrnehmungspsychologische Aspekt und die Vielfältigkeit des Sehens werden im Folgenden näher erläutert. Des Weiteren wird die Aussage diskutiert, ob „Ansicht von Delft“ ein „Propagandawerk der Malkunst“ darstellt und wie dies von Vermeer malerisch umgesetzt wurde. Auch kunsttheoretische Debatten, der damaligen Zeit, sollen als Grundlage für seine Malweise und die zu erzeugenden Effekte analysiert werden. Und als letzten Punkt bleibt noch zu hinterfragen, wie Vermeer es vollbracht hat mit der Bildtradition seiner Vorgänger zu brechen und doch die gleiche Aussage beizubehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildbeschreibung
- Analyse des Dargestellten: topografische Wirklichkeit oder nicht?
- Bildertradition der Stadtansichten
- Allgemeines
- Bildform und frühe Beispiele
- Vergleich mit Jan Vermeers „Ansicht von Delft“
- Prinzip der Horizontalisierung
- Spiel mit dem Betrachterauge
- Einsatz von Farbe
- Einsatz von lasurartigen und pastorösen Farbflächen
- kunsttheoretischer Ansatz
- Fernbild als Nahraumerlebnis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar widmet sich der Analyse von Jan Vermeers „Ansicht von Delft“ und untersucht die Bedeutung der optischen Wissenschaft für seine Malweise. Besonderes Augenmerk liegt auf der Subjektivität der Betrachtungserfahrung, die Vermeer durch den Einsatz von Farben, Licht und Schatten erzeugt.
- Die Beziehung zwischen Malerei und optischer Wissenschaft
- Die Rolle der Camera Obscura in Vermeers Kunst
- Die Analyse der malerischen Mittel zur Gestaltung von Raum und Perspektive
- Die Untersuchung der Wahrnehmungspsychologie und der Wirkungsweise des Bildes auf den Betrachter
- Die Positionierung von „Ansicht von Delft“ innerhalb der Tradition der Stadtansichten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema des Seminars vor und skizziert die zentralen Fragestellungen, die im Zusammenhang mit Vermeers „Ansicht von Delft“ untersucht werden sollen.
- Die Bildbeschreibung bietet einen detaillierten Überblick über das Gemälde, wobei die wichtigsten Elemente der Komposition und des Motivs beschrieben werden.
- Die Analyse des Dargestellten befasst sich mit der Frage, inwiefern „Ansicht von Delft“ eine topografisch genaue Darstellung der Stadt Delft bietet.
- Das Kapitel über die Bildertradition der Stadtansichten untersucht die Entwicklung der Bildgattung im 17. Jahrhundert in Holland und setzt Vermeers Werk in Relation zu früheren Beispielen.
- Das Prinzip der Horizontalisierung erläutert die Gestaltungsstrategie, die Vermeer anwendet, um die horizontale Ausrichtung des Bildes zu betonen und einen tiefenräumlichen Eindruck zu vermeiden.
- Das Kapitel über das Spiel mit dem Betrachterauge analysiert die unterschiedlichen Farbtechniken, die Vermeer einsetzt, um dem Betrachter eine lebendige und dynamische Betrachtungserfahrung zu ermöglichen.
- Das Kapitel über das Fernbild als Nahraumerlebnis untersucht, wie Vermeer durch seine Malweise dem Betrachter den Eindruck vermittelt, die dargestellte Stadt quasi greifbar zu machen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe und Themen des Textes sind: Jan Vermeer, „Ansicht von Delft“, optische Wissenschaft, Camera Obscura, Stadtansicht, Horizontalisierung, Farbauftrag, Wahrnehmungspsychologie, Maltechnik, Kunsttheorie, Fernbild, Nahraumerlebnis. Diese Begriffe spiegeln die zentralen Forschungsgebiete und Diskussionspunkte des Seminars wider.
- Citation du texte
- Stefanie Kobelt (Auteur), 2009, Jan Vermeer und die optische Wissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142534