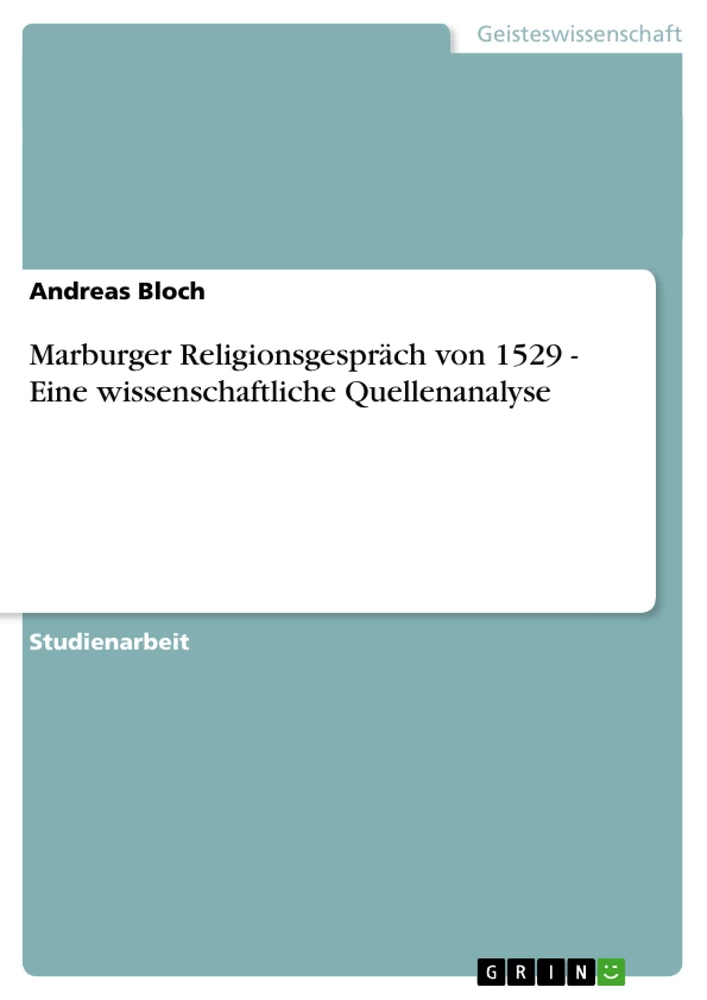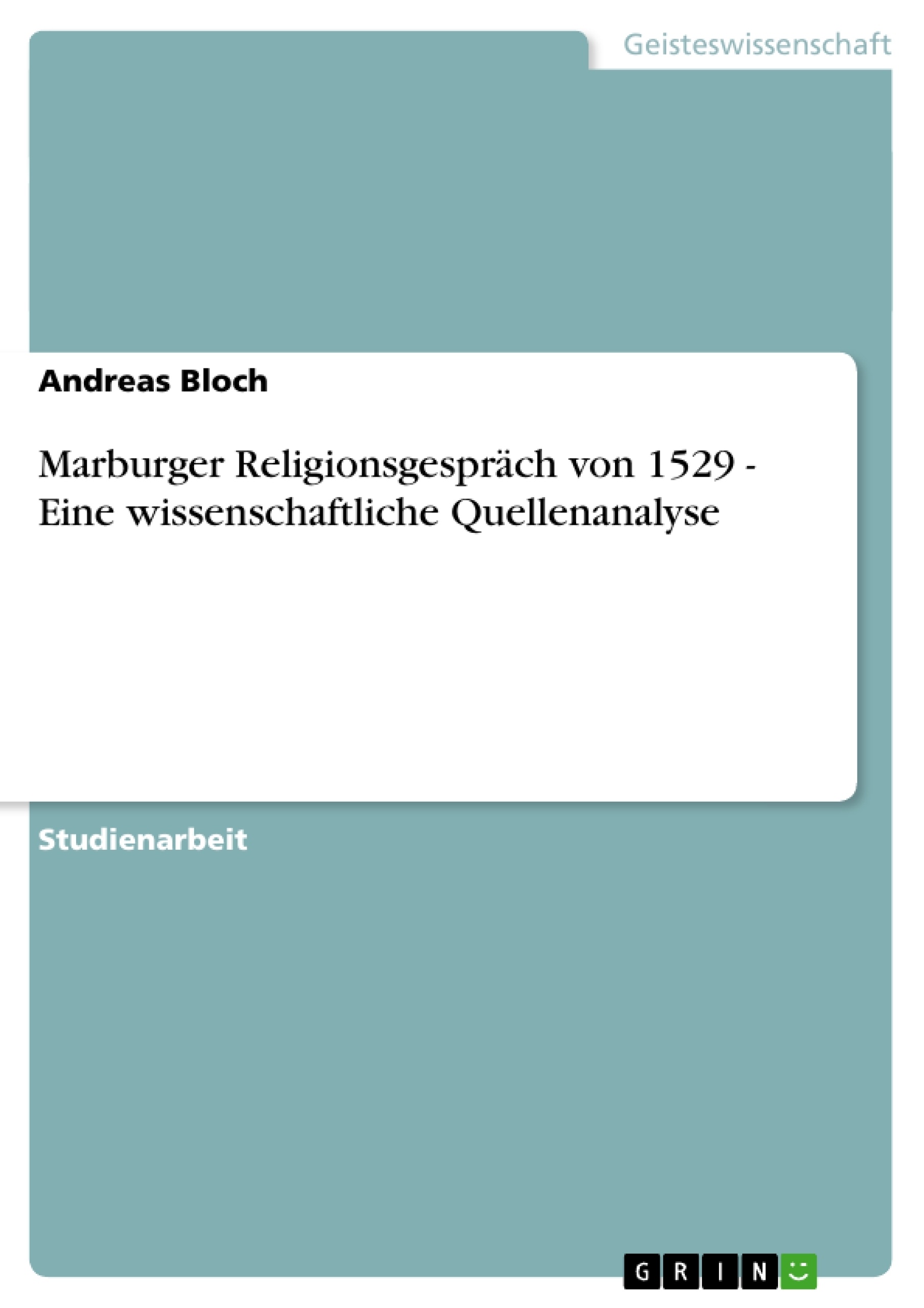Das Marburger Religionsgespräch ist ein theologisches Streitgespräch zwischen den Reformatoren Dr. Martin Luther und Huldrych (Ulrich) Zwingli. Der Austausch der beiden Gelehrten fand in Marburg
vom 02. bis 03. Oktober 1529 in Gegenwart von Philipp Melanchthon auf Seiten Dr. Martin Luthers und Johannes Ökolampad , der überwiegend die Positionen Zwinglis teilte, statt.
Es ist anzumerken – bei Durchsicht theologischer und historischer Fachliteratur zur Erschließung rub-rizierter Quelle - dass es zum einen Differenzen in der Erwähnung der am Marburger Religionsge-spräch Partizipierenden gibt , zum anderen auch unterschiedliche Zeitangaben über die Zusammen-kunft in Marburg.
Der vorliegenden Quelle ist ein Dialog über die Bedeutung des Abendmahls zwischen Huldrych Zwingli und Dr. Martin Luther zu entnehmen. Das Gespräch wird von beiden Theologen rhetorisch geschickt und teilweise sehr emotional geführt (Luther: “Ha! Ich scheiß auf die Vernunft!“, Zwingli: “Diese Stelle bricht Euch den Hals, Luther.“) .
Disputiert wird insbesondere über die Einsetzungsworte zum Abendmahl „Das ist mein Leib“ („hoc est corpus meum“) und die Frage, wie die Gegenwärtigkeit (Ubiquitätslehre, die Luther vertrat, versus einer örtlich-räumlichen Begrenzungsauffassung Zwinglis: Christus sitzt zur Rechten Gottes) Jesu Christi im Mahl zu verstehen sei.
Für Luther ergibt sich aus den Einsetzungsworten eine Realpräsenz Jesu Christi beim Abendmahl (das ist mein Leib); Zwingli legt die Einsetzungsworte weitgehender- übertragender aus (das bedeu-tet mein Leib) und sieht daher das letzte Mahl als Symbol- und Erinnerungshandlung an .
Beide Seiten führen zur Begründung Ihrer Positionen und Überzeugungen Bibelstellen (u. a. Math.26,26 und 1. Kor.11,24 und Joh 6, V 63) an.
Der vorliegenden Quelle ist zu entnehmen, dass beide Seiten ernsthaft bemüht sind, den Dissensus in der Abendmahlslehre aufzuheben, jedoch faktisch zu keiner einigenden Position finden konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sich ergebende Fragestellungen zur Quelle
- Wie und warum kam es zu dem Gelehrtenstreit in Marburg?
- Mit welchem Resultat wurde das Gespräch der Evangelischen beendet?
- Welche Auswirkungen hat das Marburger Religionsgespräch für die reformatorischen Kräfte?
- Wie ist das römisch-katholische Abendmahlsverständnis?
- Abschließende Betrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Marburger Religionsgespräch von 1529 anhand wissenschaftlicher Quellen. Ziel ist es, die Hintergründe des Gesprächs, die beteiligten Theologen und ihre Positionen zum Abendmahl, sowie die Folgen des Gesprächs für die reformatorische Bewegung zu beleuchten.
- Die Ursachen und Hintergründe des Marburger Religionsgesprächs
- Die gegensätzlichen Abendmahlsauffassungen Luthers und Zwinglis
- Das Ergebnis des Gesprächs und dessen Bedeutung für die Einheit der Reformation
- Die politischen Implikationen des theologischen Disputs
- Die Rolle Philipps von Hessens bei der Organisation und dem Ablauf des Gesprächs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Marburger Religionsgespräch zwischen Martin Luther und Huldrych Zwingli im Oktober 1529 vor und erwähnt Differenzen in der historischen Literatur bezüglich der Teilnehmer und des genauen Zeitraums. Sie hebt den zentralen Disput über das Abendmahl und die unterschiedlichen Interpretationen der Einsetzungsworte hervor, wobei Luthers Betonung der Realpräsenz und Zwinglis symbolische Auffassung im Fokus stehen. Die Einleitung deutet bereits auf die emotional aufgeladene Atmosphäre des Gesprächs hin.
Sich ergebende Fragestellungen zur Quelle: Dieses Kapitel analysiert die Hintergründe des Marburger Religionsgesprächs. Es beleuchtet die zuvor gescheiterten Versuche, eine einheitliche evangelische Position zu den Schwabacher Artikeln zu finden, welche die unterschiedlichen Auffassungen zum Abendmahl offenlegten. Der Abschnitt unterstreicht die politische Motivation Philipps von Hessens, der durch die Einigung der reformatorischen Kräfte seine Machtposition stärken und gegen den Kaiser vorgehen wollte. Der Konflikt wird somit als theologischer und politischer Disput dargestellt, der die Notwendigkeit des Marburger Treffens verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Marburger Religionsgespräch, Martin Luther, Huldrych Zwingli, Abendmahl, Realpräsenz, Symbolhandlung, Reformation, Philipp von Hessen, Theologischer Disput, Politische Implikationen, Schwabacher Artikel.
Häufig gestellte Fragen zum Marburger Religionsgespräch
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über das Marburger Religionsgespräch von 1529. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Hintergründe, der beteiligten Theologen (Luther und Zwingli), ihrer gegensätzlichen Auffassungen zum Abendmahl, sowie den Folgen des Gesprächs für die reformatorische Bewegung und die politische Landschaft.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt zentrale Aspekte des Marburger Religionsgesprächs, darunter die Ursachen und Hintergründe des Gesprächs, die unterschiedlichen Abendmahlsauffassungen Luthers (Realpräsenz) und Zwinglis (symbolische Auffassung), das Ergebnis des Gesprächs und dessen Auswirkungen auf die Einheit der Reformation, die politischen Implikationen des theologischen Disputs und die Rolle Philipps von Hessens.
Welche Fragen werden im Dokument gestellt und beantwortet?
Das Dokument formuliert und beantwortet (in der vollständigen Arbeit) folgende Fragen: Wie und warum kam es zum Gelehrtenstreit in Marburg? Mit welchem Resultat wurde das Gespräch der Evangelischen beendet? Welche Auswirkungen hatte das Marburger Religionsgespräch für die reformatorischen Kräfte? Wie ist das römisch-katholische Abendmahlsverständnis (implizit durch den Vergleich mit den reformatorischen Positionen)?
Welche Kapitel sind in der Arbeit enthalten?
Die Arbeit beinhaltet mindestens eine Einleitung, ein Kapitel zu den sich ergebenden Fragestellungen zur Quelle, eine abschließende Betrachtung und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung beschreibt das Marburger Religionsgespräch und die zentralen Diskussionspunkte. Das Kapitel zu den Fragestellungen analysiert die Hintergründe des Gesprächs, die gescheiterten Versuche einer Einigung und die politische Motivation Philipps von Hessens.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Marburger Religionsgespräch, Martin Luther, Huldrych Zwingli, Abendmahl, Realpräsenz, Symbolhandlung, Reformation, Philipp von Hessen, Theologischer Disput, Politische Implikationen, Schwabacher Artikel.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Marburger Religionsgespräch anhand wissenschaftlicher Quellen. Ziel ist es, die Hintergründe des Gesprächs, die Positionen der beteiligten Theologen zum Abendmahl und die Folgen des Gesprächs für die reformatorische Bewegung zu beleuchten.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Es werden Zusammenfassungen der Einleitung und des Kapitels zu den sich ergebenden Fragestellungen zur Quelle bereitgestellt. Die Einleitung stellt das Marburger Religionsgespräch vor und hebt die zentralen Diskussionspunkte hervor. Das zweite Kapitel beleuchtet die Hintergründe des Gesprächs, einschliesslich der gescheiterten Versuche einer vorherigen Einigung und der politischen Motivation Philipps von Hessens.
- Quote paper
- Diplom-Religionspädagoge (FH) Andreas Bloch (Author), 2003, Marburger Religionsgespräch von 1529 - Eine wissenschaftliche Quellenanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14251