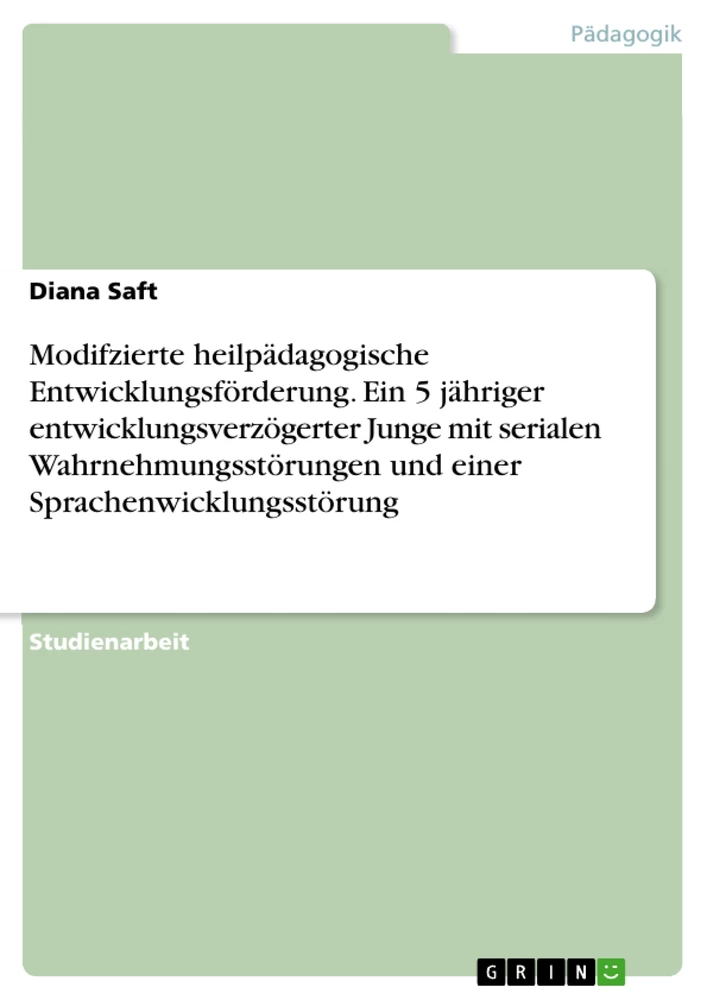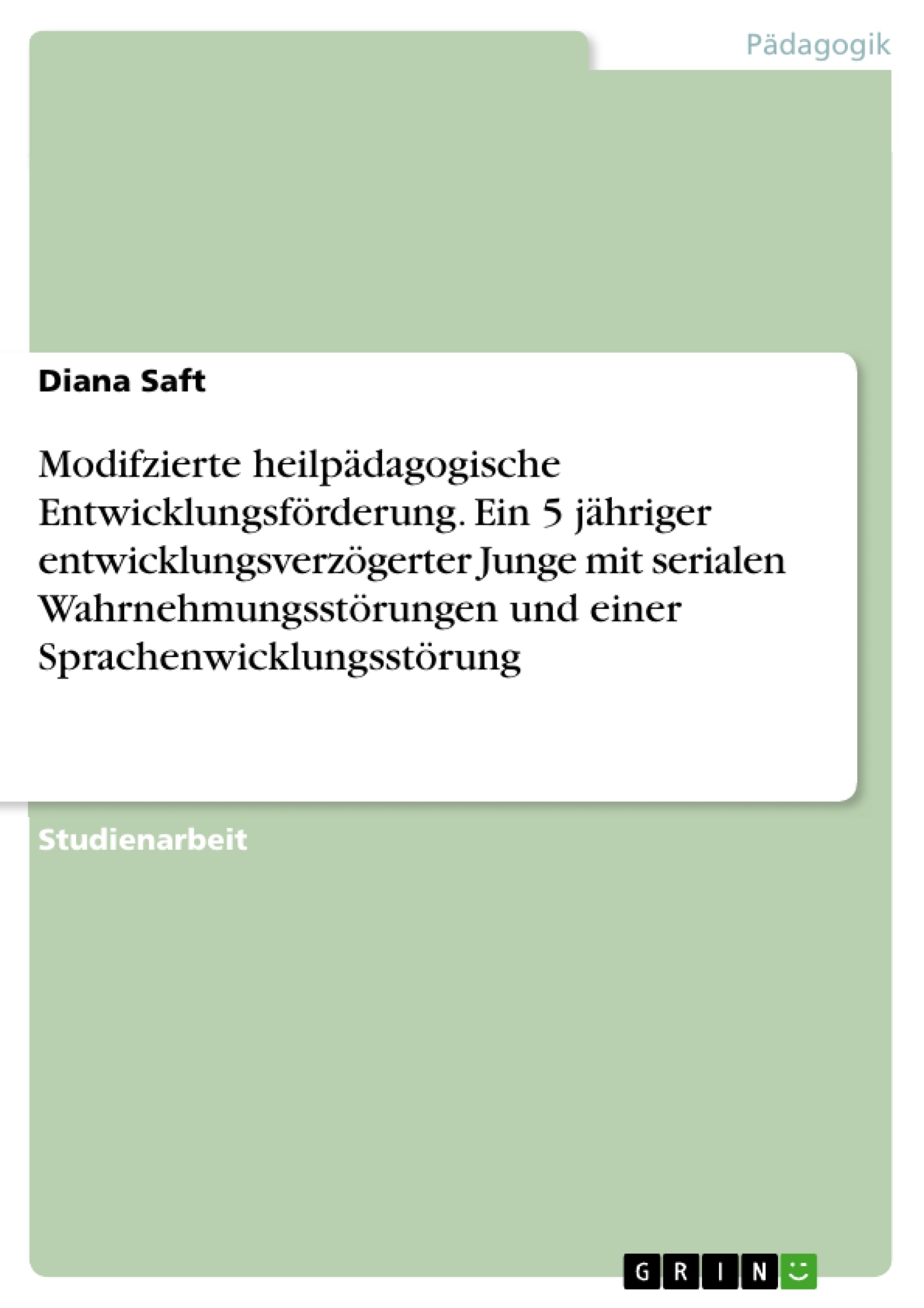Den Anstoß für die Auseinandersetzung mit dem Thema Sprachentwicklungsstörungen bzw. -verzögerungen lieferten mehrere Ereignisse: Zum einen lernte ich in meinem Praktikum Kinder mit sehr schwankenden Sprachniveaus kennen. Hier fiel mir auch Bernd auf. Seine Äußerungen waren anfangs nur schwer zu verstehen und schwer nachzuvollziehen.
Aufgrund dieser Erfahrungen stellte sich für mich die Frage, wie Sprachentwicklung normalerweise verläuft und wann abgrenzend von einer Verzögerung oder Sprachentwicklungsstörung gesprochen und wie man heilpädagogisch die Sprachentwicklung fördern kann. Durch Bernds offene Art mir gegenüber fiel der Erstkontakt mit ihm leicht.
Da ich mich für Sprachentwicklung interessiere und Bernd alleine schon wegen seiner Sprachentwicklungsverzögerung sich von der Gruppe isolierte, beobachtete ich ihn genauer und spielte auf seinen Wunsch auch mit. Während meiner Beobachtungszeit fielen mir bei Bernd in vielen Bereichen Entwicklungsrückstände auf. Ich beschäftigte mich deshalb intensiv auch mit dem Thema Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren, um zu erfahren, auf welcher Entwicklungsstufe Bernd steht und wann von einer Entwicklungsverzögerung gesprochen wird. Des Weiteren beschäftigte ich mich in dieser Arbeit mit dem Thema Wahrnehmungsstörungen, da ich bei Bernd eine Störung in der Serialität beobachten konnte und die Wahrnehmungsstörungen im Zusammenhang mit den beiden vorher genannten Themen stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rahmenbedingungen
- 2.1 Konzeption
- 2.2 Kooperation und Kommunikation zwischen mir und dem Team
- 3 Vorstellung des Kindes
- 3.1 Steckbrief
- 3.2 Verhalten in der Einrichtung
- 3.3 Behandlungsanlass
- 4 Diagnostik
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Ergebnisse der Spielbeobachtung und der Verhaltensbeobachtung
- 4.3 Sprache/Kommunikation
- 4.4 Grobmotorik
- 4.5 Feinmotorik
- 4.6 Wahrnehmung der Raumlage
- 4.7 Kognition
- 4.8 Mnestische Funktionen (Aufmerksamkeit und Leistungsmotivation)
- 4.9 Kurzdiagnostik einer Frühförderstelle
- 5 Hypothesen
- 5.1 Intermodalitätsstufe
- 5.2 Sprache und Sozialverhalten
- 5.3 Erziehungsstil und Bindungsverhalten
- 6 Theoretische Erklärungsmodelle
- 6.1 Entwicklungspsychologische Grundlagen nach Piaget
- 6.1.1 Einleitung
- 6.1.2 Piagets Stadien der kognitiven Entwicklung
- 6.2 Entwicklungsverzögerungen
- 6.3 Erziehungsstil und Bindungsverhalten
- 6.3.1 Permissiver Erziehungsstil
- 6.3.2 Bindungsverhalten
- 6.4 Wahrnehmung
- 6.4.1 Integration und Störung der Sinne
- 6.4.2 Wahrnehmung der Serialität
- 6.4.3 Störungen in der serialen Entwicklung
- 6.5 Die normale Sprachentwicklung
- 6.5.1 Einführung
- 6.5.2 Sprachaufbau und Sprachablauf nach Catherine Krimm-von Fischer
- 6.5.3 Störungen der Sprachentwicklung
- 6.1 Entwicklungspsychologische Grundlagen nach Piaget
- 7 Modifizierte heilpädagogische Entwicklungsförderung
- 7.1 Begründung der Methodenauswahl
- 7.2 Zieldefinition
- 7.3 Ziel-Änderungen im Verlauf der Förderung
- 8 Behandlungsverlauf
- 8.1 Äußere Rahmenbedingungen
- 8.2 Die Beziehung
- 8.3 Schwerpunkte im Verlauf der HPE
- 8.3.1 Einleitung
- 8.3.2 Förderung von Bernds Rollenspiels
- 8.3.3 Förderung des Perspektivenwechsels und Förderung der Serialität anhand von Bilderbüchern, Spielen und des Einsatzes von Rhythmikmaterial
- 8.3.4 Abschied
- 8.3.5 Situation am Ende
- 9 Bezugspersonen, abschließende Vereinbarungen, Kontakte zu anderen Fachdisziplinen
- 9.1 Zusammenarbeit mit der Logopädin
- 9.2 Zusammenarbeit mit den Eltern
- 10 Fachliches Fazit
- 10.1 Einleitung
- 10.2 Die Rahmenbedingungen
- 10.3 Die Serialitätsstörung
- 10.4 Elternarbeit
- 11 Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die modifizierte heilpädagogische Entwicklungsförderung eines fünfjährigen Jungen mit Entwicklungsverzögerungen, serialen Wahrnehmungsstörungen und einer Sprachentwicklungsstörung. Ziel ist es, den Förderprozess zu dokumentieren und die angewandten Methoden zu reflektieren.
- Heilpädagogische Förderung bei Entwicklungsverzögerungen
- Seriale Wahrnehmungsstörungen und deren Auswirkungen
- Sprachentwicklungsförderung bei Kindern
- Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Fachkräften
- Entwicklungspsychologische Grundlagen und deren Anwendung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Anstoß für die Arbeit: die Beobachtung eines Kindes (Bernd) mit schwankenden Sprachniveaus und Entwicklungsrückständen im Kindergarten. Es wird die Bedeutung von Sprache für die Entwicklung und die Auswirkungen von Sprachentwicklungsstörungen thematisiert. Die Autorin begründet ihre Wahl des Themas und erklärt, warum sie neben der Sprachentwicklung auch die Wahrnehmung und die Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren untersucht.
2 Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Arbeit: einen katholischen Kindergarten im Ortenaukreis mit seinem pädagogischen Konzept, das auf dem situationsorientierten Ansatz beruht. Es werden die Struktur des Kindergartens, das Team und die verschiedenen pädagogischen Ansätze und Angebote erläutert. Besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit der Autorin und dem Kindergartenpersonal.
3 Vorstellung des Kindes: Hier wird Bernd, der fünfjährige Junge, vorgestellt. Der Steckbrief liefert grundlegende Informationen. Sein Verhalten im Kindergarten, seine Kommunikation und der Anlass für die heilpädagogische Förderung werden detailliert dargestellt. Dieses Kapitel legt die Basis für die spätere Diagnostik und die Entwicklung der Fördermaßnahmen.
4 Diagnostik: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der verschiedenen diagnostischen Verfahren, die bei Bernd angewendet wurden. Es werden Beobachtungen des Spiel- und Sozialverhaltens, die Sprachentwicklung, die Grob- und Feinmotorik, die Raumlagewahrnehmung, die kognitiven Fähigkeiten sowie die Aufmerksamkeit und Leistungsmotivation analysiert. Die Ergebnisse aus einer Frühförderstelle werden ebenfalls einbezogen, um ein umfassendes Bild von Bernds Entwicklung zu erhalten. Der Fokus liegt auf der systematischen Erfassung seiner Stärken und Schwächen.
5 Hypothesen: Basierend auf den diagnostischen Ergebnissen werden Hypothesen aufgestellt, welche die Entwicklungsverzögerungen und die Schwierigkeiten Bernds erklären sollen. Diese Hypothesen beziehen sich auf seine Intermodalitätsstufe, sein Sprach- und Sozialverhalten sowie seinen Erziehungsstil und sein Bindungsverhalten. Diese Hypothesen leiten die weitere Auseinandersetzung mit theoretischen Erklärungsmodellen.
6 Theoretische Erklärungsmodelle: Dieses Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen für das Verständnis der bei Bernd beobachteten Entwicklungsstörungen. Es werden Entwicklungspsychologische Grundlagen nach Piaget, Entwicklungsverzögerungen, Erziehungsstile und Bindungsverhalten, sowie die normale und gestörte Sprachentwicklung und die Wahrnehmung, speziell die serielle Wahrnehmung, erörtert. Die ausgewählten Theorien dienen als Grundlage für die Interpretation der bei Bernd beobachteten Phänomene und die Planung der heilpädagogischen Maßnahmen.
7 Modifizierte heilpädagogische Entwicklungsförderung: Hier werden die gewählten Methoden der heilpädagogischen Förderung begründet und die Ziele der Förderung definiert. Die Autorin erklärt, warum sie sich für diese spezifischen Methoden entschieden hat und wie sie an die individuellen Bedürfnisse Bernds angepasst wurden. Zusätzlich werden mögliche Anpassungen der Ziele im Verlauf der Förderung thematisiert.
8 Behandlungsverlauf: Das Kapitel beschreibt den konkreten Verlauf der heilpädagogischen Förderung. Es werden die äußeren Rahmenbedingungen, die Beziehung zwischen der Autorin und Bernd, sowie die Schwerpunkte der Förderung im Detail dargestellt. Es werden Beispiele für die Förderung des Rollenspiels, des Perspektivenwechsels und der Serialität gegeben. Der Abschied und die Situation am Ende der Förderung werden ebenfalls beschrieben, um den gesamten Prozess nachvollziehbar zu machen.
9 Bezugspersonen, abschließende Vereinbarungen, Kontakte zu anderen Fachdisziplinen: Dieses Kapitel beleuchtet die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften, insbesondere mit der Logopädin und den Eltern Bernds. Es wird erläutert, wie die Kommunikation und der Informationsaustausch gestaltet wurden, um eine ganzheitliche und koordinierte Förderung zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Heilpädagogik, Entwicklungsverzögerung, serielle Wahrnehmungsstörung, Sprachentwicklungsstörung, Fördermaßnahmen, Entwicklungspsychologie (Piaget), Elternarbeit, Interprofessionalität, Kindergarten, Fallstudie, Behandlungsverlauf.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Modifizierte heilpädagogische Entwicklungsförderung eines fünfjährigen Jungen
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit dokumentiert und reflektiert die modifizierte heilpädagogische Entwicklungsförderung eines fünfjährigen Jungen (Bernd) mit Entwicklungsverzögerungen, serialen Wahrnehmungsstörungen und einer Sprachentwicklungsstörung. Sie untersucht den Förderprozess und die angewandten Methoden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf heilpädagogische Förderung bei Entwicklungsverzögerungen, serielle Wahrnehmungsstörungen und deren Auswirkungen, Sprachentwicklungsförderung, Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Fachkräften, sowie die Anwendung entwicklungspsychologischer Grundlagen (Piaget) in der Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Rahmenbedingungen (Kindergartenkonzept und Zusammenarbeit), Vorstellung des Kindes (Steckbrief, Verhalten, Behandlungsanlass), Diagnostik (Spielbeobachtung, Verhaltensbeobachtung, Sprache, Motorik, Wahrnehmung, Kognition), Hypothesen (Intermodalität, Sprache, Sozialverhalten, Erziehungsstil, Bindung), Theoretische Erklärungsmodelle (Piaget, Entwicklungsverzögerungen, Erziehungsstil, Bindung, Wahrnehmung, Sprachentwicklung), Modifizierte heilpädagogische Entwicklungsförderung (Methoden, Ziele), Behandlungsverlauf (Rahmenbedingungen, Beziehung, Schwerpunkte der Förderung), Bezugspersonen und Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen, Fachliches und Persönliches Fazit.
Welche diagnostischen Verfahren wurden eingesetzt?
Es wurden Spielbeobachtung, Verhaltensbeobachtung, Sprachdiagnostik, Tests zur Grob- und Feinmotorik, zur Raumlagewahrnehmung, zur Kognition, zur Aufmerksamkeit und Leistungsmotivation eingesetzt. Zusätzlich wurden Ergebnisse einer Frühförderstelle einbezogen.
Welche theoretischen Modelle werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Entwicklungspsychologie nach Piaget, Theorien zu Entwicklungsverzögerungen, Erziehungsstilen und Bindungsverhalten, sowie Modelle der normalen und gestörten Sprachentwicklung und Wahrnehmung (insbesondere serielle Wahrnehmung).
Welche Methoden der heilpädagogischen Förderung wurden angewendet?
Die Facharbeit beschreibt die angewandten Methoden detailliert und begründet die Methodenauswahl. Es werden Beispiele zur Förderung des Rollenspiels, des Perspektivenwechsels und der Serialität anhand von Bilderbüchern, Spielen und Rhythmikmaterial gegeben. Die konkreten Methoden werden im Kapitel "Modifizierte heilpädagogische Entwicklungsförderung" und "Behandlungsverlauf" erläutert.
Wie wurde mit Eltern und anderen Fachkräften zusammengearbeitet?
Die Arbeit beschreibt die Zusammenarbeit mit der Logopädin und den Eltern des Kindes. Es wird der Informationsaustausch und die Koordination der Maßnahmen dargestellt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht sowohl ein fachliches als auch ein persönliches Fazit. Das fachliche Fazit fasst die Ergebnisse zusammen, beleuchtet die Rahmenbedingungen, die serielle Wahrnehmungsstörung und die Elternarbeit. Das persönliche Fazit reflektiert die Erfahrungen der Autorin.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Heilpädagogik, Entwicklungsverzögerung, serielle Wahrnehmungsstörung, Sprachentwicklungsstörung, Fördermaßnahmen, Entwicklungspsychologie (Piaget), Elternarbeit, Interprofessionalität, Kindergarten, Fallstudie, Behandlungsverlauf.
Wo finde ich detaillierte Informationen zum Behandlungsverlauf?
Der Behandlungsverlauf wird im Kapitel 8 ausführlich beschrieben, inklusive äußerer Rahmenbedingungen, der Beziehung zwischen Therapeutin und Kind und den Schwerpunkten der Förderung (Rollenspiel, Perspektivenwechsel, Serialität).
- Quote paper
- Diana Saft (Author), 2008, Modifzierte heilpädagogische Entwicklungsförderung. Ein 5 jähriger entwicklungsverzögerter Junge mit serialen Wahrnehmungsstörungen und einer Sprachenwicklungsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142475