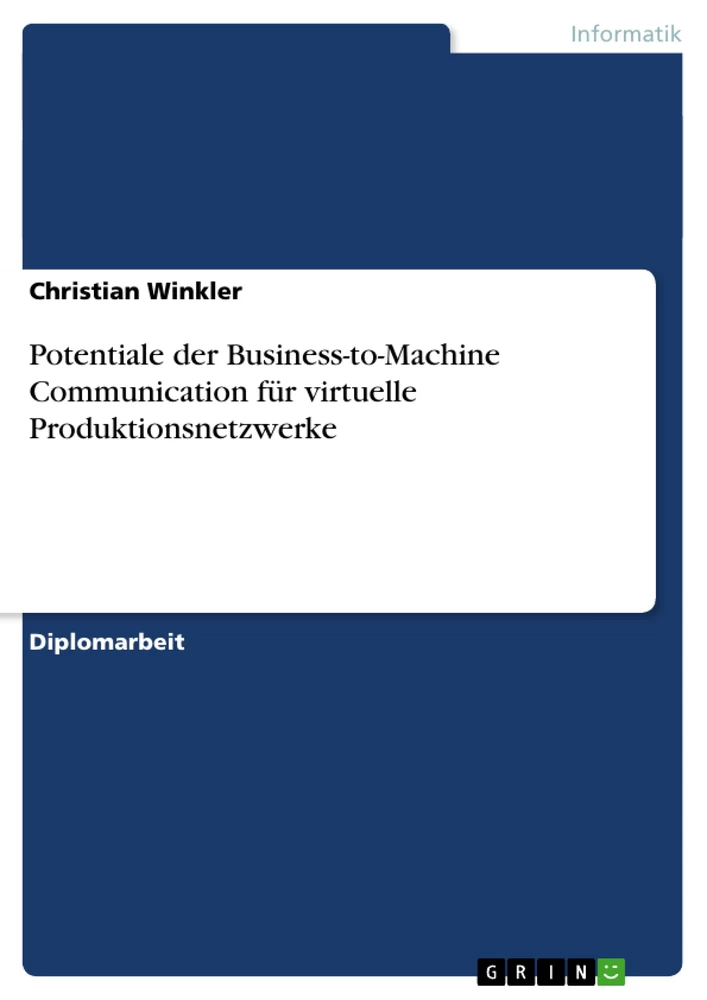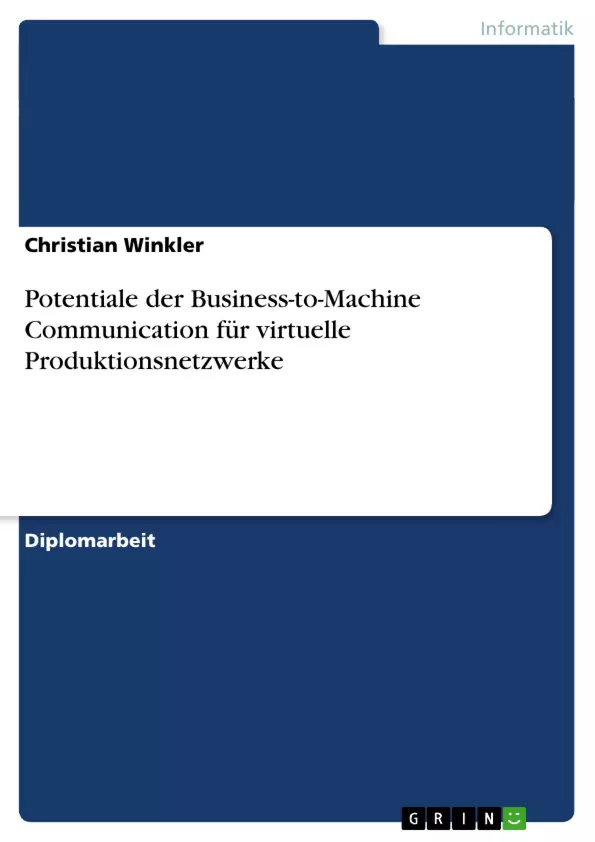Im Hinblick auf die Beeinflussung durch neue Technologien und Entwicklungen gilt die Produktion üblicherweise als der am stärksten betroffene Bereich eines Unternehmens. Ein Umstand der nicht zuletzt daran deutlich wird, dass die Verwendung informationstechnischer Verfahren zur Unterstützung der Abläufe in der Produktion weitaus früher praktiziert wurde, als dies im Bürobereich bzw. auf der Unternehmensebene der Fall war. Die industrielle Fertigung lässt sich in diesem Zusammenhang gewissermaßen als „Vorreiter“ bei der Nutzung von IuK-Systemen im betrieblichen Umfeld verstehen.
Das Aufkommen sowie die zunehmende Verbreitung internetbasierter Technologien respektive eine damit verbundene umfassende Verwendung in den entsprechenden Funktionsbereichen der Unternehmen ist unter diesen Gesichtspunkten von einer eher gegenläufigen Entwicklung gekennzeichnet, da sich die betrachteten Technologien zunächst auf der Unternehmensebene, etwa im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs oder der Bürokommunikation, etabliert haben. Dagegen ist ein möglicher Einsatz im Bereich der industriellen Produktion, beispielsweise in Hinsicht auf die Steuerung und Vernetzung von Automatisierungssystemen, erstmals in jüngster Zeit zum Gegenstand konkreter Überlegungen geworden.
Eine zunehmende Ausweitung internetbasierter Technologien und Standards auf den Fertigungsbereich ermöglicht eine vertikale Integration als Ausdruck einer neu entstehenden elektronischen Verbindung zwischen den Prozessen und technischen Anlagen der Fertigungsebene auf der einen Seite und der Unternehmensebene auf der anderen Seite. Die wirtschaftliche Nutzung dieser informationstechnischen Verbindung wird als Business-to-Machine Communication bezeichnet und führt zu einer Reihe von Erweiterungen oder neuen Anwendungen des E-Business. Gerade diese neuartigen, jedoch zum weit überwiegenden Teil noch wenig entwickelten, Anwendungsmöglichkeiten sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit mit dem Ziel, denkbare Potentiale und Verwendungen im Hinblick auf virtuelle Produktionsnetzwerke darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Business-to-Machine-Communication
- Das Ebenenmodell der Produktion
- Vertikale Integration der Informationsebenen
- Anwendungsfelder
- Virtuelle Produktionsnetzwerke als Form der interorganisatorischen Leistungserstellung
- Ausgangspunkt und Zielsetzung
- Erscheinungsform und Bestandteile
- Hybride Organisationsstrukturen
- Lebenszyklus eines aktivierten Netzwerkes
- Kern- und Kooperationskompetenz als zentrale Elemente
- Aufgaben und Akteure in virtuellen Organisationen
- Anwendungsszenarien der Business-to-Machine Communication in virtuellen Produktionsnetzwerken
- Koordination
- Anbahnungs- und Konfigurationsphase
- Betriebsphase
- Auflösungsphase
- Leistungsgestaltung
- Neue Produkte und Dienstleistungen
- Kundennähe
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Potentialen der Business-to-Machine Communication (BtM-C) für virtuelle Produktionsnetzwerke. Der Fokus liegt auf der Analyse der Einsatzmöglichkeiten von BtM-C zur Optimierung von Koordinations- und Leistungsgestaltungsprozessen in diesen Netzwerken.
- Ebenenmodell der Produktion und vertikale Integration
- Charakteristika und Lebenszyklus virtueller Produktionsnetzwerke
- Anwendungsfelder von BtM-C in der Koordinations- und Leistungsgestaltung
- Potenziale von BtM-C für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen
- Herausforderungen und Chancen von BtM-C in virtuellen Produktionsnetzwerken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Anschließend wird das Konzept der Business-to-Machine Communication im Detail behandelt, wobei das Ebenenmodell der Produktion und die vertikale Integration von Informationsebenen im Mittelpunkt stehen. Im dritten Kapitel werden virtuelle Produktionsnetzwerke als Form der interorganisatorischen Leistungserstellung vorgestellt, wobei deren Entstehung, Struktur, Lebenszyklus und zentrale Elemente beleuchtet werden.
Das vierte Kapitel widmet sich konkreten Anwendungsszenarien von BtM-C in virtuellen Produktionsnetzwerken. Hier werden die Einsatzmöglichkeiten von BtM-C in der Koordinations- und Leistungsgestaltung, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, untersucht. Das fünfte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen.
Schlüsselwörter
Business-to-Machine Communication, Virtuelle Produktionsnetzwerke, Interorganisatorische Leistungserstellung, Koordinations- und Leistungsgestaltung, Neue Produkte und Dienstleistungen, Kundennähe, Digitale Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Business-to-Machine Communication (BtM-C)?
BtM-C bezeichnet die elektronische Verbindung und den Datenaustausch zwischen technischen Anlagen der Fertigungsebene und der Unternehmensebene (E-Business), was eine vertikale Integration der Prozesse ermöglicht.
Welche Potenziale bietet BtM-C für virtuelle Produktionsnetzwerke?
Es ermöglicht eine effizientere Koordination in allen Phasen des Netzwerk-Lebenszyklus (Anbahnung, Betrieb, Auflösung) sowie die Gestaltung völlig neuer kundennaher Produkte und Dienstleistungen.
Wie funktioniert die vertikale Integration in der Produktion?
Informationen fließen direkt von den Maschinen in die Management-Systeme (ERP) und umgekehrt. Dies bricht die traditionelle Trennung zwischen Werkstatt und Büro auf.
Was sind die Merkmale eines virtuellen Produktionsnetzwerkes?
Es handelt sich um hybride Organisationsstrukturen, bei denen rechtlich selbstständige Unternehmen kooperieren, um gemeinsam Leistungen zu erbringen, wobei Kern- und Kooperationskompetenzen zentral sind.
Welche Anwendungsszenarien gibt es für BtM-C?
Szenarien umfassen die automatisierte Konfiguration von Produktionsressourcen, Fernwartung, Echtzeit-Monitoring der Fertigung und die Entwicklung datenbasierter Zusatzdienste für Kunden.
Wie beeinflusst BtM-C die Leistungsgestaltung?
Durch die Vernetzung können Produkte individueller gestaltet werden und Unternehmen können Dienstleistungen anbieten, die direkt auf den Maschinendaten basieren, was die Kundennähe erhöht.
- Citation du texte
- Christian Winkler (Auteur), 2003, Potentiale der Business-to-Machine Communication für virtuelle Produktionsnetzwerke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14247