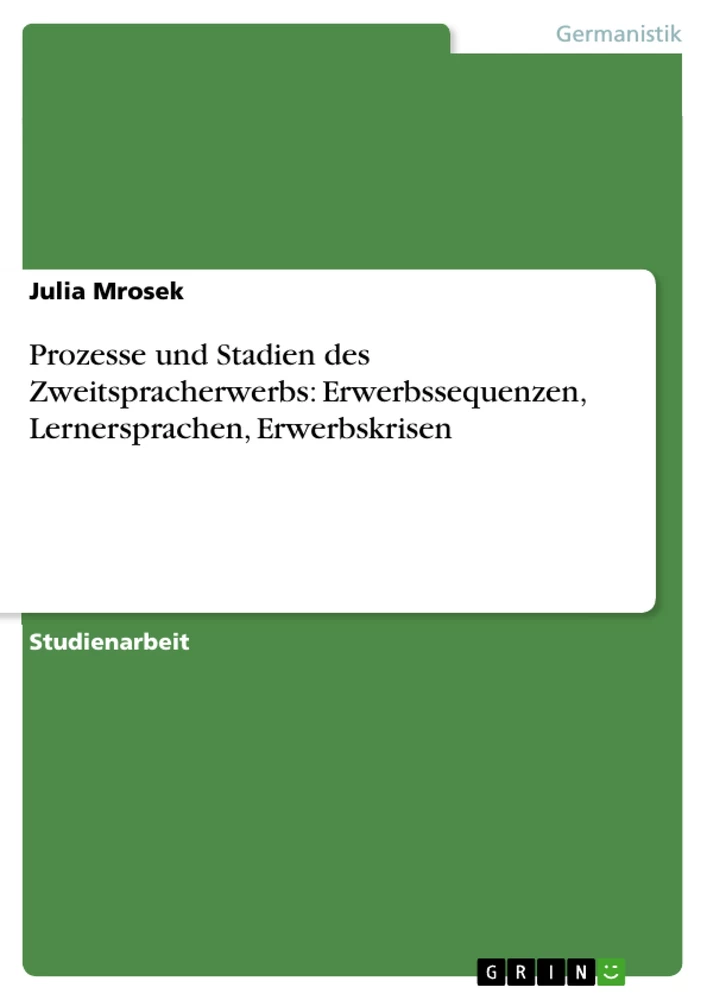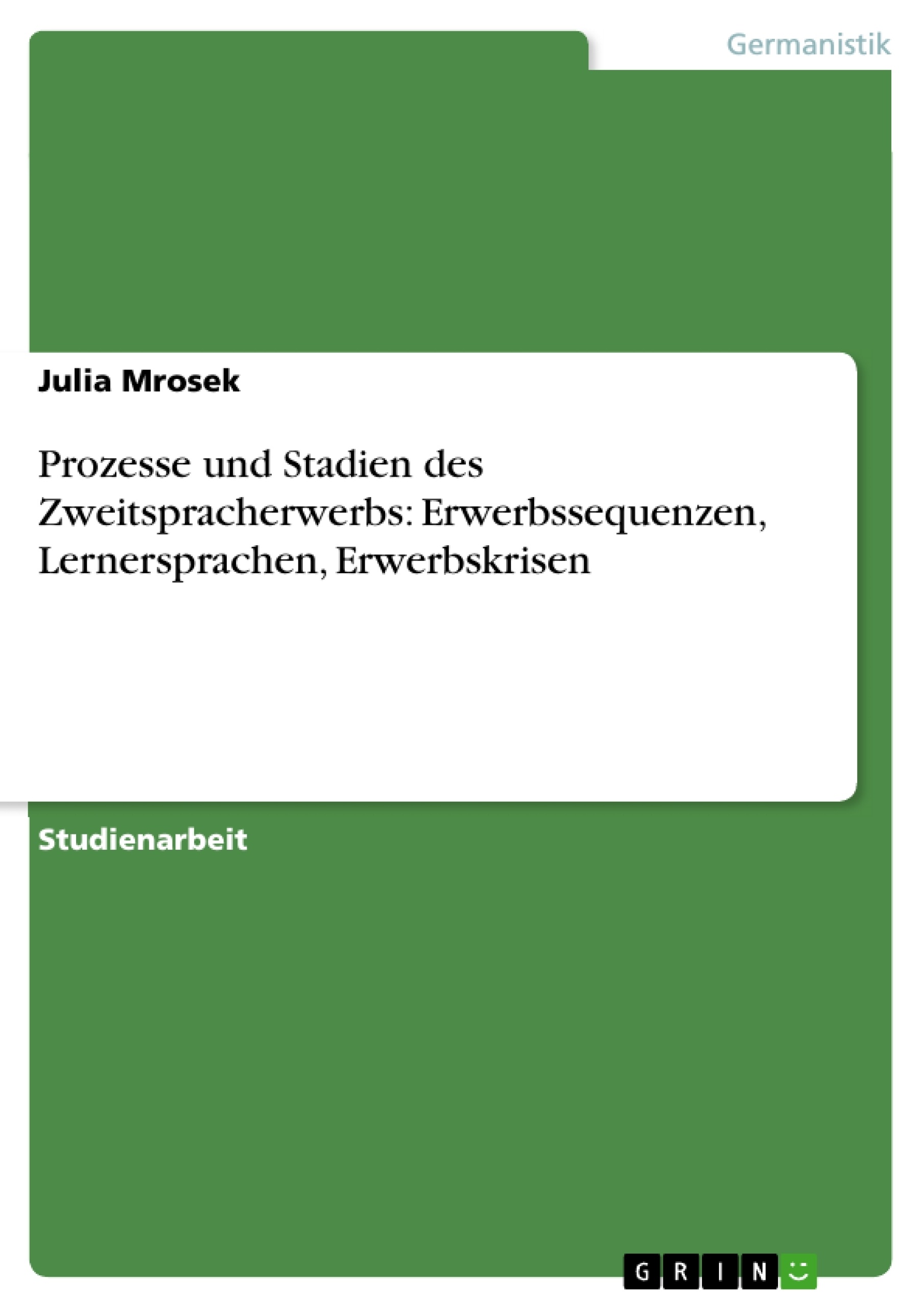Zahlen zeigen auf, dass eine Auseinandersetzung mit dem Themengebiet Deutsch als Zweitsprache etwa für angehende Lehrerinnen und Lehrer etwa unerlässlich ist: In Deutschland alleine leben mehr als neun Millionen Bürger, die die deutsche Sprache als Zweitsprache nutzen, von denen 1,4 Millionen an den hiesigen Schulen unterrichtet werden.
Was die Bezeichnung Deutsch als Zweitsprache wie der Begriff fachwissenschaftlich definiert ist, werde ich in einem ersten Kapitel zeigen.
Der Hauptteil richtet sich auf die Fragen: „Wie geht der Aneignungsprozess einer Zweitsprache vor sich?“, und „Gibt es bestimmte Merkmale des Erwerbprozesses?“, und „Welche Probleme treten dabei auf?“ Seit den 1970er Jahren, in denen besonders in Deutschland der Zweitspracherwerb als Phänomen gut zu beobachten war, ist die Forschung genau diesen Fragen nachgegangen. Besonders für Lehrer, die in der heutigen Zeit darauf vorbereitet sein sollten, zweisprachig aufwachsende Kinder in ihrem Unterricht aufzunehmen, zeigen sich die Ergebnisse der Forschung als wichtige Wissenserweiterung oder Voraussetzung.
Besonders wichtig hierfür ist auch das Wissen um Erwerbskrisen im Sprachlernvorgang, welche im letzten Abschnitt behandelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Terminologie - Deutsch als Zweitsprache
- Allgemeine Merkmale von Lernersprachen
- Entwicklungssequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess des Zweitspracherwerbs, insbesondere im Kontext des Erwerbs der deutschen Sprache als Zweitsprache. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Merkmale dieses Prozesses und befasst sich mit der Frage, wie dieser Prozess verläuft und welche Schwierigkeiten auftreten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Verständnis von "Erwerbskrisen".
- Definition und Abgrenzung von Deutsch als Zweitsprache
- Charakteristische Merkmale von Lernersprachen
- Entwicklungssequenzen im Zweitspracherwerb
- Die Rolle von Kontext und Lerneralter
- Das Auftreten von Erwerbskrisen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Deutsch als Zweitsprache ein und verdeutlicht die Relevanz des Themas im deutschen Kontext, indem sie auf die hohe Anzahl von Menschen verweist, die Deutsch als Zweitsprache sprechen. Sie skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit, die sich mit dem Prozess des Zweitspracherwerbs, seinen Merkmalen und Schwierigkeiten befassen. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Forschungsergebnisse für Lehrer hervor, die zweisprachig aufwachsende Kinder unterrichten.
Zur Terminologie - Deutsch als Zweitsprache: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von "Deutsch als Zweitsprache" im Vergleich zu "Deutsch als Muttersprache" und "Deutsch als Fremdsprache". Es wird zwischen primärer und sekundärer Zweitsprache unterschieden, abhängig vom Lerneralter und Lernkontext. Der Fokus liegt auf dem ungesteuerten, außerschulischen Spracherwerb, beispielsweise bei Migrantenkindern, die Deutsch durch soziale Interaktion erwerben. Der Vergleich mit dem Erstspracherwerb bei Kindern wird angesprochen, wobei auf Unterschiede beim Erwerb durch ältere Lerner hingewiesen wird.
Allgemeine Merkmale von Lernersprachen: Dieses Kapitel beschreibt allgemeine Merkmale von Lernersprachen. Es zeigt, wie sich die Sprachfähigkeit von Lernenden kontinuierlich verbessert, wobei anfängliche Unsicherheiten und Fehler wie falsche Verwendung von Funktionswörtern oder Übergeneralisierungen auftreten. Es werden auch die Phänomene von Fossilierungen angesprochen, die durch fehlende Rückmeldung oder Affekte entstehen können. Der wellenförmige Verlauf der Sprachentwicklung wird erwähnt.
Entwicklungssequenzen: Dieses Kapitel vergleicht den Erwerb der Erst- und Zweitsprache und stellt fest, dass es ähnliche Entwicklungssequenzen gibt. Es betont jedoch die großen individuellen Unterschiede im Erwerbsprozess aufgrund verschiedener Lernvoraussetzungen wie Erstsprache, Lernerfahrungen und Lerntypen. Es wird darauf hingewiesen, dass der vollständige Erwerb der Zweitsprache schwieriger ist als der der Erstsprache, und dass verschiedene Faktoren den Prozess beeinflussen können. Die Komplexität von Lernersprachen und die Einteilung in systematische und nicht-systematische Variabilität werden angeschnitten.
Schlüsselwörter
Deutsch als Zweitsprache, Zweitspracherwerb, Lernersprache, Entwicklungssequenzen, Erwerbskrisen, Bilingualismus, Sprachentwicklung, Lerneralter, Lernkontext, Sprachkompetenz, Fossilierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Deutsch als Zweitsprache"
Was ist der Gegenstand des Textes "Deutsch als Zweitsprache"?
Der Text befasst sich umfassend mit dem Erwerb der deutschen Sprache als Zweitsprache. Er untersucht den Prozess des Zweitspracherwerbs, seine Herausforderungen, Merkmale und Schwierigkeiten, insbesondere das Phänomen von "Erwerbskrisen". Der Text betrachtet verschiedene Aspekte wie die Definition von "Deutsch als Zweitsprache", charakteristische Merkmale von Lernersprachen, Entwicklungssequenzen und den Einfluss von Kontext und Lerneralter.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text deckt folgende Themen ab: Definition und Abgrenzung von Deutsch als Zweitsprache im Vergleich zu Deutsch als Mutter- und Fremdsprache; charakteristische Merkmale von Lernersprachen, inklusive Fossilierungen und Übergeneralisierungen; Entwicklungssequenzen im Zweitspracherwerb und deren Vergleich mit dem Erstspracherwerb; die Rolle von Kontext und Lerneralter; und schließlich das Auftreten von Erwerbskrisen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Zur Terminologie - Deutsch als Zweitsprache, Allgemeine Merkmale von Lernersprachen und Entwicklungssequenzen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema Deutsch als Zweitsprache ein, unterstreicht seine Relevanz im deutschen Kontext und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung der Forschungsergebnisse für Lehrer hervor, die zweisprachig aufwachsende Kinder unterrichten.
Wie wird "Deutsch als Zweitsprache" definiert und abgegrenzt?
Das Kapitel "Zur Terminologie - Deutsch als Zweitsprache" definiert und grenzt den Begriff "Deutsch als Zweitsprache" von "Deutsch als Muttersprache" und "Deutsch als Fremdsprache" ab. Es unterscheidet zwischen primärer und sekundärer Zweitsprache und konzentriert sich auf den ungesteuerten, außerschulischen Spracherwerb, beispielsweise bei Migrantenkindern.
Welche Merkmale von Lernersprachen werden beschrieben?
Das Kapitel "Allgemeine Merkmale von Lernersprachen" beschreibt die kontinuierliche Verbesserung der Sprachfähigkeit von Lernenden, anfängliche Unsicherheiten und Fehler wie die falsche Verwendung von Funktionswörtern oder Übergeneralisierungen. Es behandelt auch das Phänomen der Fossilierung und den wellenförmigen Verlauf der Sprachentwicklung.
Wie werden Entwicklungssequenzen im Zweitspracherwerb dargestellt?
Das Kapitel "Entwicklungssequenzen" vergleicht den Erwerb der Erst- und Zweitsprache, wobei ähnliche Sequenzen festgestellt werden, aber auch große individuelle Unterschiede aufgrund verschiedener Lernvoraussetzungen hervorgehoben werden. Die Komplexität von Lernersprachen und die Einteilung in systematische und nicht-systematische Variabilität werden ebenfalls angesprochen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Deutsch als Zweitsprache, Zweitspracherwerb, Lernersprache, Entwicklungssequenzen, Erwerbskrisen, Bilingualismus, Sprachentwicklung, Lerneralter, Lernkontext, Sprachkompetenz, Fossilierung.
- Quote paper
- Julia Mrosek (Author), 2009, Prozesse und Stadien des Zweitspracherwerbs: Erwerbssequenzen, Lernersprachen, Erwerbskrisen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142434