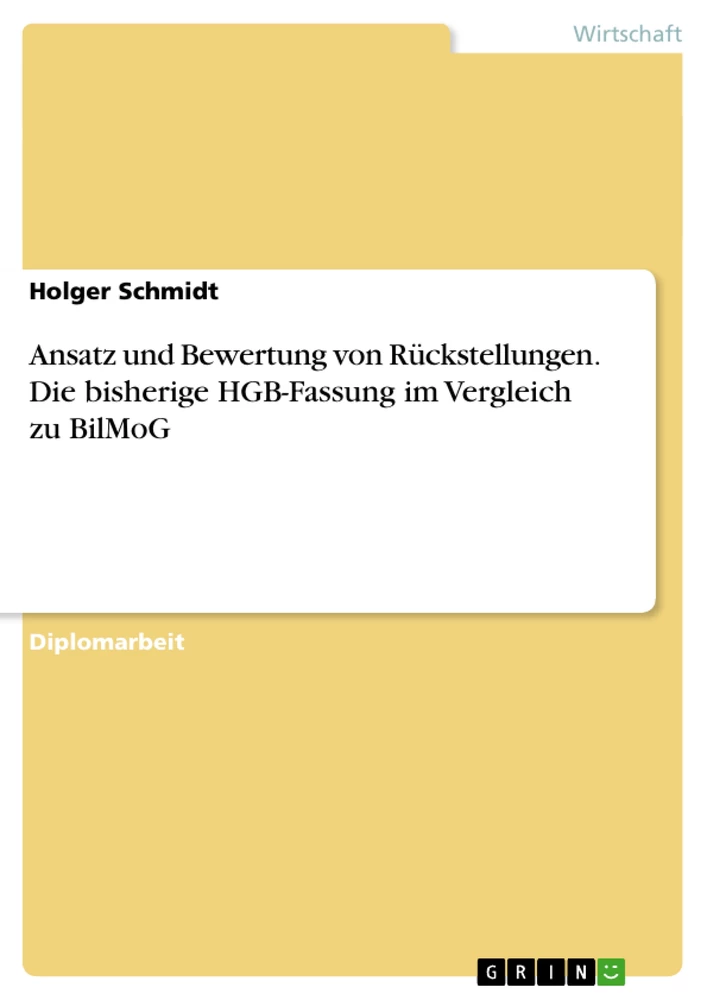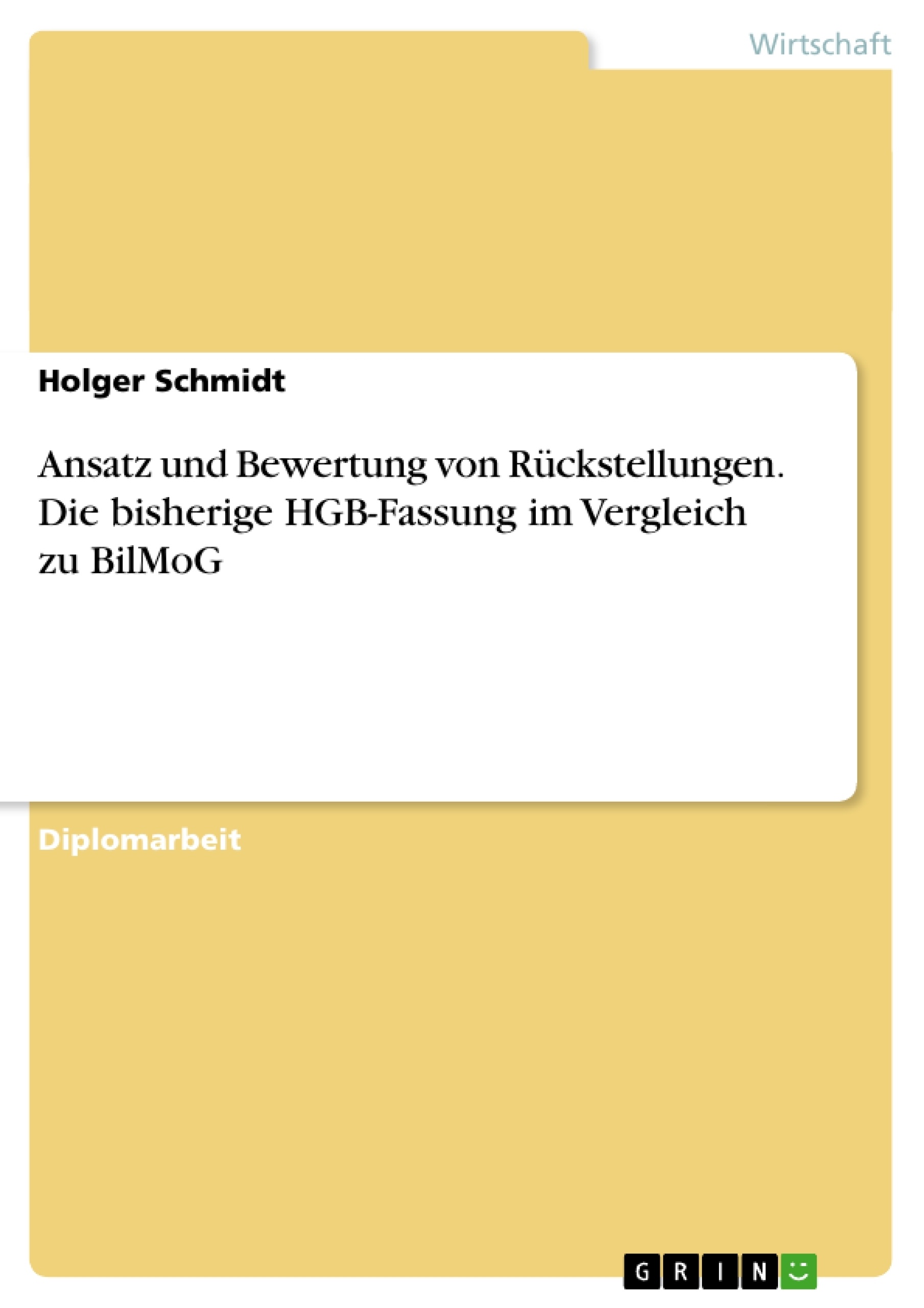Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Rückstellungen nach HGB a.F. bilanziert werden müssen beziehungsweise können und in welcher Höhe dies zu geschehen hat und was für Auswirkungen das BilMoG auf den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen mit sich bringt. Am Ende der Arbeit soll die Frage beantwortet werden können, ob es dem Gesetzgeber gelungen ist, mit den durch das BilMoG verursachten Änderungen im Bereich der Rückstellungen die Informationsfunktion für die Abschlussadressaten zu erhöhen und das deutsche Handelsrecht an die IFRS anzunähern.
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der theoretischen Grundlagen der Rückstellungen. Es wird gezeigt, welche Bilanztheorien entscheidenden Einfluss auf die Prägung des im HGB verwendeten Rückstellungsbegriffs haben und wie sich Rückstellungen zu anderen Posten der Passiva abgrenzen.
Es folgt eine Darstellung, welche Rückstellungen nach HGB Stand 2008 bilanziert werden dürfen beziehungsweise müssen und welche Voraussetzungen für einen Ansatz gegeben sein müssen. Auf die latenten Steuern wird dabei nur in ihren Grundzügen eingegangen, eine Betrachtung des Timing- und Temporary-Konzepts unterbleibt. Auch wird der Frage nachgegangen in welcher Höhe die Bilanzierung zu erfolgen hat.
Im nächsten Teil der Arbeit wird aufgezählt, welche Rückstellungen nach HGB n.F. nicht mehr bilanziert werden dürfen und welche Faktoren zukünftig bei der Bewertung von Rückstellungen zu berücksichtigen sind. Auf eine Betrachtung der Auswirkungen des BilMoG auf die latenten Steuern und den Konzernabschluss bei den Rückstellungen wird indes verzichtet. Bei den Pensionsverpflichtungen wird im Rahmen dieser Arbeit nicht auf Rückdeckungsversicherungen eingegangen.
Im vierten Teil der Arbeit werden die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen theoretischen Grundlagen an praktischen Beispielen verdeutlicht. Dafür werden zuerst Sachverhalte skizziert, um sie nach HGB Stand 2008 und anschließend unter Anwendung des BilMoG darzustellen und die Faktoren, die Ursache für eine Änderung sind, zu erläutern.
Den Abschluss bildet eine Übersicht der wesentlichen Neuerungen des BilMoG bei den Rückstellungen verglichen mit den vorherigen Regelungen. Es wird auf die einzelnen Veränderungen eingegangen und hinterfragt, ob hieraus eine realistischere Beurteilung über künftige Belastungen möglich ist, die eine Steigerung des Informationsgehalts bedeutet und auch das Ziel einer Annäherung an die IFRS gelungen ist.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung
- II. Gang der Untersuchung
- B. Theoretische Grundlagen zu Rückstellungen
- I. Bilanztheoretische Basis
- 1. Statische Bilanztheorie
- 2. Dynamische Bilanztheorie
- II. Abgrenzung der Rückstellungen zu anderen Passivposten
- 1. Rückstellungen zu Verbindlichkeiten
- 2. Rückstellungen zu passiven Rechnungsabgrenzungsposten
- 3. Rückstellungen zu Rücklagen
- 4. Rückstellungen zu Wertberichtigungen
- C. Rückstellungen nach HGB bisherige Fassung
- I. Ansatz von Rückstellungen
- 1. Allgemein
- 2. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- a. Allgemein
- b. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- aa. Unmittelbare Pensionsverpflichtungen
- bb. Mittelbare Pensionsverpflichtungen
- cc. Ähnliche Verpflichtungen
- 3. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- 4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen
- 5. Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Abraumbeseitigung
- 6. Rückstellungen für Gewährleistung
- 7. Genau umschriebene Aufwendungen
- 8. Rückstellungen für latente Steuern
- II. Bewertung von Rückstellungen
- 1. Bewertungsgrundsätze
- 2. Einzelfragen der Bewertung
- a. Bewertung von Sach- und Dienstleistungsverpflichtungen
- b. Einzel- und Sammelrückstellungen
- c. Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen
- d. Abzinsung
- e. Ansammlungsrückstellungen
- 3. Bewertung von Pensionsrückstellungen
- D. Rückstellungen nach dem BilMoG
- I. Ansatz von Rückstellungen
- II. Bewertung von Rückstellungen
- 1. Aufwandsrückstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 3 HGB a.F.
- 2. Sonstige Aufwandsrückstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB a.F.
- 3. Pensionszusagen nach Art. 28 EGHGB.
- III. Übergangsregelungen
- 1. Art. 66 EGHGB
- 2. Art. 67 EGHGB
- E. Praktische Beispiele
- I. Allgemeine Firmeninformation
- II. Beispiele zu den einzelnen Rückstellungsarten
- F. Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
- Ansatz von Rückstellungen nach HGB (alt und neu)
- Bewertung von Rückstellungen nach HGB (alt und neu)
- Unterschiede zwischen HGB und BilMoG bezüglich Rückstellungen
- Praktische Beispiele zur Anwendung der Vorschriften
- Auswirkungen des BilMoG auf die Bilanzierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen im Vergleich zwischen dem Handelsgesetzbuch (HGB) in seiner bisherigen Fassung und dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG). Ziel ist es, die Unterschiede und Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen auf die Praxis aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, stellt die Problemstellung dar und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es legt den Fokus auf den Vergleich des alten und neuen HGB im Kontext von Rückstellungen.
B. Theoretische Grundlagen zu Rückstellungen: Hier werden die bilanztheoretischen Grundlagen erläutert, sowohl die statische als auch die dynamische Bilanztheorie. Der Abschnitt befasst sich eingehend mit der Abgrenzung von Rückstellungen zu anderen Passivposten wie Verbindlichkeiten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten, Rücklagen und Wertberichtigungen. Die Kapitel liefern die notwendigen theoretischen Rahmenbedingungen für die anschließende Analyse der gesetzlichen Regelungen.
C. Rückstellungen nach HGB bisherige Fassung: Dieses Kapitel behandelt ausführlich den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen nach der alten Fassung des HGB. Es werden verschiedene Arten von Rückstellungen detailliert erklärt und anhand von Beispielen verdeutlicht. Die Kapitel untersuchen die Kriterien für den Ansatz von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, unterlassene Instandhaltung etc., und erörtern die jeweiligen Bewertungsgrundsätze, einschließlich der Abzinsung und der Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen. Das Kapitel analysiert die komplexen Regeln der alten Fassung und bereitet den Boden für den Vergleich mit dem BilMoG.
D. Rückstellungen nach dem BilMoG: Dieses Kapitel widmet sich dem Ansatz und der Bewertung von Rückstellungen gemäß dem BilMoG. Es werden die wesentlichen Änderungen im Vergleich zum alten HGB herausgestellt und deren Auswirkungen auf die Praxis diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf den Neuerungen in der Bewertung, insbesondere der Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen und der Abzinsungspflicht. Die Übergangsregelungen werden ebenfalls erläutert. Das Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der neuen gesetzlichen Bestimmungen und vergleicht diese systematisch mit den vorherigen Regelungen.
E. Praktische Beispiele: In diesem Kapitel werden anhand von konkreten Beispielen die praktischen Auswirkungen der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen (HGB alt und neu) auf die Bilanzierung von Rückstellungen verdeutlicht. Die Beispiele betreffen verschiedene Arten von Rückstellungen und zeigen die jeweiligen Berechnungen und Beurteilungen nach beiden Fassungen des HGB. Dieses Kapitel stellt den praktischen Bezug der vorhergehenden theoretischen Ausführungen her und ermöglicht ein besseres Verständnis der komplexen Materie.
Schlüsselwörter
Rückstellungen, HGB, BilMoG, Bilanzierung, Bewertung, Ansatz, ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, Instandhaltung, Gewährleistung, Abzinsung, Preis- und Kostensteigerungen, Pensionsrückstellungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Ansatz und Bewertung von Rückstellungen nach HGB (alt und neu)
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit vergleicht den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen im Handelsgesetzbuch (HGB) vor und nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG). Ziel ist die Darstellung der Unterschiede und Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen auf die Praxis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen nach dem alten und neuen HGB, die Unterschiede zwischen beiden Fassungen, praktische Beispiele zur Anwendung der Vorschriften und die Auswirkungen des BilMoG auf die Bilanzierung. Es werden verschiedene Arten von Rückstellungen detailliert untersucht, einschließlich Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, unterlassene Instandhaltung, Gewährleistung und Pensionsrückstellungen.
Welche theoretischen Grundlagen werden erläutert?
Die Arbeit erläutert die bilanztheoretischen Grundlagen, sowohl die statische als auch die dynamische Bilanztheorie. Sie beschreibt die Abgrenzung von Rückstellungen zu anderen Passivposten wie Verbindlichkeiten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten, Rücklagen und Wertberichtigungen.
Wie werden Rückstellungen nach der alten HGB-Fassung behandelt?
Das Kapitel zum alten HGB beschreibt ausführlich den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen. Es erklärt verschiedene Arten von Rückstellungen und deren Bewertungsgrundsätze, einschließlich Abzinsung und Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen.
Welche Änderungen bringt das BilMoG für die Rückstellungsbilanzierung?
Das Kapitel zum BilMoG zeigt die wesentlichen Änderungen im Vergleich zum alten HGB auf und diskutiert deren Auswirkungen auf die Praxis. Der Schwerpunkt liegt auf Neuerungen in der Bewertung, insbesondere der Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen und der Abzinsungspflicht. Die Übergangsregelungen werden ebenfalls erläutert.
Welche praktischen Beispiele werden vorgestellt?
Die Arbeit enthält konkrete Beispiele, die die Auswirkungen der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen (HGB alt und neu) auf die Bilanzierung von Rückstellungen verdeutlichen. Die Beispiele zeigen Berechnungen und Beurteilungen nach beiden Fassungen des HGB für verschiedene Rückstellungsarten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Rückstellungen, HGB, BilMoG, Bilanzierung, Bewertung, Ansatz, ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, Instandhaltung, Gewährleistung, Abzinsung, Preis- und Kostensteigerungen, Pensionsrückstellungen.
Welche Struktur hat die Arbeit?
Die Arbeit ist strukturiert in Einleitung, theoretische Grundlagen, Rückstellungen nach altem HGB, Rückstellungen nach BilMoG, praktische Beispiele und Zusammenfassung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der Bilanzierung und Rechnungslegung, die sich mit dem Ansatz und der Bewertung von Rückstellungen auseinandersetzen.
Wo finde ich das vollständige HTML-Dokument?
Das vollständige HTML-Dokument mit detailliertem Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Kapitelzusammenfassungen ist oben bereitgestellt.
- Quote paper
- Holger Schmidt (Author), 2009, Ansatz und Bewertung von Rückstellungen. Die bisherige HGB-Fassung im Vergleich zu BilMoG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142252