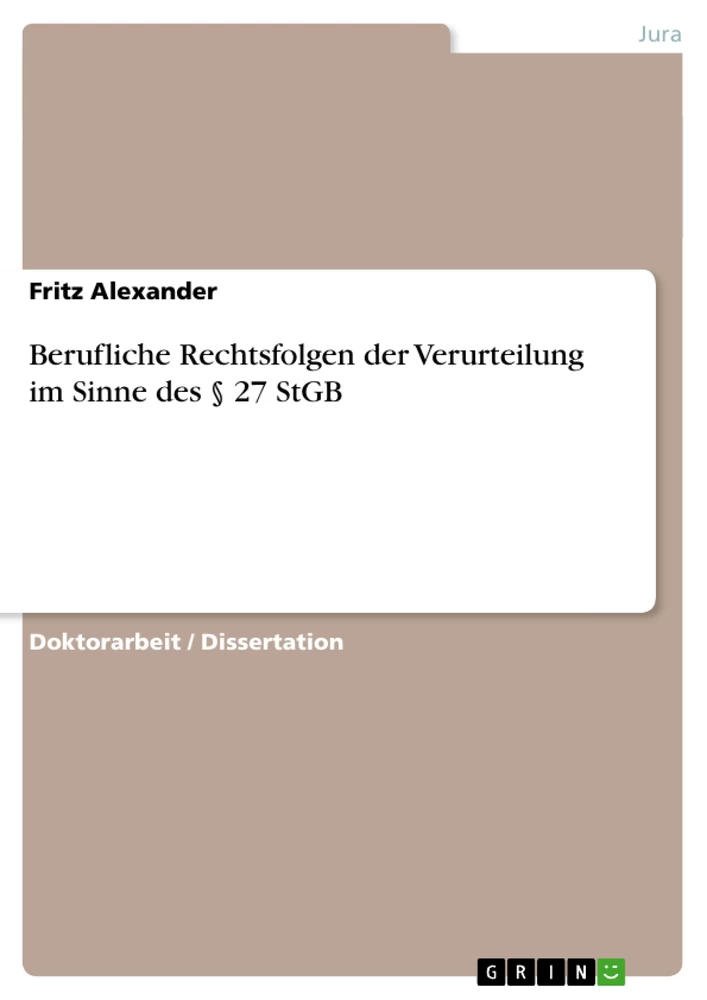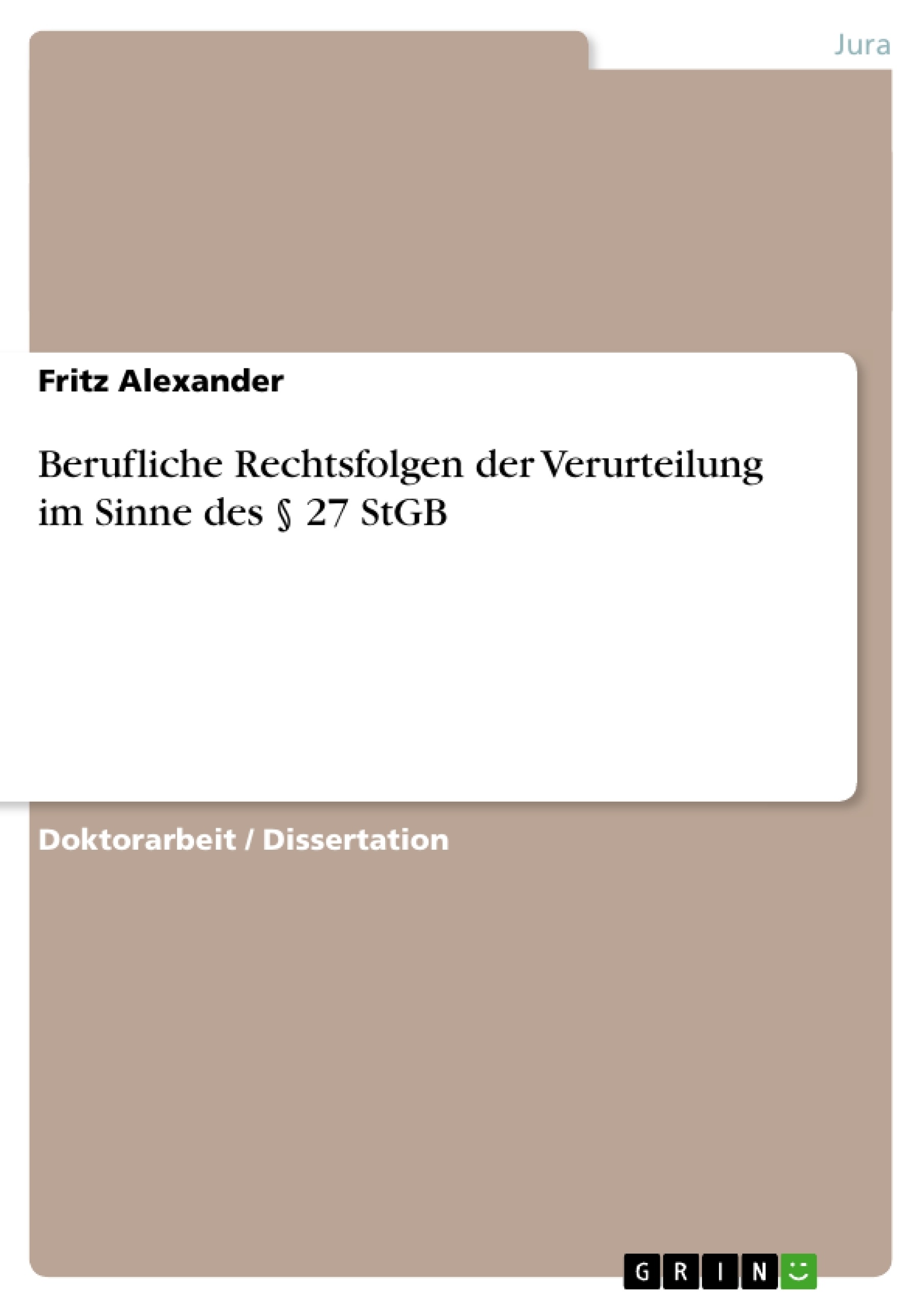Verurteilt ein Strafgericht eine Person wegen einer begangenen Straftat, so verhängt es für gewöhnlich eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Diese und andere Sanktionen, wie etwa auch eine vorbeugende Maßnahme, bemisst das Strafgericht nach einem fairen Verfahren unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens. Es ergeht ein begründetes und durch die höheren Instanzen überprüfbares Urteil. Im Spruch des Urteils wird selbstverständlich die Sanktion ausgesprochen. Die Verfahrensbeteiligten, die Öffentlichkeit sowie der Verurteilte selbst wissen am Ende des Verfahrens daher genau, weshalb die Sanktion erfolgte, und was der Verurteilte nun konkret zu erwarten hat.
Im Rechtsstaat ist zunächst eigentlich schwer vorstellbar, dass Sanktionen einer gerichtlich strafbaren Handlung für bestimmte Täter auch ohne Bemessung und sogar ohne konstitutiven Ausspruch einer Behörde und ohne Begründung eintreten können. So normiert aber zB § 27 Abs 1 StGB unter der Überschrift „Amtsverlust und andere Rechtsfolgen der Verurteilung“ eine Sanktion, wonach kraft Gesetzes mit einer bestimmten Verurteilung der Verlust des Amtes automatisch verbunden ist. „Andere Rechtsfolgen der Verurteilung“ bestimmt im Unterschied zum früheren StG das StGB nicht mehr, es geht aber von deren Existenz aus.
Die Literatur beschreibt diese Rechtsfolgen der Verurteilung kaum und erwähnt nur wenige Beispiele, so als ob diese Rechtsfolgen keine oder nur geringe Bedeutung hätten. Allerdings existieren diese „anderen Rechtsfolgen der Verurteilung“ sehr zahlreich, verstreut in einer Unmenge verschiedenster Materiengesetze. Sie greifen, zB in status- und fremdenrechtliche, sozialrechtliche und berufliche (einschließlich dienst-, disziplinar- und gewerberechtliche) Belange der Verurteilten ein. Besonders die beruflichen Rechtsfolgen können in Härtefällen sogar nachhaltig existenziell bedrohliche Auswirkungen erreichen und die Resozialisierung gefährden, da sie dem Verurteilten seine bisherigen Erwerbsquellen nehmen bzw von künftigen ausschließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Eingrenzung und Definition des Gegenstandes
- 2.1. Der Begriff „Rechtsfolge“
- 2.2. Die Rechtsfolgen der rechtswidrigen Tat
- 2.3. Die Rechtsfolgen mit Strafurteil als Tatbestand
- 2.3.1. Rechtsfolgen der Verurteilung mit Gefährlichkeitsprognose
- 2.3.2. Der Begriff „Rechtsfolge der Verurteilung“ iSd § 27 StGB
- 3. Rechtsfolgen der Verurteilung im Allgemeinen
- 3.1. Die Quellen der Rechtsfolgen
- 3.2. Konsequenz und Zweck des automatischen Eintritts
- 3.3. Welche Verurteilungen sind Tatbestand?
- 3.3.1. Darstellung der rechtsfolgenauslösenden Verurteilungen
- 3.3.2. Exkurs: Strafe bei Zusammentreffen mehrerer Straftaten
- 3.3.3. Kritische Betrachtung der Verurteilungen
- 3.4. Ist die Rechtsfolge Maßnahme oder Strafe?
- 3.5. Die Wirkungsdauer der Rechtsfolgen
- 3.5.1. Beginn der Wirkungsdauer
- 3.5.2. Die Frist
- 3.5.2.1. Subsidiaritätsklausel des § 27 Abs 2 StGB
- 3.5.2.2. Rechtsfolgen der Verurteilung ohne Frist
- 3.5.2.3. Ausdrücklich bestimmte Frist in einzelnen Rechtsfolgenormen
- 3.5.2.4. Erlöschen durch Tilgung
- 3.5.3. Der Beginn des Fristenlaufs
- 3.5.4. Kritik zur Dauer der Rechtsfolgen
- 3.6. Die gerichtliche bedingte Nachsicht der Rechtsfolgen
- 3.7. Der Einfluss der Rechtsfolgen auf die Strafbemessung
- 3.7.1. Die Rechtsfolge und allgemeine Grundsätze der Strafbemessung
- 3.7.2. Die Rechtsfolge als besonderer Milderungsgrund
- 3.7.3. Hinweis auf Rechtsfolgen od. Verschweigung der Anknüpfungspunkte?
- 3.7.4. Nachträgliche Strafmilderung, Neubemessung der Tagessätze
- 3.8. Wie erfährt die zuständige Behörde von der Verurteilung?
- 3.9. Keine Rechtsfolgen nach einer Diversion
- 3.10. Keine Rechtsfolgen für Jugendliche
- 4. Der Amtsverlust gem § 27 Abs 1 StGB
- 4.1. Der Begriff „Beamte“ iSd § 27 Abs 1 StGB
- 4.2. Vom Beamtenbegriff konsumierte Rechtsfolgen
- 4.3. Amtsverlust für bestimmte Beamte iSd § 74 Z 4 StGB
- 4.4. Verurteilung und Strafe als Tatbestand
- 4.5. Die Folgen des Amtsverlustes
- 4.6. Die Beweggründe des Gesetzgebers
- 4.7. Kritik zum Tatbestand des Amtsverlustes
- 4.8. Kritik an der Rechtsfolge des Amtsverlustes
- 4.9. Vergleichender Blick ins deutsche StGB
- 5. Andere Rechtsfolgen mit beruflicher Wirkung
- 5.1. Entziehende Rechtsfolgen
- 5.1.1. Ergänzende Rechtsfolgen zum Amtsverlust
- 5.1.2. Verlust von Berufsberechtigungen
- 5.2. Ausschließende Rechtsfolgen
- 5.2.1. Ausschluss von der Anstellung bei Ämtern
- 5.2.2. Ausschluss von Gewerbeberechtigungen
- 5.3. Kombiniert entziehende und ausschließende Rechtsfolgen
- 5.3.1. Nichtvorliegen der Verlässlichkeit als Berufsvoraussetzung
- 5.3.2. Erlöschen von Kassenverträgen
- 5.4. Unechte Rechtsfolgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die oft vernachlässigten Rechtsfolgen einer Verurteilung im österreichischen Strafrecht systematisch aufzuarbeiten und kritisch zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf den beruflichen Auswirkungen dieser Rechtsfolgen, insbesondere dem Amtsverlust.
- Systematische Darstellung der Rechtsfolgen einer Verurteilung
- Analyse des automatischen Eintritts und der rechtlichen Konsequenzen
- Untersuchung der beruflichen Auswirkungen, insbesondere des Amtsverlustes
- Kritische Auseinandersetzung mit der Problematik der Rechtsfolgen und deren Auswirkungen
- Vergleich mit dem deutschen Strafrecht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rechtsfolgen einer Verurteilung ein und hebt die Diskrepanz zwischen der geringen Beachtung dieser Rechtsfolgen in der Literatur und ihrer tatsächlichen Bedeutung hervor. Sie betont den automatischen Eintritt bestimmter Sanktionen, wie beispielsweise den Amtsverlust gemäß § 27 Abs 1 StGB, und die weitreichenden, potenziell existenzbedrohlichen Folgen für Betroffene, besonders im beruflichen Bereich. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Rechtsfolgen systematisch zu analysieren und deren Problematik kritisch zu beleuchten.
2. Eingrenzung und Definition des Gegenstandes: Dieses Kapitel präzisiert den Begriff „Rechtsfolge“ und grenzt ihn von anderen Sanktionen ab. Es konzentriert sich auf die Rechtsfolgen, die mit einem Strafurteil verbunden sind, wobei insbesondere die Rechtsfolgen der Verurteilung im Sinne des § 27 StGB im Mittelpunkt stehen. Die Kapitel unterteilen den Gegenstand weiter, unterscheiden Rechtsfolgen mit und ohne Strafurteil und präzisieren die Definition von „Rechtsfolge der Verurteilung“.
3. Rechtsfolgen der Verurteilung im Allgemeinen: Dieser Abschnitt untersucht die Quellen, den Zweck und die Konsequenzen des automatischen Eintritts der Rechtsfolgen. Es wird analysiert, welche Arten von Verurteilungen Rechtsfolgen auslösen und ob diese als Strafe oder Maßnahme zu qualifizieren sind. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dauer der Wirkungsdauer, dem Beginn des Fristenlaufs, der Möglichkeit der gerichtlichen bedingten Nachsicht und dem Einfluss auf die Strafbemessung. Das Kapitel beleuchtet auch den Nichteintritt der Rechtsfolgen bei Diversion und bei jugendlichen Tätern.
4. Der Amtsverlust gem § 27 Abs 1 StGB: Dieses Kapitel widmet sich ausführlich dem Amtsverlust als einer im StGB geregelten Rechtsfolge. Es definiert den Begriff „Beamte“ im Kontext des § 27 Abs 1 StGB, untersucht die Folgen des Amtsverlustes und beleuchtet die Beweggründe des Gesetzgebers. Der Abschnitt beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Tatbestand und der Rechtsfolge des Amtsverlustes sowie einen Vergleich mit dem deutschen Strafrecht.
5. Andere Rechtsfolgen mit beruflicher Wirkung: Dieser Abschnitt befasst sich mit verschiedenen Rechtsfolgen, die berufliche Auswirkungen haben, wie entziehende und ausschließende Rechtsfolgen, sowie unechte Rechtsfolgen. Es werden zahlreiche Beispiele aus unterschiedlichen Berufsfeldern angeführt und detailliert erklärt, unter anderem bezüglich Vertragsbediensteten, Berufsberechtigungen (z.B. Notare, Patentanwälte), Gewerbeanmeldungen und Kassenverträgen.
Schlüsselwörter
Rechtsfolgen der Verurteilung, § 27 StGB, Amtsverlust, berufliche Rechtsfolgen, Strafrecht, Österreich, automatischer Eintritt, Strafbemessung, Diversion, Jugendliche, entziehende Rechtsfolgen, ausschließende Rechtsfolgen, kritische Analyse, Vergleich Deutsches Strafrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Rechtsfolgen der Verurteilung im österreichischen Strafrecht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert systematisch und kritisch die Rechtsfolgen einer Verurteilung im österreichischen Strafrecht, insbesondere deren Auswirkungen auf den beruflichen Bereich. Der Fokus liegt auf dem automatischen Eintritt bestimmter Sanktionen und dem Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 StGB.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Darstellung der Rechtsfolgen der Verurteilung, einschließlich ihrer Definition, Quellen, Zweck und Konsequenzen. Es werden verschiedene Arten von Verurteilungen und deren Auswirkungen untersucht, die Dauer der Rechtsfolgen, der Einfluss auf die Strafbemessung und der Vergleich mit dem deutschen Strafrecht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Amtsverlust (§ 27 Abs. 1 StGB) und anderen beruflichen Rechtsfolgen wie entziehende und ausschließende Rechtsfolgen.
Was versteht man unter "Rechtsfolge der Verurteilung"?
Die Arbeit präzisiert den Begriff "Rechtsfolge der Verurteilung" und grenzt ihn von anderen Sanktionen ab. Sie konzentriert sich auf die Rechtsfolgen, die unmittelbar mit einem Strafurteil verbunden sind, und unterscheidet zwischen Rechtsfolgen mit und ohne Strafurteil. Der Begriff "Rechtsfolge der Verurteilung iSd § 27 StGB" wird detailliert erläutert.
Wie wirkt sich eine Verurteilung auf die berufliche Situation aus?
Die Arbeit untersucht die weitreichenden beruflichen Folgen einer Verurteilung, insbesondere den Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 StGB. Sie analysiert entziehende und ausschließende Rechtsfolgen, die zum Verlust von Berufs- oder Gewerbeberechtigungen führen können (z.B. für Beamte, Notare, Patentanwälte etc.). Auch der Einfluss auf Kassenverträge wird beleuchtet.
Welche Rolle spielt der § 27 Abs. 1 StGB?
§ 27 Abs. 1 StGB regelt den Amtsverlust als Rechtsfolge einer Verurteilung. Die Arbeit analysiert diesen Paragraphen detailliert, definiert den Begriff "Beamte" in diesem Kontext, untersucht die Folgen des Amtsverlustes und setzt ihn kritisch in Beziehung zu den Beweggründen des Gesetzgebers und dem deutschen Strafrecht.
Wie lange wirken die Rechtsfolgen?
Die Arbeit analysiert die Wirkungsdauer der Rechtsfolgen, den Beginn des Fristenlaufs und die Möglichkeit der gerichtlichen bedingten Nachsicht. Sie untersucht Fristen, die Subsidiaritätsklausel des § 27 Abs. 2 StGB und das Erlöschen durch Tilgung. Die Kritik an der Dauer der Rechtsfolgen wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rechtsfolgen gibt es bei Jugendlichen und Diversion?
Die Arbeit behandelt explizit den Nichteintritt der Rechtsfolgen bei Diversion (außergerichtliche Erledigung) und bei jugendlichen Tätern.
Wie erfährt die zuständige Behörde von einer Verurteilung?
Dieser Aspekt wird in der Arbeit ebenfalls behandelt und klärt die Informationswege zwischen Gericht und zuständigen Behörden.
Wie wird die Strafbemessung beeinflusst?
Die Arbeit untersucht, wie die Rechtsfolgen die Strafbemessung beeinflussen, indem sie deren Rolle als mögliche Milderungsgrund analysiert und die Frage nach der Offenlegung oder Verschweigung der Anknüpfungspunkte beleuchtet.
Wie unterscheidet sich das österreichische Recht von dem deutschen Recht?
Die Arbeit beinhaltet einen Vergleich des österreichischen Rechts mit dem deutschen Strafrecht im Hinblick auf die behandelten Rechtsfolgen.
- Quote paper
- Fritz Alexander (Author), 2003, Berufliche Rechtsfolgen der Verurteilung im Sinne des § 27 StGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14223