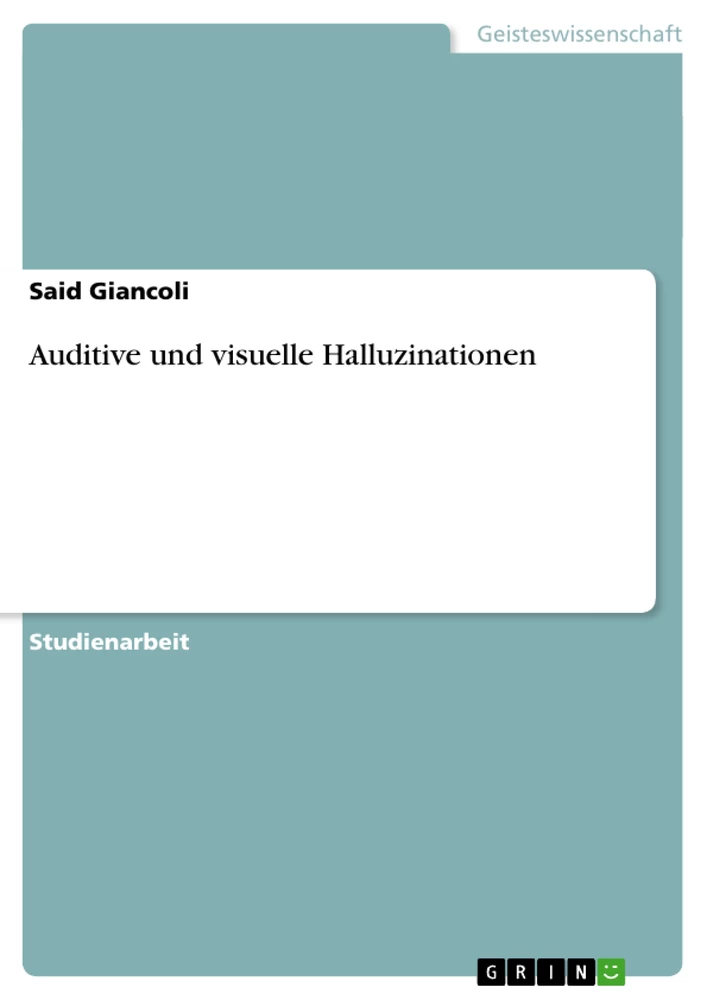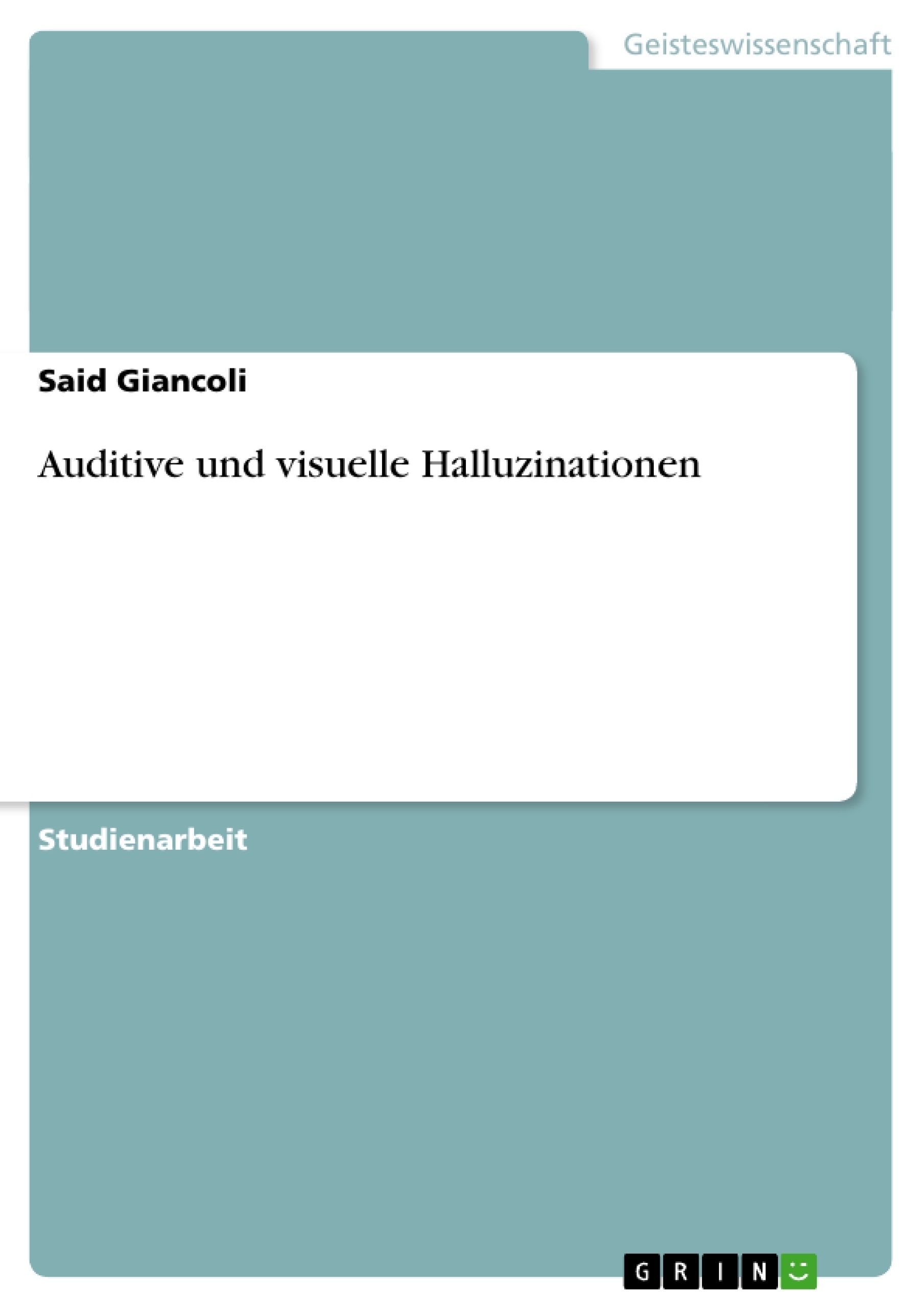In der vorliegenden Arbeit soll zunächst der Begriff der Halluzination näher definiert und von ähnlichen Phänomenen abgegrenzt werden. Die epidemiologische
Betrachtung zeigt, dass auditive Halluzinationen am häufigsten und visuelle Halluzinationen nach Körperhalluzinationen am dritthäufigsten vorkommen. Diese können sowohl aufgrund psychischer und organischer Erkrankungen aller Art
auftreten sowie bei gesunden Menschen u.a. in extremen Lebenssituationen. Zu den zugrunde liegenden Mechanismen werden verschiedene neuropsychologische
und -kognitive Erklärungsmodelle diskutiert. Es scheinen sich dabei insbesondere
Modelle durchgesetzt zu haben, bei denen ein Defizit angenommen wird, welches darin besteht, dass intern generierte Sprache, Gedanken oder Bilder als von außen kommend erlebt werden. Neurophysiologisch wurden auditive Halluzinationen
überwiegend im Zusammenhang mit Schizophrenie und visuelle Halluzinationen vornehmlich beim Charles-Bonnet-Syndrom oder nach Hirnläsionen untersucht.
Dabeizeigt sich, dass diese Halluzinationen tendenziell mit den Hirnarealen zusammenhängen, die für dieVerarbeitung von Informationen des jeweiligen Sinnesgebiets verantwortlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Auditive und visuelle Halluzinationen
- Begriffsbestimmung
- Epidemiologie und Bedingungen
- Neuropsychologische und -kognitive Modelle
- Perceptual-Release Theorie
- Gestörte Diskursplanung
- Theorie des Defizits beim Realitymonitoring
- Theorie des Defizits beim Selbstmonitoring
- Neurophysiologische Befunde
- Befunde zu auditiven Halluzinationen
- Befunde zu visuellen Halluzinationen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, auditive und visuelle Halluzinationen umfassend zu beschreiben und zu erklären. Es werden Definitionen geklärt, epidemiologische Daten vorgestellt und verschiedene neuropsychologische und neurophysiologische Modelle diskutiert.
- Definition und Abgrenzung von Halluzinationen
- Epidemiologie und Auftretensbedingungen von auditiven und visuellen Halluzinationen
- Neuropsychologische Erklärungsmodelle (z.B. Reality- und Selbstmonitoring)
- Neurophysiologische Befunde bei auditiven und visuellen Halluzinationen
- Zusammenhang zwischen Hirnstrukturen und Halluzinationen
Zusammenfassung der Kapitel
Auditive und visuelle Halluzinationen: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den historischen Kontext von Halluzinationen, beginnend mit biblischen und philosophischen Berichten bis hin zu frühen neuroanatomischen Hinweisen. Es wird die Bedeutung neuropsychologischer Theorien und neurophysiologischer Mechanismen hervorgehoben, die durch kortikale Stimulationsstudien von Penfield und Perot (1963) initiiert wurden und die heutige Forschung im Bereich der Schizophrenie (auditiv) und des Charles-Bonnet-Syndroms (visuell) prägen.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Definitionen des Begriffs „Halluzination“ und ordnet ihn in den Kontext anderer Phänomene ein. Es legt den Grundstein für das Verständnis des Phänomens und seiner Abgrenzung von ähnlichen Erscheinungen. Die genaue Definition ist essentiell für die folgenden Kapitel, die sich mit epidemiologischen Daten, neuropsychologischen Modellen und neurophysiologischen Befunden befassen.
Epidemiologie und Bedingungen: Dieser Abschnitt präsentiert epidemiologische Daten zur Häufigkeit von auditiven und visuellen Halluzinationen. Er untersucht die Bedingungen, unter denen diese auftreten, und betrachtet sowohl psychische als auch organische Ursachen sowie das Vorkommen bei gesunden Personen in Extremsituationen. Diese Daten liefern den Kontext für die Erörterung der zugrundeliegenden Mechanismen in den folgenden Kapiteln.
Neuropsychologische und -kognitive Modelle: Dieses Kapitel untersucht verschiedene neuropsychologische und kognitive Modelle, die versuchen, das Phänomen der Halluzinationen zu erklären. Es werden Theorien wie die Perceptual-Release Theorie, Modelle gestörter Diskursplanung, sowie Theorien von Defiziten beim Reality- und Selbstmonitoring detailliert erläutert und kritisch bewertet. Die Modelle liefern Erklärungen für die Entstehung von Halluzinationen auf der Ebene der Informationsverarbeitung und des Bewusstseins.
Neurophysiologische Befunde: Hier werden neurophysiologische Befunde zu auditiven und visuellen Halluzinationen vorgestellt. Es werden Studien zu Schizophrenie (auditiv) und dem Charles-Bonnet-Syndrom sowie Hirnläsionsstudien (visuell) diskutiert, die einen Zusammenhang zwischen spezifischen Hirnarealen und der Entstehung von Halluzinationen aufzeigen. Der Fokus liegt auf der Lokalisation der neuronalen Aktivität während des Auftretens von Halluzinationen.
Schlüsselwörter
Halluzinationen, auditive Halluzinationen, visuelle Halluzinationen, Schizophrenie, Charles-Bonnet-Syndrom, Neuropsychologie, Neurophysiologie, Reality-Monitoring, Selbst-Monitoring, Hirnläsionen, Perceptual-Release Theorie.
Häufig gestellte Fragen: Auditive und visuelle Halluzinationen
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über auditive und visuelle Halluzinationen. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung, Erklärung und der Diskussion verschiedener neuropsychologischer und neurophysiologischer Modelle zur Entstehung von Halluzinationen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Halluzinationen, Epidemiologie und Auftretensbedingungen (einschließlich psychischer und organischer Ursachen und Vorkommen bei Gesunden), neuropsychologische Erklärungsmodelle (wie Perceptual-Release Theorie, gestörte Diskursplanung, Defizite im Reality- und Selbstmonitoring), neurophysiologische Befunde bei auditiven und visuellen Halluzinationen (mit Fokus auf Schizophrenie und Charles-Bonnet-Syndrom), und den Zusammenhang zwischen Hirnstrukturen und Halluzinationen.
Welche neuropsychologischen Modelle werden diskutiert?
Der Text diskutiert verschiedene neuropsychologische Modelle, darunter die Perceptual-Release Theorie, Modelle gestörter Diskursplanung sowie Theorien von Defiziten beim Reality- und Selbstmonitoring. Diese Modelle versuchen, die Entstehung von Halluzinationen auf der Ebene der Informationsverarbeitung und des Bewusstseins zu erklären.
Welche neurophysiologischen Befunde werden präsentiert?
Der Text präsentiert neurophysiologische Befunde zu auditiven und visuellen Halluzinationen, basierend auf Studien zur Schizophrenie (auditiv) und dem Charles-Bonnet-Syndrom (visuell), sowie Hirnläsionsstudien. Der Fokus liegt auf der Lokalisation der neuronalen Aktivität während des Auftretens von Halluzinationen und dem Zusammenhang zwischen spezifischen Hirnarealen und der Entstehung dieser Phänomene.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Die Schlüsselbegriffe umfassen: Halluzinationen, auditive Halluzinationen, visuelle Halluzinationen, Schizophrenie, Charles-Bonnet-Syndrom, Neuropsychologie, Neurophysiologie, Reality-Monitoring, Selbst-Monitoring, Hirnläsionen und Perceptual-Release Theorie.
Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, die jeweils einen Aspekt der Halluzinationen behandeln: Einleitung (mit historischem Kontext), Begriffsbestimmung, Epidemiologie und Bedingungen, neuropsychologische und kognitive Modelle, neurophysiologische Befunde und ein Resümee. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text ist für Personen geeignet, die sich akademisch mit dem Thema auditiver und visueller Halluzinationen auseinandersetzen möchten. Er eignet sich beispielsweise für Studenten der Psychologie, Neurowissenschaften oder Medizin.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, auditive und visuelle Halluzinationen umfassend zu beschreiben und zu erklären. Er will Definitionen klären, epidemiologische Daten präsentieren und verschiedene neuropsychologische und neurophysiologische Modelle diskutieren.
- Quote paper
- Bachelor of Science Said Giancoli (Author), 2009, Auditive und visuelle Halluzinationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142086