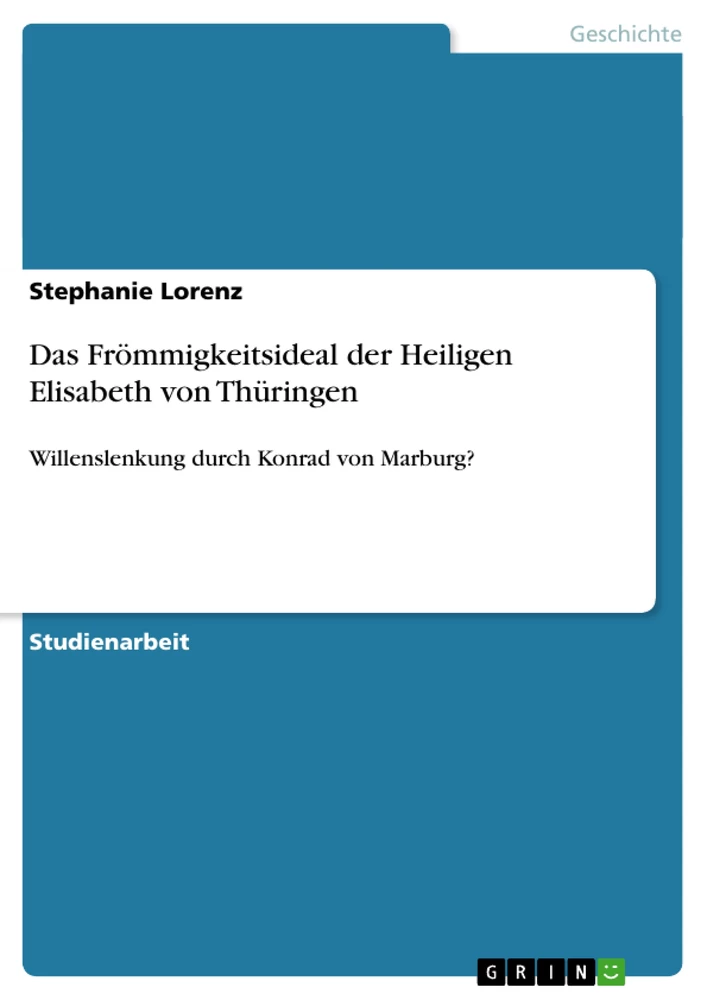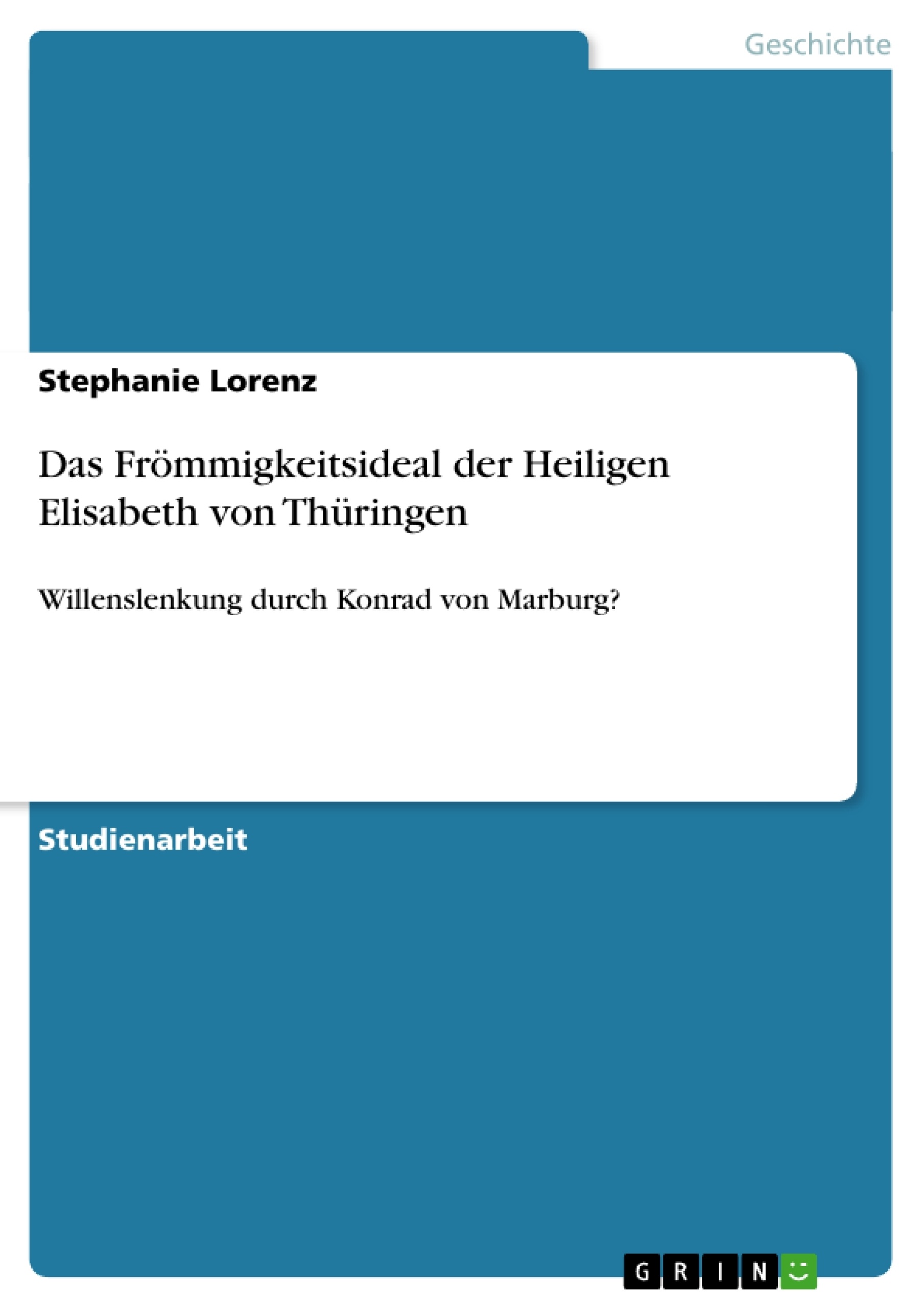Elisabeth von Thüringen hatte ursprünglich eine weltliche Bestimmung, die sie für den Rest ihres Lebens an einen herrschaftlichen Hof binden sollte. Sie entzog sich diesem Schicksal und richtete ihr Augenmerk auf die Religiösität. Es stellt sich die Frage, warum eine junge Landgräfin, erzogen nach adligen Prämissen, das geistliche Leben bevorzugte und sich auf asketische Weise der vertrauten Welt entsagte. Waren es vielleicht die Einflüsse des Gehörten über die Bettelmönche oder die starke Dominanz eines Konrad von Marburg?
Die Ursprünge der tiefen Sehnsucht nach Frömmigkeit liegen im Dunkeln. Zwar ist die Quellenlage zu Elisabeth von Thüringen überaus aufschlussreich, dank ihrer damaligen Dienerinnen und vieler Zeitgenossen, doch sprechen Sekundärliteratur und Quellen immer nur von einer jungen Frau, die wohl plötzlich zur Heiligkeit bestimmt war.
Der Weg der Elisabeth war steinig und entbehrungsreich. Viele Konflikte mussten überstanden und gelöst werden. Aber in ihrer Festigkeit im Glauben an den „rechten“ Weg christlichen Lebens blieb sie stets unbeirrt auf der Suche nach den Idealen der Frömmigkeit. Die Frage ist, inwieweit der heilige Franziskus und seine Brüder Einfluss auf die junge Frau nahmen? Oder folgte Elisabeth anderen Leitbildern, vielleicht auch keinen?
Elisabeth von Thüringen lebte zweifelsfrei in einer Zeit, in der die Menschen Heilige oder Erscheinungen durchaus als Normalitäten begriffen. Die Religiösität bestimmte das Denken und Handeln. Elisabeth´ s Lebensweg, ihre Sehnsüchte und Handlungsweisen kann man daher nur nachvollziehen, wenn der Leser Kenntnis über die gesellschaftlichen Strukturen des Mittelalters besitzt und das Kirchenverständnis der Menschen begreift. Der Prozess des Aufkeimens Elisabeths Sehnsüchte und die mentale Entwicklung der Fürstin zum angestrebten Frömmigkeitsideal sollen deshalb zentrale Fragestellungen dieser Ausarbeitung sein. Wo lagen die Wurzeln ihrer individuellen Lebensweise? Und hatte die Erziehung des Kindes von der ungemein frommen Landgräfin Sophia einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbetrachtungen
- 2. Die Religiösität im Mittelalter
- 2.1. Der Mönch
- 2.2. Das Streben nach „wahrer“ Christlichkeit
- 2.3. Ketzer und Machtkirche
- 3. Das Leben im Mittelalter
- 3.1. Frauen
- 3.2. Die Heiligen
- 3.3. Aberglaube und Erscheinungen
- 3.4. Frömmigkeitswandel und reformerische Absichten
- 4. Quellen
- 5. Die heilige Elisabeth von Thüringen
- 5.1. Die Landgräfin Elisabeth
- 5.2. Von der Adligen zur Heiligen
- 5.3. Die Bindung an Konrad von Marburg
- 5.4. Franziskanische Einflüsse
- 5.5. Einflüsse von Frauenbewegungen und Bettelmönchen
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht das Frömmigkeitsideal der Heiligen Elisabeth von Thüringen und beleuchtet die Frage nach dem Einfluss Konrad von Marburgs auf ihre Lebensführung. Sie analysiert Elisabeths Weg von einer adligen Frau zu einer Heiligen im Kontext der mittelalterlichen Religiosität und gesellschaftlichen Strukturen.
- Elisabeths Frömmigkeitsideal und ihre asketische Lebensweise
- Einfluss von Konrad von Marburg und Franziskus auf Elisabeth
- Religiöse und gesellschaftliche Verhältnisse des Mittelalters
- Die Rolle von Frauen im mittelalterlichen Kontext
- Das Streben nach „wahrer“ Christlichkeit im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbetrachtungen: Diese Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen für Elisabeths Hinwendung zum geistlichen Leben. Sie thematisiert den scheinbaren Widerspruch zwischen ihrer adligen Herkunft und ihrer asketischen Lebenswahl und deutet mögliche Einflussfaktoren wie Bettelmönche oder Konrad von Marburg an. Die Schwierigkeit, Elisabeths tiefgründige Frömmigkeit aus den vorhandenen Quellen zu rekonstruieren, wird hervorgehoben, und der Fokus auf die Entwicklung ihres Frömmigkeitsideals wird gesetzt. Die Bedeutung des sozialen und religiösen Umfelds des Mittelalters für das Verständnis von Elisabeths Lebensweg wird betont.
2. Die Religiösität im Mittelalter: Dieses Kapitel untersucht die religiösen Strukturen und das religiöse Empfinden im Mittelalter. Es beschreibt die bedeutende Rolle der Mönche als moralische Instanz und ihre Nähe zu Gott. Die Ambivalenz des mittelalterlichen Glaubens wird beleuchtet, indem neben dem traditionellen Frömmigkeitsideal auch Aspekte wie Aberglaube und die Angst vor der Sünde thematisiert werden. Das Kapitel veranschaulicht das Streben nach „wahrer“ Christlichkeit durch Buße und die Einhaltung der hierarchischen Ordnung, wobei das Leiden Christi als zentrales Motiv im künstlerischen Schaffen der Zeit erwähnt wird. Abschließend wird der Umgang der Kirche mit Ketzergruppen und deren Folgen betrachtet.
3. Das Leben im Mittelalter: Dieses Kapitel skizziert die Lebensbedingungen im Mittelalter, mit einem besonderen Augenmerk auf die Rolle der Frauen, die Heiligenverehrung und den Einfluss von Aberglauben. Es beleuchtet den Wandel der Frömmigkeit und reformerische Bestrebungen der Zeit, die das Verständnis des Kontextes für Elisabeths Lebensweg erleichtern. Es gibt einen Überblick über das gesellschaftliche und religiöse Umfeld, um das Leben Elisabeths besser einzuordnen und zu verstehen. Die verschiedenen Facetten des täglichen Lebens im Mittelalter werden dargelegt, die für die Entwicklung des Frömmigkeitsideals Elisabeths relevant sind.
5. Die heilige Elisabeth von Thüringen: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich das Leben der Heiligen Elisabeth von Thüringen, von ihrer adligen Herkunft bis hin zu ihrer Heiligsprechung. Es untersucht ihre enge Beziehung zu Konrad von Marburg und die Einflüsse des Franziskanischen Ordens und anderer Frauenbewegungen auf ihre Frömmigkeit. Die einzelnen Unterkapitel beleuchten verschiedene Aspekte ihres Lebens und ihres religiösen Engagements. Die Zusammenfassung betont die Komplexität der Person Elisabeths und ihre Bedeutung als Beispiel für ein intensives Streben nach christlicher Vollkommenheit in einer spezifischen historischen Umgebung.
Schlüsselwörter
Heilige Elisabeth von Thüringen, Frömmigkeitsideal, Mittelalter, Religiosität, Konrad von Marburg, Franziskanischer Orden, Frauen im Mittelalter, Askese, Ketzer, Machtkirche, Buße.
Häufig gestellte Fragen zur Ausarbeitung über die Heilige Elisabeth von Thüringen
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht das Frömmigkeitsideal der Heiligen Elisabeth von Thüringen und den Einfluss Konrad von Marburgs auf ihr Leben. Sie analysiert Elisabeths Weg von einer adligen Frau zu einer Heiligen im Kontext der mittelalterlichen Religiosität und gesellschaftlichen Strukturen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt Elisabeths Frömmigkeitsideal und ihre asketische Lebensweise, den Einfluss von Konrad von Marburg und Franziskus, die religiösen und gesellschaftlichen Verhältnisse des Mittelalters, die Rolle von Frauen im Mittelalter und das Streben nach „wahrer“ Christlichkeit im Mittelalter.
Welche Kapitel umfasst die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung umfasst Kapitel zu Vorbetrachtungen, der Religiosität im Mittelalter (inkl. Mönchen, dem Streben nach „wahrer“ Christlichkeit und Ketzer/Machtkirche), dem Leben im Mittelalter (inkl. Frauen, Heiligen, Aberglauben und Frömmigkeitswandel), den Quellen, der Heiligen Elisabeth von Thüringen (inkl. ihrer Herkunft, ihres Weges zur Heiligkeit, ihrer Bindung an Konrad von Marburg, franziskanischen Einflüssen und Einflüssen von Frauenbewegungen und Bettelmönchen) und einer Schlussbetrachtung.
Was wird in den einzelnen Kapiteln genauer untersucht?
Kapitel 1 (Vorbetrachtungen): Stellt die zentrale Forschungsfrage und den Fokus auf die Entwicklung von Elisabeths Frömmigkeitsideal im Kontext ihres adligen Hintergrunds. Kapitel 2 (Religiosität im Mittelalter): Untersucht religiöse Strukturen, die Rolle von Mönchen, das Streben nach „wahrer“ Christlichkeit, Aberglaube und den Umgang der Kirche mit Ketzergruppen. Kapitel 3 (Leben im Mittelalter): Skizziert die Lebensbedingungen, die Rolle der Frauen, die Heiligenverehrung, Aberglaube und den Frömmigkeitswandel. Kapitel 5 (Heilige Elisabeth von Thüringen): Beschreibt ausführlich Elisabeths Leben, ihre Beziehung zu Konrad von Marburg und die Einflüsse des Franziskanerordens und anderer Frauenbewegungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Ausarbeitung?
Schlüsselwörter sind: Heilige Elisabeth von Thüringen, Frömmigkeitsideal, Mittelalter, Religiosität, Konrad von Marburg, Franziskanischer Orden, Frauen im Mittelalter, Askese, Ketzer, Machtkirche, Buße.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Ausarbeitung enthält ein separates Kapitel zu den verwendeten Quellen (Kapitel 4).
Wie wird der Einfluss Konrad von Marburgs auf Elisabeth dargestellt?
Die Ausarbeitung untersucht den Einfluss Konrad von Marburgs auf Elisabeths Lebensführung und ihre Frömmigkeit als einen zentralen Aspekt.
Wie wird die Rolle von Frauen im Mittelalter dargestellt?
Die Ausarbeitung beleuchtet die Rolle von Frauen im mittelalterlichen Kontext und ihre Bedeutung im religiösen Leben.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Ausarbeitung?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit den Ursachen für Elisabeths Hinwendung zum geistlichen Leben und dem scheinbaren Widerspruch zwischen ihrer adligen Herkunft und ihrer asketischen Lebenswahl.
- Quote paper
- Stephanie Lorenz (Author), 2002, Das Frömmigkeitsideal der Heiligen Elisabeth von Thüringen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14186