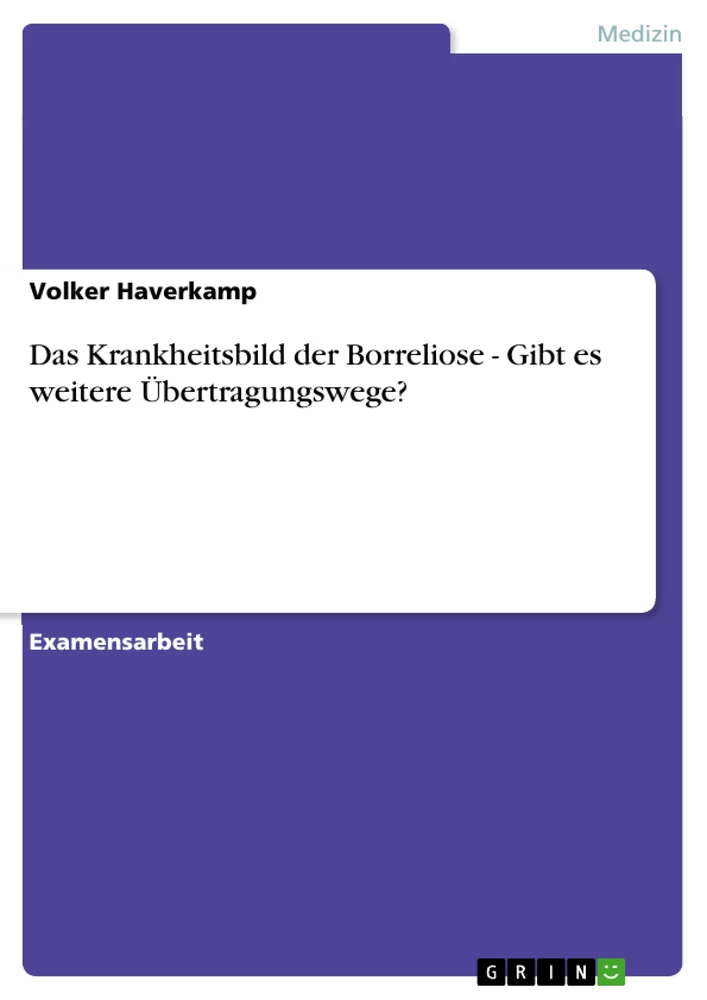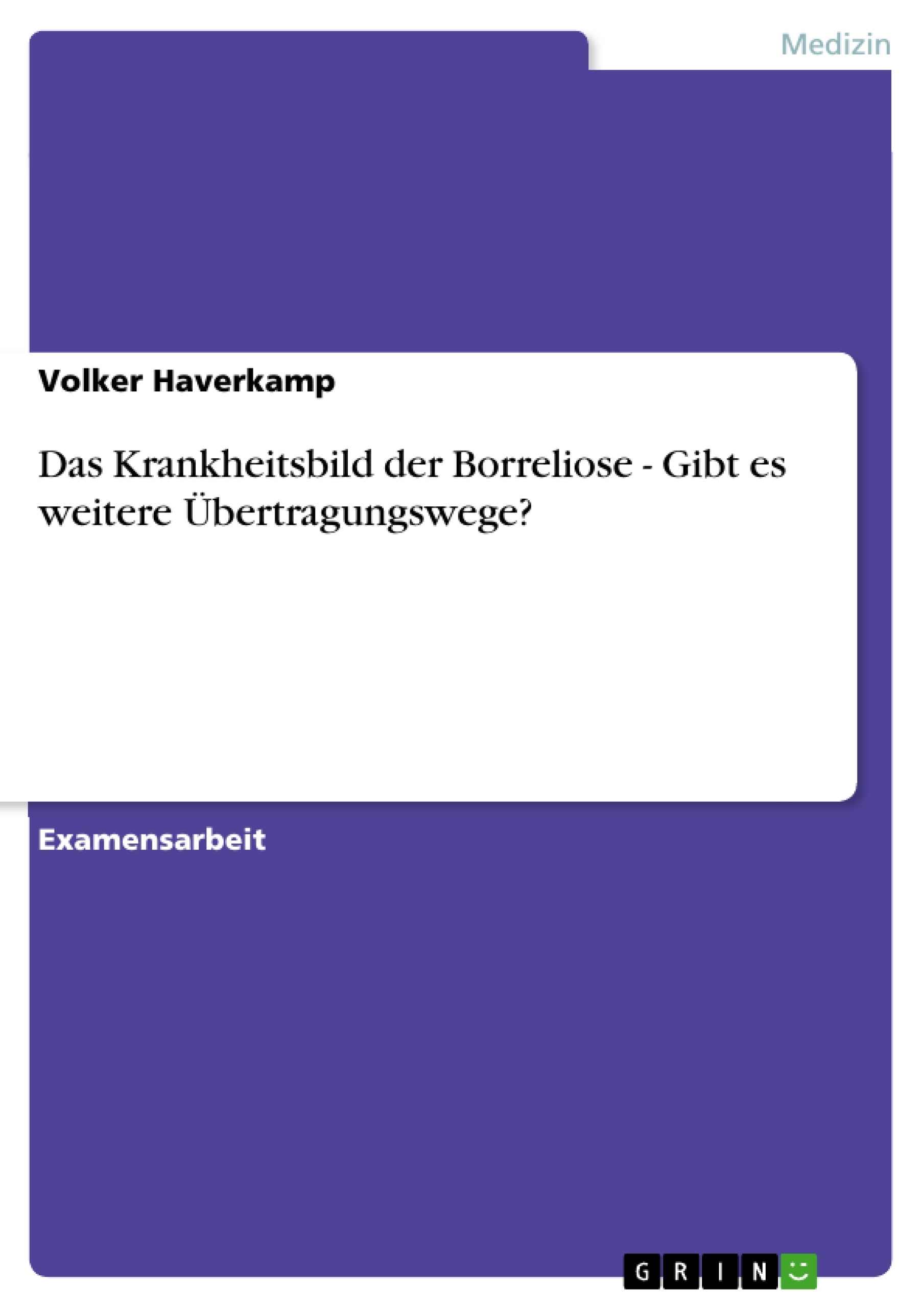Borreliose könnte eine Erkrankung sein, die nicht nur durch Zecken übertragen wird.
Diese These des Verfassers entstand nach einer selbst durchgemachten Borreliose im
Anfangsstadium. Dabei erfolgte die Infektion höchstwahrscheinlich nicht durch den
allgemein als Überträger akzeptierten Vektor Zecke, sondern durch ein anderes
stechendes Insekt.
Aufgrund der Infektion erfolgte eine Auseinandersetzung mit der Erkrankung, mit
der Erkenntnis, dass das Wissen um Klinik, Diagnostik, Therapie und Folgen bei
dem Verfasser dieser Arbeit, aber auch bei vielen anderen im medizinischen Sektor
Tätigen kaum oder gar nicht vorhanden ist, weswegen letztendlich auch die Idee zu
dieser Arbeit entstanden ist.
Borreliose oder besser Lyme- Borreliose kann eine schwerwiegende Erkrankung
beim Menschen darstellen.
Obwohl die Folgen gravierend sein können und die Krankheit in Deutschland, und
weiteren Teilen Europas, Nordamerika und in weiteren Teilen der Erde weit
verbreitet ist, ist das Wissen um das Gesamtspektrum und der daraus möglichen
Folgen der Erkrankung in der Bevölkerung, aber auch bei Ärzten erschreckend
gering.
Lyme- Borreliose ist eine durch Zecken übertragene Krankheit. Dieser Satz findet
sich oft in der Literatur, aber es stellt sich die Frage, ob dies die alleinige
Möglichkeit ist eine Lyme- Borreliose zu erwerben, da selbst in der Literatur andere
Möglichkeiten nicht ausgeschlossen werden.
Die nachfolgende Arbeit gibt einen Überblick über die komplexe Krankheit der
Lyme- Borreliose und stellt dabei die Möglichkeiten und die Problematik der
Diagnostik, des klinischen Bildes und der möglichen Therapie der Erkrankung dar.
Darauf aufbauend wird die Frage der Übertragung beleuchtet und Möglichkeiten
anderer Infektionswege aufgezeigt, sowie mögliche präventive Maßnahmen
beschrieben.
Aus dem Gesamtbild entstehende Fragen und mögliche weitere Forderungen und
Perspektiven werden dabei diskutiert. Die Lyme- Borreliose erscheint nach Sichtung der Literatur als eine komplexe
Erkrankung. Dies bezieht sich auf fast alle relevanten Themengebiete, wie z.B. die
Symptomatik, die Spätfolgen und die Diagnostik.
Selbst das als profan erscheinende Detail der Namensgebung der Erkrankung stellt
sich bei genauerer Betrachtung als relativ kompliziert heraus. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Namensgebung, Biologie und Taxonomie der Lyme- Borreliose
- 2.1. Die Entstehung des Namens der Lyme- Borreliose
- 2.2. Die Charakterisierung des Erregers der Lyme- Borreliose
- 2.2.1. Die Antigenstruktur bei Borrelia burgdorferi sensu lato
- 3. Diagnostische Mittel zum Erkennen von Lyme- Borreliose
- 3.1. Die serologische Diagnostik durch ELISA und IFT
- 3.2. Die serologische Diagnostik mit Hilfe des Immunoblots
- 3.3. Molekulare Diagnosemöglichkeiten
- 3.4. Weitere diagnostische Möglichkeiten
- 3.5. Labordiagnostische Grenzen und die Konsequenzen
- 4. Die klinischen Manifestationen der Lyme- Borreliose
- 4.1. Manifestationen des Krankheitsstadiums I
- 4.1.1. Hautmanifestationen des Stadiums I
- 4.1.2. Rheumatologische- und Organmanifestationen des Stadiums I
- 4.1.3. Sonstige Manifestationen des Stadiums I
- 4.2. Manifestationen des Krankheitsstadiums II
- 4.2.1. Hautmanifestationen des Stadiums II
- 4.2.2. Rheumatologische Manifestationen des Stadiums II
- 4.2.3. Organmanifestationen des Stadiums II
- 4.2.4. Neurologische Manifestationen des Stadiums II
- 4.2.5. Sonstige Manifestationen des Stadiums II
- 4.3. Manifestationen des Krankheitsstadiums III
- 4.3.1. Hautmanifestationen des Stadiums III
- 4.3.2. Rheumatologische Manifestationen des Stadiums III
- 4.3.3. Organmanifestationen des Stadiums III
- 4.3.4. Neurologische Manifestationen des Stadiums III
- 4.3.4.1. Lyme- Borreliose als Auslöser psychischer Erkrankungen?
- 4.3.5. Sonstige Manifestationen des Stadiums III
- 5. Therapie der Lyme- Borreliose
- 6. Die Übertragung von Lyme- Borreliose
- 6.1. Zecken als Vektoren von Lyme- Borreliose
- 6.1.1. Lebensraum und Aktivitätszeitraum der Zecken
- 6.1.2. Die Nahrungsaufnahme und die Bedeutung für die Übertragung der Krankheit
- 6.2. Gibt es weitere Möglichkeiten für die Übertragung von Lyme- Borreliose?
- 6.2.1. Stechende Insekten als Überträger der Lyme- Borreliose?
- 7. Prävention von Lyme- Borreliose
- 8. Epidemiologische Daten der Lyme- Borreliose
- 9. Resumee, offene Fragen und Zukunftsperspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit befasst sich mit dem komplexen Krankheitsbild der Lyme-Borreliose und widmet sich insbesondere der Frage, ob es neben Zecken weitere Übertragungswege für die Krankheit gibt. Die Arbeit entstand aus der persönlichen Erfahrung des Autors, der selbst an einer Borreliose im Anfangsstadium erkrankt war, wobei die Infektion vermutlich nicht durch einen Zeckenbiss, sondern durch ein anderes stechendes Insekt verursacht wurde. Angesichts der unzureichenden Kenntnisse über Klinik, Diagnostik, Therapie und Folgen der Lyme-Borreliose, sowohl bei medizinischem Fachpersonal als auch in der breiten Bevölkerung, soll diese Arbeit einen umfassenden Überblick über das Thema liefern.
- Die Namensgebung und die Biologie des Erregers der Lyme-Borreliose
- Diagnostische Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Erkennung der Lyme-Borreliose
- Klinische Manifestationen der Lyme-Borreliose in verschiedenen Krankheitsstadien
- Therapiemöglichkeiten und präventive Maßnahmen
- Die Rolle von Zecken als Vektoren und die Möglichkeit weiterer Übertragungswege
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in die Thematik der Lyme-Borreliose ein und beleuchtet die Motivation des Autors, sich mit diesem komplexen Krankheitsbild auseinanderzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf der unzureichenden Kenntnis der Erkrankung, sowohl in der Bevölkerung als auch in medizinischen Kreisen.
- Kapitel 2 befasst sich mit der Namensgebung der Lyme-Borreliose und gibt einen Einblick in die Entdeckungsgeschichte. Anschließend erfolgt eine detaillierte Beschreibung des Erregers, Borrelia burgdorferi sensu lato, einschließlich seiner Antigenstruktur.
- Kapitel 3 stellt verschiedene diagnostische Mittel zur Erkennung der Lyme-Borreliose vor, darunter serologische Methoden wie ELISA und IFT, der Immunoblot sowie molekulare Diagnostik. Außerdem werden die Grenzen der Labordiagnostik und die daraus resultierenden Konsequenzen diskutiert.
- Kapitel 4 beschreibt die klinischen Manifestationen der Lyme-Borreliose in den verschiedenen Krankheitsstadien. Dabei werden die Symptome in den Bereichen Haut, Rheumatologie, Organe und Neurologie sowie sonstige Manifestationen detailliert dargestellt.
- Kapitel 5 bietet einen Überblick über die therapeutischen Möglichkeiten bei der Lyme-Borreliose. Es werden verschiedene Therapieansätze und deren Wirksamkeit besprochen.
- Kapitel 6 widmet sich der Übertragung der Lyme-Borreliose. Zecken werden als primäre Vektoren der Krankheit vorgestellt, und es werden die Lebensräume, Aktivitätszeiträume sowie die Bedeutung der Nahrungsaufnahme für die Übertragung der Krankheit beleuchtet. Darüber hinaus werden alternative Übertragungswege, wie die Rolle stechender Insekten, diskutiert.
- Kapitel 7 gibt einen Überblick über präventive Maßnahmen, die zur Vermeidung einer Lyme-Borreliose-Infektion beitragen können.
- Kapitel 8 präsentiert epidemiologische Daten zur Lyme-Borreliose und zeigt die Verbreitung der Krankheit in verschiedenen Regionen der Welt auf.
Schlüsselwörter
Lyme-Borreliose, Borrelia burgdorferi sensu lato, Diagnostik, ELISA, IFT, Immunoblot, klinische Manifestationen, Krankheitsstadien, Therapie, Übertragung, Zecken, Vektoren, stechende Insekten, Prävention, Epidemiologie.
- Quote paper
- Volker Haverkamp (Author), 2002, Das Krankheitsbild der Borreliose - Gibt es weitere Übertragungswege?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14171