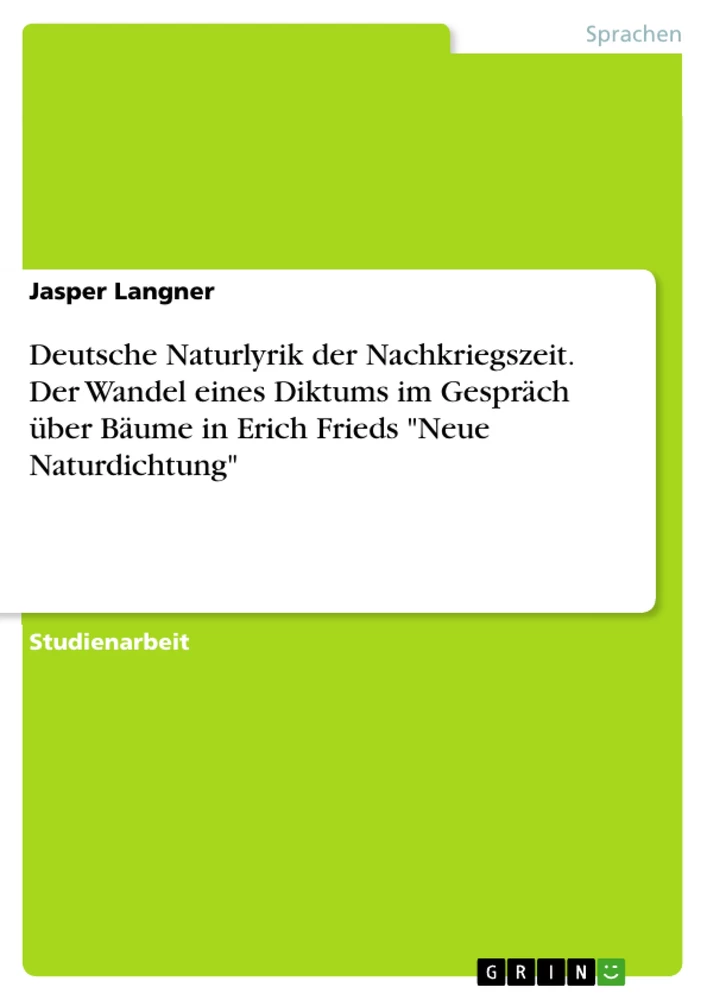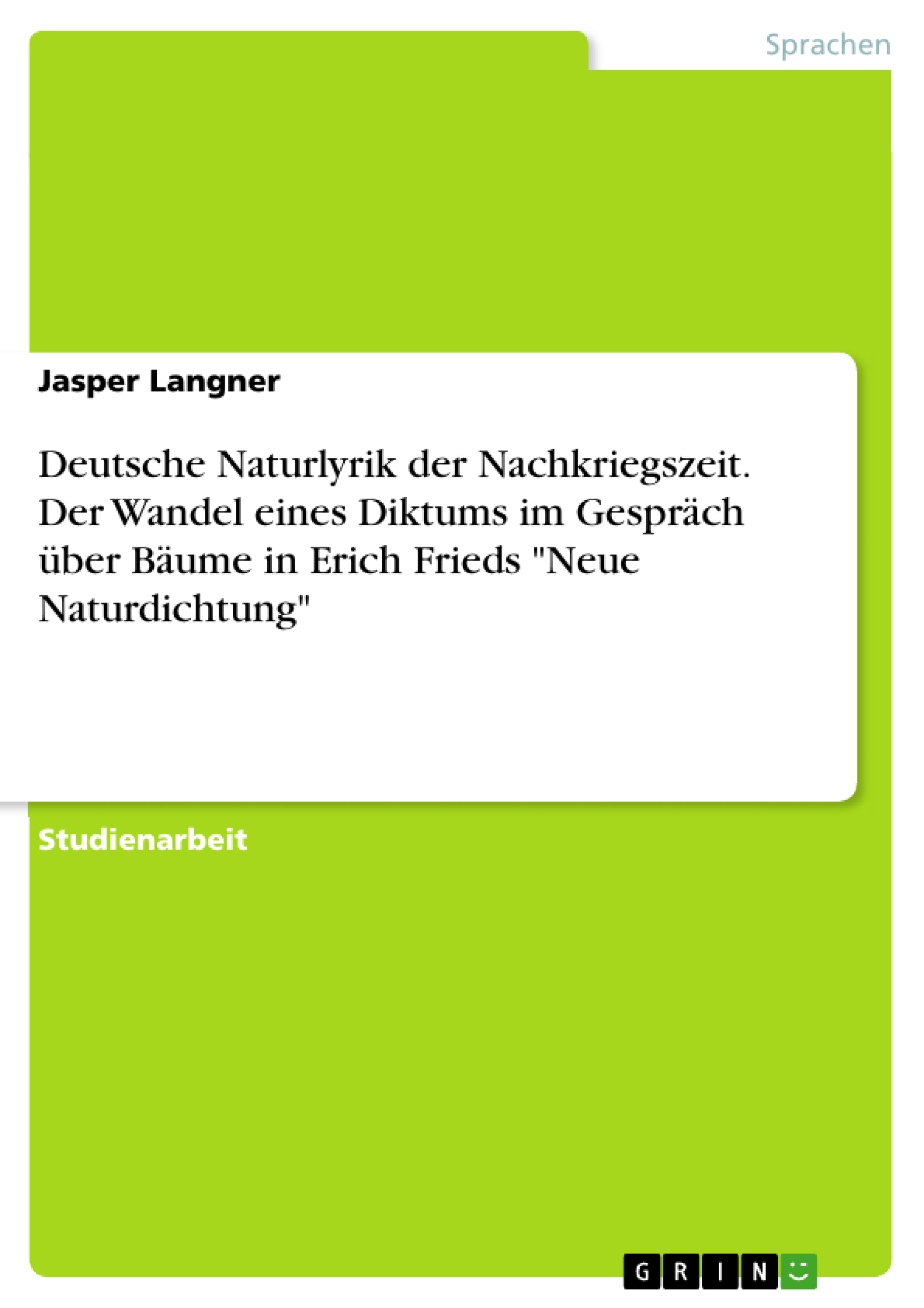Die vorliegende Arbeit „Deutsche Naturlyrik der Nachkriegszeit: Der Wandel eines Diktums im Gespräch über Bäume in Erich Frieds neue Naturdichtung“ befasst sich mit der deutschen Naturlyrik der Nachkriegszeit. Insbesondere wird der Wandel der naturmagischen Dichtung hin zu einer ökokritischen Lyrik analysiert. Als Ausgangs- und Orientierungspunkt dienen Brechts Verse über das Gespräch über Bäume, die als Initialpunkt für einen lyrischen Dialog über die nachfolgenden Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen werden können. Die Arbeit fokussiert die Frage, welchen Entwicklungspunkt Frieds Gedicht „neue Naturdichtung“ im Diskurs über das Gespräch über Bäume markiert und welche Wirkkraft es für die Naturlyrik bis heute entfaltet.
Zunächst werden in Kapitel 1.1 grundlegende definitorische Begriffsbestimmungen von Naturlyrik umrissen. Es wird aufgezeigt, warum sich Brecht und Fried nicht geradlinig in das Kompositum ‚Naturlyrik‘ einordnen lassen.
In Kapitel 1.2 wird der Wandel der Naturlyrik nach dem 2.Weltkrieg skizziert. Hierbei wird auf die Ablösung des naturmagischen Gedichts referenziert und der Wandel des Brecht’schen Diktums genauer ausgeleuchtet. Es wird thematisiert, warum die Naturlyrik nach dem 2.Weltkrieg in Verdacht geraten ist und inwiefern Brecht dabei eine entscheidende Rolle einnimmt. Anschließend werden die Versuche der lyrischen Bearbeitung von Naturmotiven seit den 1970er Jahren analysiert.
Kapitel 2 fokussiert die Sprache und Wirkkraft Erich Frieds. Dieses Kapitel gibt Aufschluss über die politisierenden Motive des in Kapitel 3 untersuchten Gedichts „neue Naturdichtung“.
Im dritten Kapitel werden interpretatorische Ansätze des Gedichts „neue Naturdichtung“ erläutert. In Kapitel 3.1 werden die poetologisch reflexiven Motive des Gedichts analysiert. Kapitel 3.2 nimmt Bezug auf den selbsterlebten Eindruck und eruiert, inwiefern dieser als zentraler Bezugspunkt für eine neue ökolyrische Bearbeitung in der Lyrik darstellt.
Im vierten Kapitel 4 werden die interpretatorischen Ansätze reflektiert und im Gespräch über Bäume eingeordnet. Anschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1
- 1.1 „Die Naturlyrik“ – Eine Begriffsbestimmung
- 1.2 Deutsche Naturlyrik im Wandel nach 1945
- 1.2.1 Die Ablösung des naturmagischen Gedichts
- 1.2.2 Wandel eines Diktums im Gespräch über Bäume
- Kapitel 2 Erich Frieds Sprache und Wirkung im biographischen Bezug
- Kapitel 3
- 3.1 Poetologische Reflexion über das Dichten in „Neue Naturdichtung“
- 3.2 Der neue selbsterlebte Eindruck in „Neue Naturdichtung“.
- Kapitel 4
- 4.1 Reflexion über die Bedeutung des selbsterlebten Eindrucks
- 4.2 Einordnung im Diskurs über das Gespräch über Bäume
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der deutschen Naturlyrik nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Abkehr von der naturmagischen Dichtung hin zu einer ökokritischen Lyrik. Brechts Verse über das Gespräch über Bäume dienen als Ausgangspunkt, um den Entwicklungspunkt von Erich Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“ im Diskurs zu analysieren und dessen nachhaltige Wirkung auf die Naturlyrik zu beleuchten.
- Begriffsbestimmung und Problematik des Terminus „Naturlyrik“
- Wandel der Naturlyrik nach 1945 und die Ablösung des naturmagischen Gedichts
- Analyse von Erich Frieds Sprache und Wirkung
- Interpretation von Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“ und dessen poetologische Reflexion
- Einordnung der Ergebnisse in den Diskurs über das Gespräch über Bäume
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Kapitel 1 befasst sich zunächst mit der Definition von Naturlyrik. Es wird deutlich, dass der Begriff mehrdeutig und oft missbraucht wird, und dass eine eindeutige Einordnung von Autoren wie Brecht und Fried problematisch ist. Die Kapitel analysiert die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff und dessen vielfältige Definitionen, die eine umfassende, einheitliche Definition unmöglich machen. Es werden verschiedene Literaturlexika herangezogen, um die verschiedenen Perspektiven auf den Begriff zu beleuchten und zu zeigen, wie komplex und vielschichtig die Definition von Naturlyrik tatsächlich ist.
Kapitel 1.2: Dieses Kapitel beschreibt den tiefgreifenden Wandel der deutschen Naturlyrik nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird die Ablösung der naturmagischen Dichtung thematisiert und der Einfluss von Brecht auf die Entwicklung einer kritischeren, gesellschaftsbezogenen Naturlyrik herausgestellt. Die Arbeit beleuchtet die Verknüpfung von Naturlyrik mit politischen und gesellschaftlichen Kontexten, besonders in den 1960er und 1970er Jahren, wo Naturlyrik als Symptom politischer Desorientierung interpretiert wurde. Die Analyse verdeutlicht, wie die Wahrnehmung von Naturlyrik im Nachkriegsdeutschland geprägt wurde und sich von einer traditionellen, romantischen Sichtweise hin zu einer kritischen Auseinandersetzung entwickelte.
Kapitel 2: Kapitel 2 konzentriert sich auf die Sprache und die Wirkung des Werks von Erich Fried. Hier wird der Fokus auf die politisierenden Motive gelegt, die im folgenden Kapitel 3, in der Analyse von Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“, eine zentrale Rolle spielen. Die Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der politischen und gesellschaftlichen Dimensionen in Frieds Werk und bereitet den Weg für die detaillierte Gedichtinterpretation.
Kapitel 3: In Kapitel 3 werden interpretative Ansätze zu Erich Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“ vorgestellt. Kapitel 3.1 analysiert die poetologischen Reflexionen im Gedicht, während Kapitel 3.2 den „selbsterlebten Eindruck“ als zentralen Bezugspunkt für eine neue, ökolyrische Bearbeitung in der Lyrik untersucht. Die beiden Unterkapitel arbeiten zusammen, um ein umfassendes Verständnis des Gedichts zu liefern, indem sie sowohl die formalen als auch die inhaltlichen Aspekte beleuchten und deren Bedeutung im Kontext der Naturlyrik herausstellen.
Kapitel 4: Kapitel 4 reflektiert die in Kapitel 3 gewonnenen interpretativen Ansätze und ordnet sie in den größeren Diskurs über das „Gespräch über Bäume“ ein. Es stellt somit eine Synthese der vorherigen Kapitel dar und fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, um die Bedeutung von Frieds Werk im Kontext der deutschen Naturlyrik nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdeutlichen. Der Bezug zum Diskurs um das „Gespräch über Bäume“ bietet eine Einordnung in den historischen Kontext und zeigt die Relevanz der Untersuchung.
Schlüsselwörter
Naturlyrik, Nachkriegslyrik, Erich Fried, „Neue Naturdichtung“, Ökolyrik, Naturmagische Dichtung, Brecht, Gesellschaftskritik, Poetologie, Selbsterlebter Eindruck, Diskursanalyse, Wandel des Diktums.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der deutschen Naturlyrik nach 1945 am Beispiel Erich Frieds
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Wandel der deutschen Naturlyrik nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Abkehr von der naturmagischen Dichtung hin zu einer ökokritischen Lyrik. Der Fokus liegt auf Erich Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“ und dessen Einordnung in den Diskurs um Brechts „Gespräch über Bäume“.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffsbestimmung und Problematik von „Naturlyrik“, den Wandel der Naturlyrik nach 1945 mit der Ablösung der naturmagischen Dichtung, die Analyse von Erich Frieds Sprache und Wirkung, die Interpretation von Frieds „Neue Naturdichtung“ (inklusive poetologischer Reflexionen und des „selbsterlebten Eindrucks“), und die Einordnung der Ergebnisse in den Diskurs über das Gespräch über Bäume.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel plus Einleitung und Resümee. Kapitel 1 definiert den Begriff „Naturlyrik“ und beschreibt den Wandel nach 1945. Kapitel 2 konzentriert sich auf Erich Frieds Werk. Kapitel 3 analysiert Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“, und Kapitel 4 ordnet die Ergebnisse in den Diskurs um das „Gespräch über Bäume“ ein.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass Erich Frieds „Neue Naturdichtung“ einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer kritischen, gesellschaftsbezogenen Naturlyrik nach 1945 darstellt und eine Abkehr von der naturmagischen Tradition repräsentiert. Die Analyse von Frieds Werk im Kontext des Diskurses um Brechts "Gespräch über Bäume" verdeutlicht diesen Wandel.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet interpretative und diskursanalytische Methoden. Es werden verschiedene Literaturlexika herangezogen, um den Begriff „Naturlyrik“ zu beleuchten. Die Analyse von Frieds Gedicht beinhaltet sowohl eine poetologische als auch eine inhaltliche Betrachtung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Naturlyrik, Nachkriegslyrik, Erich Fried, „Neue Naturdichtung“, Ökolyrik, Naturmagische Dichtung, Brecht, Gesellschaftskritik, Poetologie, Selbsterlebter Eindruck, Diskursanalyse, Wandel des Diktums.
Welche Rolle spielt Erich Fried in dieser Arbeit?
Erich Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“ steht im Mittelpunkt der Analyse. Seine Sprache, seine poetologischen Ansätze und die Bedeutung des „selbsterlebten Eindrucks“ werden detailliert untersucht, um seinen Beitrag zum Wandel der Naturlyrik zu beleuchten.
Wie wird der Wandel der Naturlyrik nach 1945 dargestellt?
Der Wandel wird als Abkehr von der naturmagischen Dichtung hin zu einer kritischeren, gesellschaftsbezogenen Naturlyrik dargestellt, wobei der Einfluss von Brecht und die Entwicklung einer ökokritischen Perspektive hervorgehoben werden.
Welche Bedeutung hat Brechts „Gespräch über Bäume“?
Brechts „Gespräch über Bäume“ dient als wichtiger Bezugspunkt im Diskurs, in den Frieds „Neue Naturdichtung“ eingeordnet wird. Es hilft, den historischen und gesellschaftlichen Kontext des Wandels in der Naturlyrik zu verstehen.
- Quote paper
- Jasper Langner (Author), 2023, Deutsche Naturlyrik der Nachkriegszeit. Der Wandel eines Diktums im Gespräch über Bäume in Erich Frieds "Neue Naturdichtung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1416874