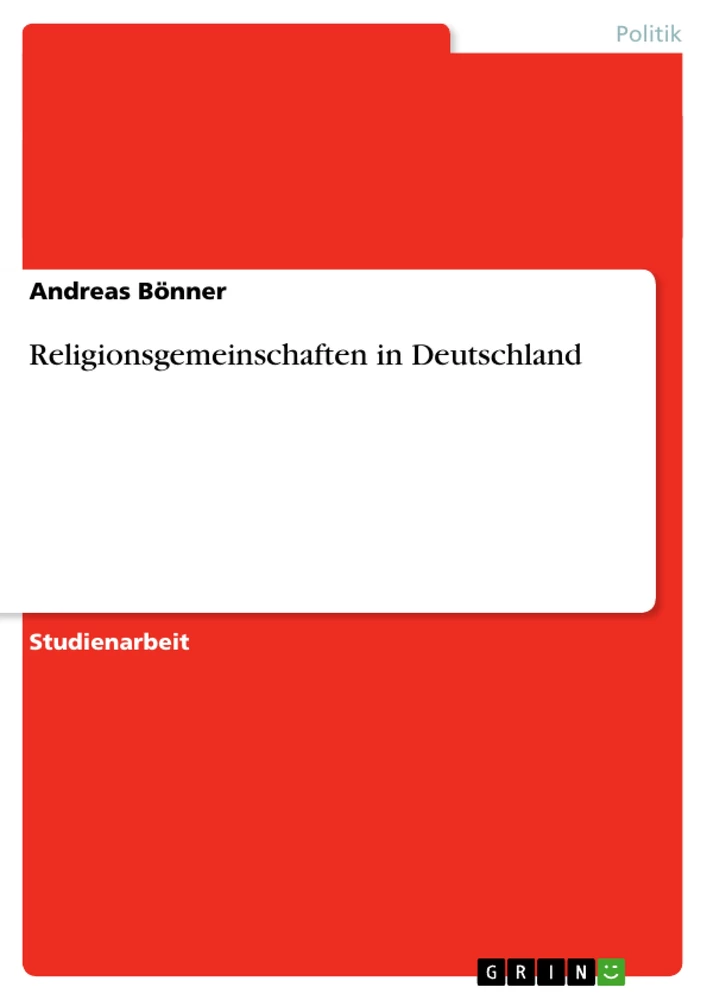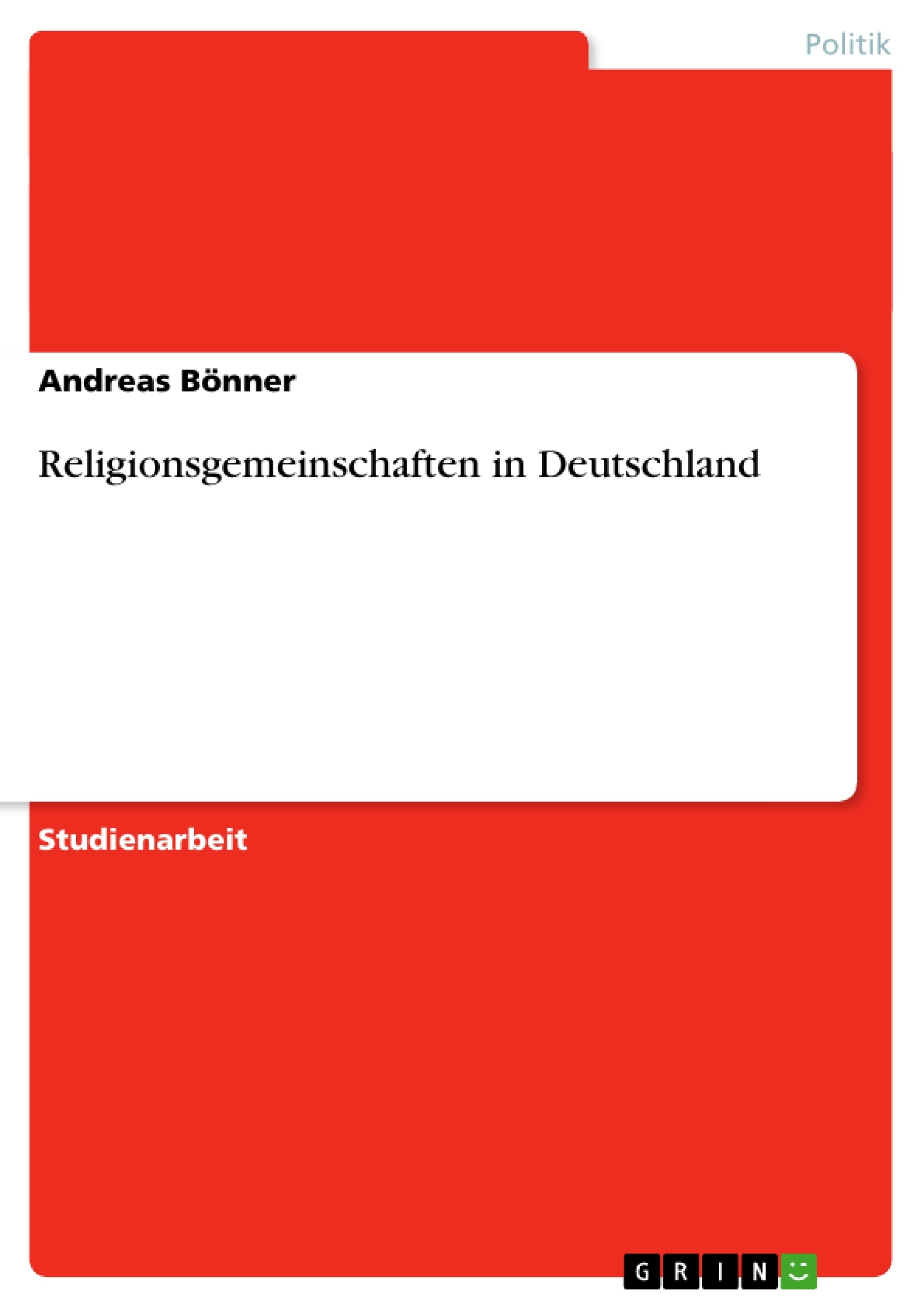Religionsgemeinschaften existieren länger als der Staat. Seit der moderne Mensch lebt, war er mit Religion verbunden. So wie der Mensch entwickelten sich unterschiedliche religiöse Gemeinschaften. Fünf Weltreligionen haben sich herauskristallisiert - das Christentum, das Judentum, der Islam, der Hinduismus und der Buddhismus. Diese religiösen Gemeinschaften prägen bis heute die Welt und Deutschland. Die Einen mit kleinerer Anhägerzahl, die Anderen mit größerer. Zudem splittern sich die einzelnen Religionen in unzählige Untergruppen auf, die hier nicht betrachtet werden. Eine Sonderform der Religionsgemeinschaften stellen die Sekten dar, von denen zwei exemplarisch vorgestellt werden. Im Schwerpunkt werden die christlichen Religionsgemeinschaften, der Islam und das Judentum thematisiert und dargestellt, wie diese mit der Politik verknüpft sind. Nach einer kurzen Einführung, in der die wichtigsten Daten und Merkmale der einzelnen Religionsgemeinschaften genannt werden, folgt eine Erklärung der Staatskirchenverträge. Dabei wird der Frage nachgegangen, warum diese nicht für alle Religionsgemeinschaften gelten, und die weltweit einmalige Bedeutung der Kirchen hervorgehoben. Um diesen Abschnitt zu verstehen, muss der Begriff Körperschaft definiert werden, der die Religionsgemeinschaften in zwei Gruppen einteilt, nämlich die mit und die ohne Körperschaftsstatus. Der Sinn der Staatskirchenverträge und die Problematik, die diese heute bieten, werden in mehreren Beispielen erläutert.
Diese Beispiele leiten zugleich über zu der Frage, wie Religionsgemeinschaften mit der Politik verknüpft sind, und ob die strikte Trennung zwischen Staat und Kirche wirklich in Deutschland existiert. Dargestellt wird unter anderem, wie sich die Konfession auf das Wahlverhalten auswirkt, und welchen Einfluss die Kirche auf die Politik hat und die Politik auf die Kirche. Dazu werden besondere ältere und aktuelle Beispiele erläutert, in denen sich die Kirche in die Familienpolitik und der Staat in die Sonderstellung der katholischen Fakultäten einmischen.
Ein erster Anknüpfungspunkt zur Klärung der Verhältnisse zwischen Politik und Kirche ist das Grundgesetz, indem das Verhältnis von Staat und Kirche geklärt, und die Religionsfreiheit definiert ist, die als eines der höchsten Güter der Menschheit gilt und kurz betrachtet werden wird.
Abschließend wird der Frage nachgegangen, welchen ...
Inhaltsverzeichnis
- Themeneinführung
- Religionsgemeinschaften
- Christliche Religionsgemeinschaften
- Die römisch-katholische Kirche
- Die evangelische Kirche
- Sonstige christliche Religionsgemeinschaften
- Das Judentum
- Der Islam
- Sonstige Religionsgemeinschaften
- Christliche Religionsgemeinschaften
- Staat und Kirche
- Staatskirchenverträge
- Körperschaftsrecht
- Religionsfreiheit
- Kirche und Politik
- Entwicklung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Religionsgemeinschaften in Deutschland und deren Verhältnis zum Staat. Sie analysiert die wichtigsten christlichen Religionsgemeinschaften, den Islam und das Judentum, sowie deren Verknüpfung mit der Politik. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Staatskirchenverträge, die Religionsfreiheit und die Entwicklungstendenzen der Religionsgemeinschaften in Deutschland.
- Die Rolle der Religionsgemeinschaften in der deutschen Gesellschaft
- Das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland
- Die Bedeutung der Staatskirchenverträge
- Die Religionsfreiheit als Grundrecht
- Die Entwicklungstendenzen der Religionsgemeinschaften in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Religionsgemeinschaften in Deutschland. Sie stellt die wichtigsten Daten und Merkmale der einzelnen Religionsgemeinschaften vor, insbesondere der christlichen Religionsgemeinschaften, des Islam und des Judentums.
Im zweiten Kapitel werden die Staatskirchenverträge näher beleuchtet. Es wird erläutert, warum diese nicht für alle Religionsgemeinschaften gelten und welche Bedeutung die Kirchen in Deutschland haben. Der Begriff Körperschaft wird definiert und die Religionsgemeinschaften in zwei Gruppen eingeteilt: diejenigen mit und diejenigen ohne Körperschaftsstatus.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Religionsgemeinschaften mit der Politik verknüpft sind. Es wird untersucht, ob die strikte Trennung zwischen Staat und Kirche in Deutschland wirklich existiert und wie sich die Konfession auf das Wahlverhalten auswirkt.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Religionsfreiheit als Grundrecht und das Verhältnis von Staat und Kirche im Grundgesetz.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Entwicklungstendenzen der Religionsgemeinschaften in Deutschland und den Problemen, die diese heute beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Religionsgemeinschaften, Staat und Kirche, Staatskirchenverträge, Religionsfreiheit, Christentum, Islam, Judentum, Politik, Deutschland, Entwicklungstendenzen.
- Quote paper
- Andreas Bönner (Author), 2007, Religionsgemeinschaften in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141619