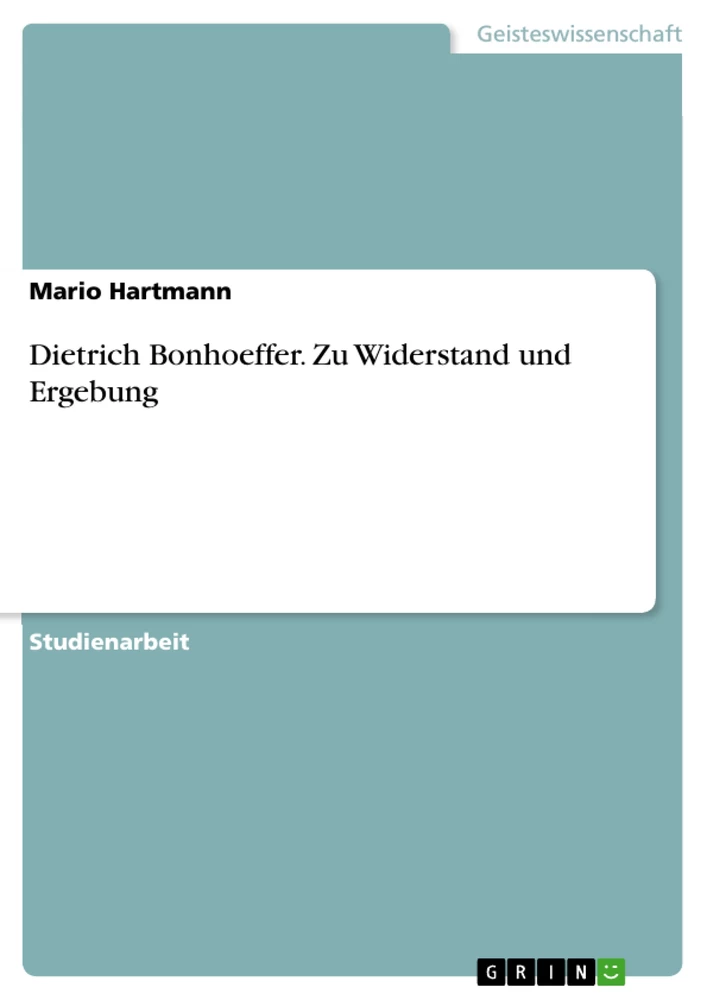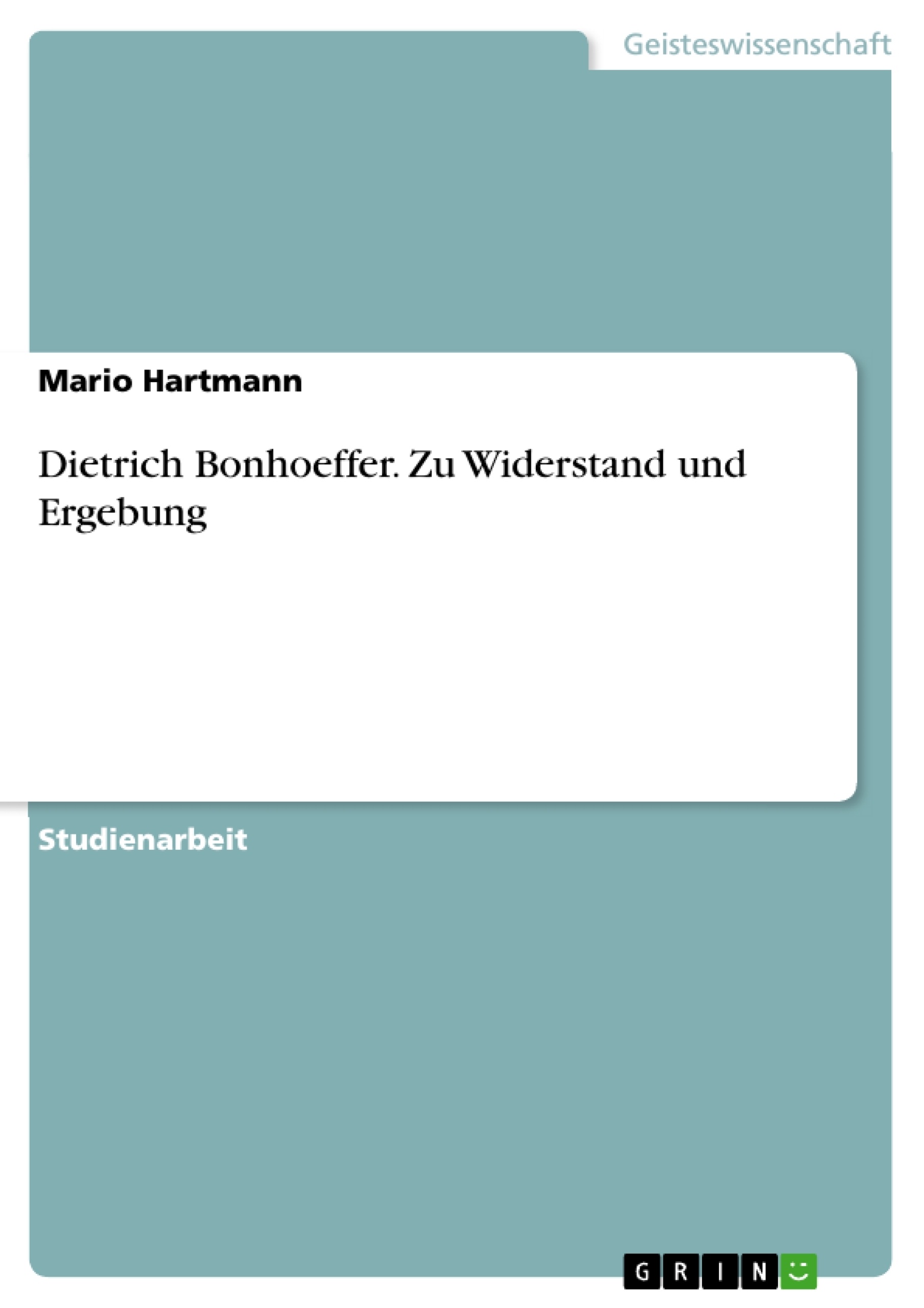Der 1906 in Breslau geborene Dietrich Bonhoeffer wird zu jener Theologengeneration gezählt, die „zum Teil durch den Zweiten Weltkrieg um ihre Entfaltung“ gebracht wurde. Dennoch gelangte er sowohl mit seinem fragmentarischen Werk, als auch mit seiner widerständigen Biografie, ungefähr zehn Jahre nach seinem gewaltsamen Tod, zu einer weltbekannten Berühmtheit. Seine überragende Bedeutung liegt nach Meinung des Neffen, Hans-Walter Schleichers, „nicht in erster Linie im Politischen, denn Bonhoeffer war kein Politiker und wollte nicht „politisch“ handeln, sondern als Mensch und Christ, der an der Stelle, an die ihn Gott gestellt hat, Verantwortung übernimmt.“
Allein seine von Weitsicht und Mut zeugenden Äußerungen, die zu Lebzeiten an die Öffentlichkeit gelangten, werden neben denen Karl Barths (1886-1968) zu den „klassischen Zeugnissen kirchlich-evangelischer Besinnung in dieser Zeit“ gezählt. Über Bonhoeffers Dissertation, die er als Dreiundzwanzigjähriger unter der Überschrift „Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche“ eingereicht hatte, schrieb Karl Barth fast 30 Jahre später:
„Ich gestehe offen, dass es mir Sorge macht, die von Bonhoeffer damals erreichte Höhe (...) wenigstens zu halten (...) nicht schwächer zu reden, als dieser junge Mann es damals getan hat.“
Barth ist jedoch anzukreiden, dass ihn seine Fehlurteile über Stalin (1879-1953) und den Kommunismus weit unter das Niveau Bonhoeffers geraten ließen, abgesehen von der Polemik voller Verdächtigungen gegen den protestantischen Theologen und späteren Spitzenpolitiker Eugen Gerstenmaier (1906-1986).
Bonhoeffer ist über die Grenzen von Ländern und Konfessionen hinaus bekannt geworden, ehe es eine Biographie über in gab. Man hält ihn für einen glaubwürdigen Christen unserer Zeit und schenkt ihm bis heute Aufmerksamkeit, weil er neue Wege betreten und sie zu deuten gewusst hat. Es steht außer Frage, dass Dietrich Bonhoeffer zu einer verschwindend kleinen Gruppe von Männern der Kirche gehört hat, die den Schritt zur aktiven politischen Untergrundtätigkeit vollzogen haben. Außer der Menge von Bürgern und Adligen, von Militärs und Sozialisten enthält die Tafel der Opfer des 20. Juli 1944 drei Namen von katholischen Kirchenmännern: Pater Delp, Prälat Müller und Kaplan Wehrle; auf evangelischer Seite zählt dazu Dietrich Bonhoeffer und der hauptamtliche Jurist der Bekennenden Kirche, Friedrich Justus Perels.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Die Stufen des Widerstandes in der nationalsozialistischen Zeit
- 2.2 Der Weg zum aktiven Widerstand
- 2.3 Die Art des Widerstandes
- 2.4 Die Zeit des aktiven Widerstandes
- 2.5 Inhaftierung und Ergebung
- 3. Schluss
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich Dietrich Bonhoeffers Weg des Widerstands und der Ergebung im nationalsozialistischen Deutschland. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung seines Widerstandes gegen das NS-Regime, unter Berücksichtigung seiner theologischen und ethischen Überzeugungen sowie seiner persönlichen Lebensumstände.
- Entwicklung und Phasen des Widerstands Bonhoeffers
- Der Einfluss der theologischen und ethischen Grundsätze Bonhoeffers auf seinen Widerstand
- Die Rolle der Kirchen im Widerstand
- Bonhoeffers Weg zur aktiven politischen Untergrundtätigkeit
- Die Bedeutung von Inhaftierung und Ergebung für Bonhoeffers Widerstand
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert Dietrich Bonhoeffer als einen bedeutenden Theologen und Widerstandskämpfer, dessen Werk und Biographie ihn trotz seines frühen Todes weltberühmt machten. Sie hebt die Bedeutung von Bonhoeffers Engagement für die Übernahme von Verantwortung als Mensch und Christ hervor.
Der Hauptteil behandelt Bonhoeffers Widerstand gegen das NS-Regime in fünf Phasen. Die erste Phase reicht von der Fritsche-Krise bis zum Münchener Abkommen und kennzeichnet sich durch Mitwisserschaft und Billigung des NS-Regimes. Die zweite Phase erstreckt sich vom Münchener Abkommen bis zum Beginn der Frankreichoffensive und bleibt in der Phase der Mitwisserschaft und Billigung. Die dritte Phase, vom Frankreichfeldzug bis zur Verhaftung Bonhoeffers, zeichnet sich durch seine aktive Teilhaberschaft am Widerstand aus. Die vierte Phase umfasst die Zeit bis zum 20. Juli 1944 und fokussiert auf die Bemühungen Bonhoeffers, seine Handlungen zu schützen. Die fünfte Phase zeichnet den Kampf Bonhoeffers um ein mögliches Überleben nach.
Kapitel 2.1 befasst sich mit den Stufen des Widerstands während der nationalsozialistischen Zeit, wie sie von Eberhardt Bethge beschrieben werden. Hier werden fünf Stufen des Widerstands definiert, angefangen vom einfachen passiven Widerstand bis hin zur aktiven Konspiration. Kapitel 2.2 beleuchtet den Weg Bonhoeffers zum aktiven Widerstand, der durch Entscheidungen geprägt war, die seine kirchliche Position zunächst noch nicht veränderten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Widerstand und Ergebung, im Kontext der nationalsozialistischen Zeit. Sie beleuchtet die theologischen und ethischen Grundsätze, die Bonhoeffers Handeln bestimmten, sowie die Herausforderungen und Konflikte, die mit der Entscheidung zum aktiven Widerstand verbunden waren. Wesentliche Schlüsselwörter sind: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand, Ergebung, Nationalsozialismus, Theologie, Ethik, Kirche, politische Untergrundtätigkeit, Inhaftierung.
- Quote paper
- Mario Hartmann (Author), 2008, Dietrich Bonhoeffer. Zu Widerstand und Ergebung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141547