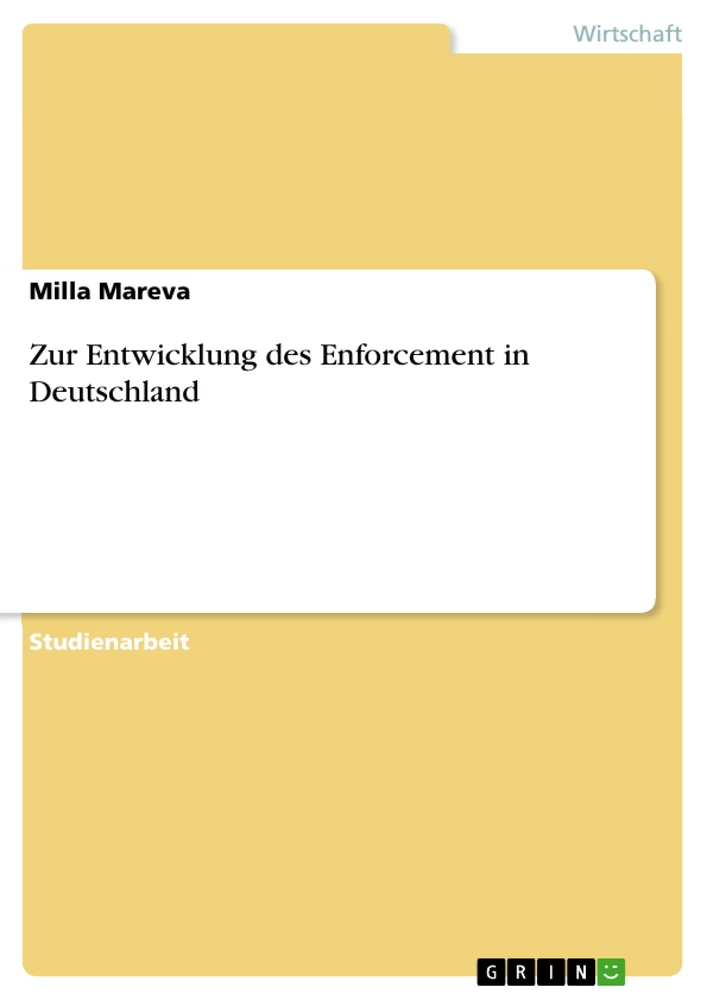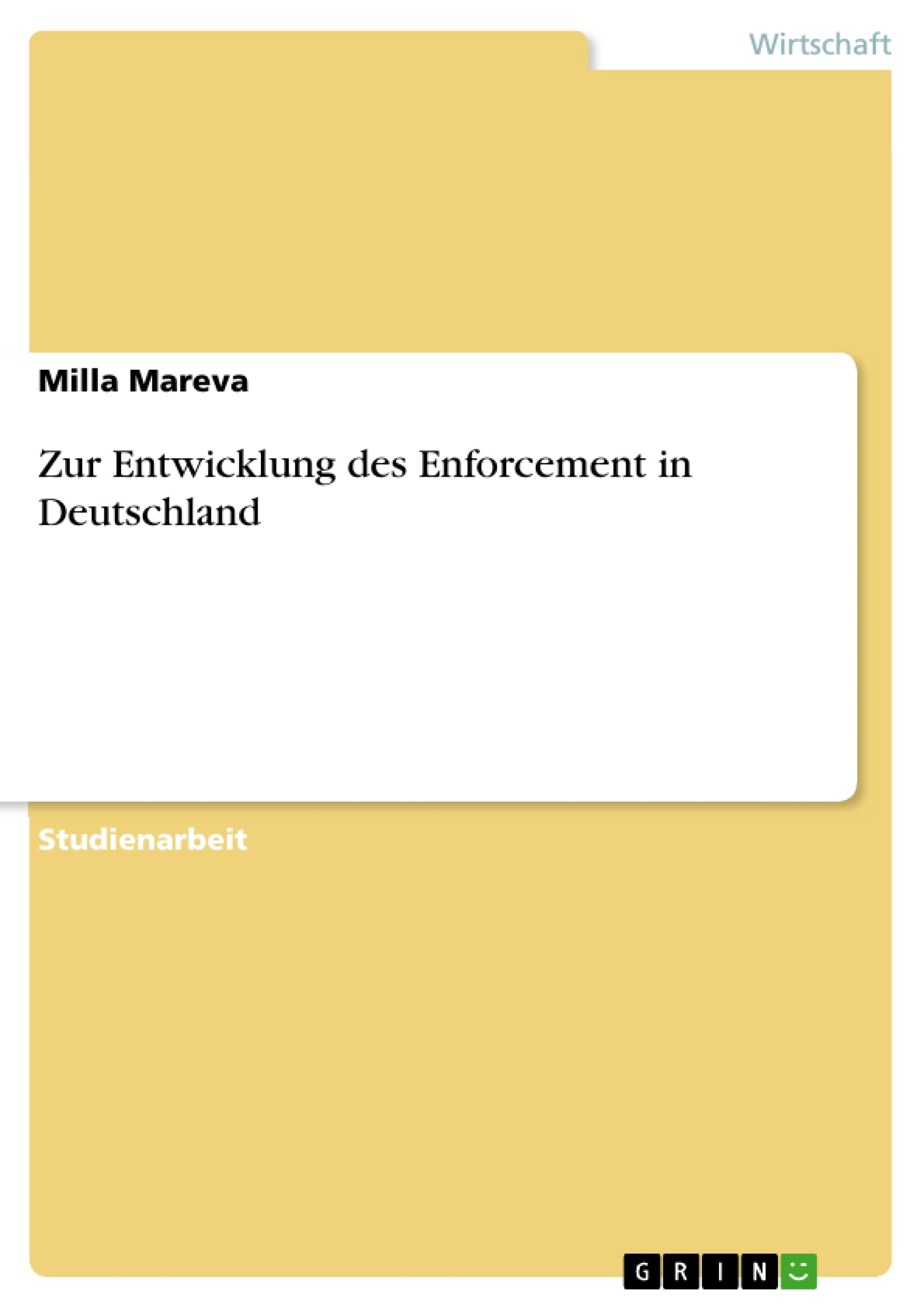In den letzten Jahren ist das Vertrauen der Aktionäre hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von Unternehmensinformationen als Folge zahlreicher Bilanzskandale (z.B. der Konkurs von US-amerikanischem Worldcom mit über 100 Mrd. US-Dollar Schuldenvolumen und der Niedergang von Enron mit über 30 Mrd. US-Dollar Schulden (1) oder der Fall des italienischen Molkereikonzerns Parmalat (2)) erheblich gesunken oder sogar vollständig verschwunden. Damit scheint sich die Reihe der Bilanzmanipulationen fortzusetzen, die in der letzten Zeit auch in Deutschland das Vertrauen des Kapitalmarkts in die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung der Unternehmen tief erschüttert haben. Dieser Verlust resultiert zum einen daraus, dass oftmals innerhalb der bestehenden Rechnungslegungsnormen alle Auslegungsspielräume genutzt werden, um die tatsächliche wirtschaftliche Lage des Unternehmens durch bilanzpolitische Maßnahmen und/oder durch Sachverhaltsgestaltungen möglichst positiv darzustellen. Zum anderen sind in zahlreichen Fällen die Rechnungs- legungsvorschriften nicht ordnungsgemäß angewendet worden. Vor diesem Hintergrund ist am 26.11.2004 das Gesetz zur Kontrolle von Unternehmens- abschlüssen (Bilanzkontrollgesetz – BilKoG) im Bundesrat verabschiedet worden und mit der Veröffentlichung im BGBl am 20.12.2004 in Kraft getreten. (3) Zielsetzung dieses Gesetzes ist, das Vertrauen der Investoren in die Verlässlichkeit von Unternehmensabschlüssen und somit den Kapitalmarkt wiederherzustellen und wirksam zu stärken. Zur Zielerreichung wird nunmehr ein zweistufiges Enforcement-Modell in Deutschland etabliert. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das deutsche Enforcement-Modell eingehend vorzustellen und zu diskutieren. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob die vorgenommenen Gesetzesänderungen ein adäquates Mittel sind, das Vertrauen der Investoren in die Rechnungslegung zurückzugewinnen.
(1) Vgl. zu Hintergründen des Enron-Zusammenbruches Zimmermann, J., StuB 12/2002, S.573; weitere Schwächen von US-GAAP am Beispiel anderer Firmen zeigen Lüdenbach, N./Hoffmann, W.-D., DB 23/2002, S.1169
(2) Einen Überblick über die durch Bilanzdelikte hervorgerufenen Vertrauensschäden und auch Vermögensschäden geben Ballwieser, W./Dobler, M., Die Unternehmung 6/2003, S.450
(3) Vgl. im Überblick Zülch, H., StuB 21/2004, S.975
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung und Problemstellung
- II. Das deutsche Enforcement-Modell
- 1. Grundlegende Anforderungen an ein funktionsfähiges Enforcement
- 1.1 Personelle und finanzielle Ausgestaltung der Enforcement-Institution
- 1.2 Organisation und Struktur der Prüfung von Unternehmensabschlüssen
- 1.3 Sanktionierungsmöglichkeiten
- 2. Normdurchsetzung nach dem Vorbild ausländischer Institutionen: SEC und FRRP
- 3. Zweistufiges Enforcement-Modell zur Stärkung des deutschen Kapitalmarktes
- 3.1 Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)
- 3.2 Prüfungsgegenstand und -umfang
- 3.3 Reaktive versus proaktive Prüfung
- 3.4 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als staatliche Instanz
- 3.5 Kosten der Prüfstelle
- 3.6 Zwischenergebnis
- III. Die Wirkungskraft des deutschen Enforcement-Modells auf Rechnungslegung und Abschlussprüfung
- IV. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Enforcement in Deutschland und beleuchtet insbesondere die Einführung des zweistufigen Enforcement-Modells mit der Gründung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Ziel ist es, die Auswirkungen des Modells auf die Rechnungslegung und Abschlussprüfung zu untersuchen und die Wirksamkeit des Modells bei der Wiederherstellung des Vertrauens in die Verlässlichkeit von Unternehmensabschlüssen zu bewerten.
- Entwicklung des Enforcement in Deutschland
- Einführung des zweistufigen Enforcement-Modells
- Rolle der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)
- Auswirkungen auf die Rechnungslegung und Abschlussprüfung
- Bewertung der Wirksamkeit des Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Einleitung und Problemstellung
Dieses Kapitel erläutert die Problematik des Vertrauensverlustes in die Glaubwürdigkeit von Unternehmensinformationen aufgrund zahlreicher Bilanzskandale. Es wird auf die Notwendigkeit einer effektiven Überwachung der Rechnungslegungsinformationen hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der IAS/IFRS.
Kapitel II: Das deutsche Enforcement-Modell
Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Anforderungen an ein funktionsfähiges Enforcement, darunter personelle und finanzielle Ressourcen, die Organisation der Prüfung von Unternehmensabschlüssen und die Sanktionierungsmöglichkeiten. Es beleuchtet auch die Normdurchsetzung nach dem Vorbild ausländischer Institutionen wie SEC und FRRP. Schließlich wird das zweistufige Enforcement-Modell mit der Gründung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) vorgestellt.
Kapitel III: Die Wirkungskraft des deutschen Enforcement-Modells auf Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des zweistufigen Enforcement-Modells auf die Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Es untersucht die Rolle der DPR bei der Überwachung der Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften und die Auswirkungen auf die Qualität der Finanzberichterstattung.
Schlüsselwörter
Enforcement, Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Bilanzskandale, Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), zweistufiges Enforcement-Modell, Vertrauen, Kapitalmarkt, IAS/IFRS, Finanzberichterstattung.
- Quote paper
- Milla Mareva (Author), 2006, Zur Entwicklung des Enforcement in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141529