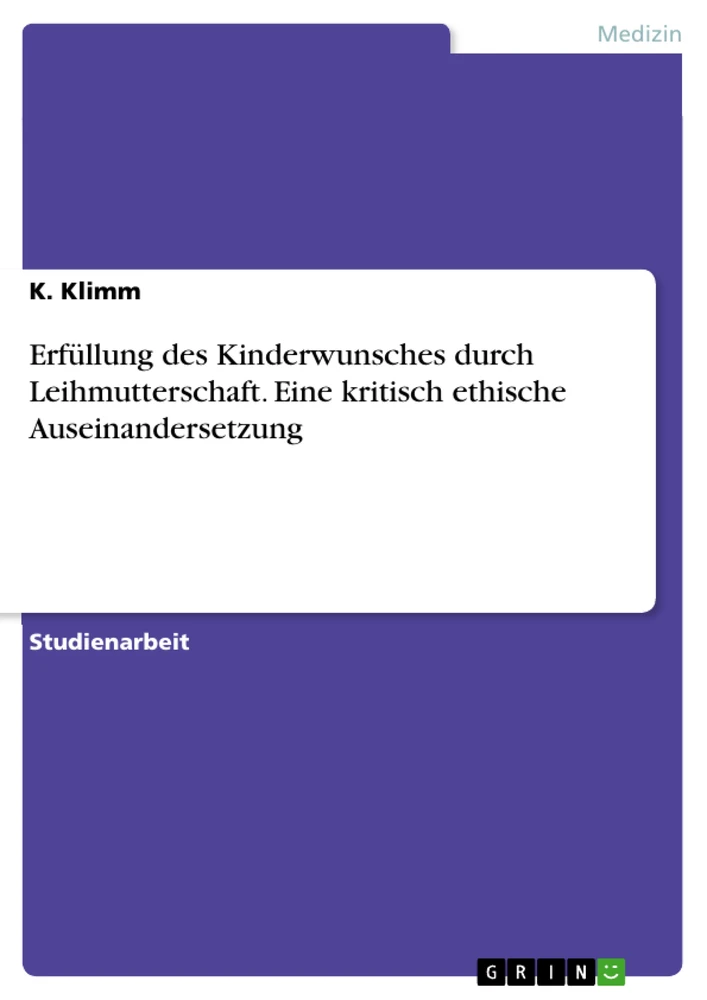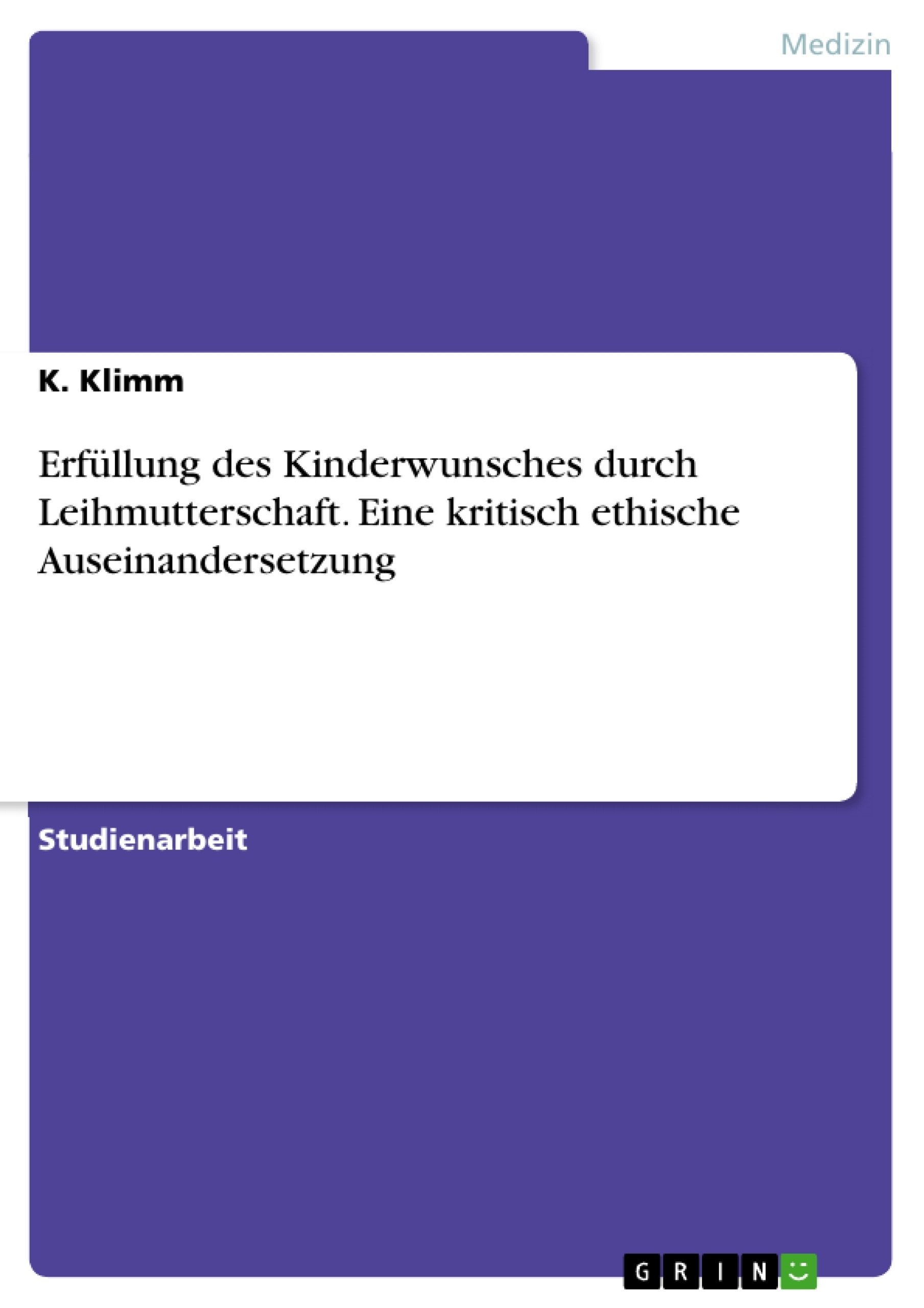In dieser Hausarbeit wird sich allgemein mit der Leihmutterschaft befasst. Dabei wird sich auf folgende Frage fokussiert: "Inwiefern ist es ethisch vertretbar, Paaren den unerfüllten Kinderwunsch durch die Methode der Leihmutterschaft zu erfüllen?" Es wird die Leihmutterschaft kritisch aus ethischer Sicht betrachtet und versucht, eine Antwort auf diese Fragestellung in der Literatur zu finden.
Das erste Kapitel befasst sich mit allgemeinen Informationen zum Thema Leihmutterschaft. Es wird darauf eingegangen, dass eine Leihmutter eine Frau ist, die ein Kind für die Wunscheltern austrägt, dabei werden unterschiedliche Formen sowie Motivationen unterschieden. Des Weiteren wird auf das Verbot in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz aufmerksam gemacht und in den internationalen Vergleich mit der rechtlichen Lage anderer Länder gestellt.
Im zweiten Kapitel wird die Leihmutterschaft durch die zwei ethischen Themen Autonomie und Zwang analysiert. Es wird deutlich gemacht, dass in vielen Ländern diese Art der Reproduktion viele negative Aspekte im Zusammenhang mit diesen ethisch diskutierten Themen hervorbringt, die teilweise jedoch aus einem anderen Kontext heraus entkräftet werden können.
Im dritten und abschließenden Kapitel wird darauf eingegangen, welche Motivatoren die Eltern besitzen und was Indikationen für sie sind, diese reproduktive Methode auszuüben trotz der Tatsache, dass die reproduktive Methode der Leihmutterschaft wie vorangegangen deutlich gemacht wurde ethisch und moralisch sehr umstritten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Leihmutterschaft
- Definition
- Die Rechtslage
- Die Rechtslage im Ausland
- Eine Ethische Analyse
- Autonomie
- Autonomie der Leihmütter
- Autonomie der Wunscheltern
- Zwang
- Ausbeutung und Instrumentalisierung
- Mögliche Instrumentalisierung der Kinder
- Autonomie
- Beweggründe zur Leihmutterschaft
- Indikationen
- Ausmaß des Reproduktionstourismus
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die ethische Vertretbarkeit der Leihmutterschaft als Methode zur Erfüllung des unerfüllten Kinderwunsches. Sie untersucht die komplexen rechtlichen und moralischen Aspekte dieser Praxis.
- Definition und Formen der Leihmutterschaft
- Rechtliche Aspekte der Leihmutterschaft in Deutschland und im internationalen Vergleich
- Ethische Bewertung unter den Gesichtspunkten von Autonomie und Zwang
- Motivationen und Indikationen für die Inanspruchnahme der Leihmutterschaft
- Der Einfluss des Reproduktionstourismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Leihmutterschaft ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der ethischen Vertretbarkeit dieser Methode zur Erfüllung des Kinderwunsches. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die in den einzelnen Kapiteln behandelten Aspekte. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Situation in Deutschland und dem damit verbundenen Reproduktionstourismus.
Die Leihmutterschaft: Dieses Kapitel definiert Leihmutterschaft in ihren verschiedenen Formen (vollumfängliche und teilweise Leihmutterschaft) und unterscheidet zwischen altruistischen und kommerziellen Motivationen. Es beleuchtet das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland aufgrund des Embryonenschutzgesetzes und vergleicht die Rechtslage mit der in anderen Ländern. Die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen und deren Auswirkungen auf Paare mit unerfülltem Kinderwunsch werden hervorgehoben, inklusive der damit verbundenen Risiken und ethischen Bedenken im Kontext des Reproduktionstourismus.
Eine Ethische Analyse: Dieses Kapitel analysiert die Leihmutterschaft unter den ethischen Gesichtspunkten von Autonomie und Zwang. Es untersucht die Autonomie der Leihmütter und der Wunscheltern, beleuchtet mögliche Aspekte der Ausbeutung und Instrumentalisierung der Leihmütter und die potenzielle Instrumentalisierung der Kinder. Die Diskussion der ethischen Dilemmata steht im Vordergrund, wobei verschiedene Perspektiven und potentielle Gegenargumente berücksichtigt werden.
Beweggründe zur Leihmutterschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit den Motiven und Indikationen, die Paare zur Inanspruchnahme der Leihmutterschaft trotz der ethischen und rechtlichen Bedenken bewegen. Es thematisiert das Ausmaß des internationalen Reproduktionstourismus und die damit verbundenen Herausforderungen. Die verschiedenen Faktoren, die zu dieser Entscheidung beitragen, werden beleuchtet und kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Leihmutterschaft, Reproduktionstourismus, Embryonenschutzgesetz, Autonomie, Zwang, Ausbeutung, Instrumentalisierung, Ethik, Moral, Kinderwunsch, Rechtslage, Deutschland, internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Ethische und Rechtliche Aspekte der Leihmutterschaft
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die ethische Vertretbarkeit der Leihmutterschaft als Methode zur Erfüllung des Kinderwunsches. Sie untersucht umfassend die rechtlichen und moralischen Aspekte dieser Praxis, inklusive Definitionen, Rechtslage im In- und Ausland, ethische Bewertung (Autonomie vs. Zwang), Beweggründe und den Einfluss des Reproduktionstourismus.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Formen der Leihmutterschaft, Rechtslage in Deutschland und international, ethische Bewertung unter den Gesichtspunkten von Autonomie und Zwang, Motivationen und Indikationen für Leihmutterschaft, und der Einfluss des Reproduktionstourismus.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Leihmutterschaft (Definition, Rechtslage), ein Kapitel zur ethischen Analyse (Autonomie, Zwang), ein Kapitel zu den Beweggründen zur Leihmutterschaft und einen Schluss. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Welche Rechtslage wird in der Hausarbeit betrachtet?
Die Hausarbeit beleuchtet die Rechtslage in Deutschland, insbesondere das Embryonenschutzgesetz und dessen Auswirkungen auf die Leihmutterschaft. Ein Vergleich mit der Rechtslage in anderen Ländern wird ebenfalls durchgeführt, um die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen und deren Konsequenzen zu verdeutlichen.
Welche ethischen Aspekte werden diskutiert?
Die ethische Analyse konzentriert sich auf die Autonomie der Leihmutter und der Wunscheltern. Mögliche Aspekte von Ausbeutung und Instrumentalisierung der Leihmütter und der Kinder werden kritisch untersucht. Verschiedene Perspektiven und Gegenargumente werden berücksichtigt.
Welche Beweggründe für die Inanspruchnahme von Leihmutterschaft werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Motivationen und Indikationen, die Paare zur Inanspruchnahme der Leihmutterschaft bewegen. Das Ausmaß des internationalen Reproduktionstourismus und die damit verbundenen Herausforderungen werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Leihmutterschaft, Reproduktionstourismus, Embryonenschutzgesetz, Autonomie, Zwang, Ausbeutung, Instrumentalisierung, Ethik, Moral, Kinderwunsch, Rechtslage, Deutschland, internationaler Vergleich.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Hausarbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse jedes Abschnitts hervorhebt.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für alle, die sich mit den ethischen und rechtlichen Aspekten der Leihmutterschaft auseinandersetzen möchten, sei es aus akademischer, juristischer oder ethischer Perspektive.
- Quote paper
- K. Klimm (Author), 2022, Erfüllung des Kinderwunsches durch Leihmutterschaft. Eine kritisch ethische Auseinandersetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1414382