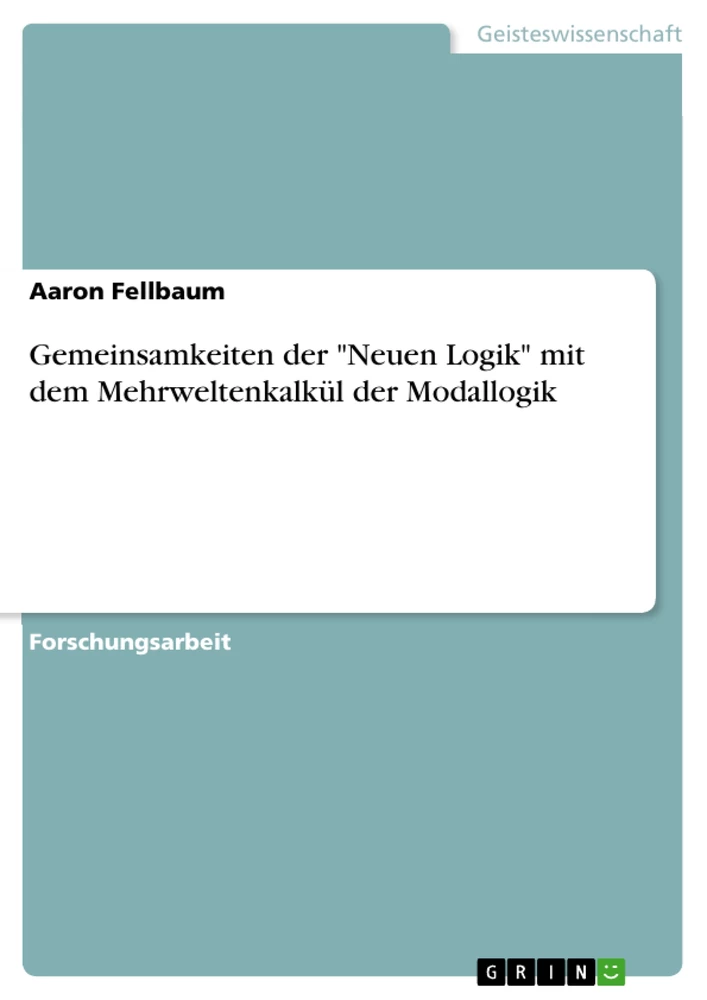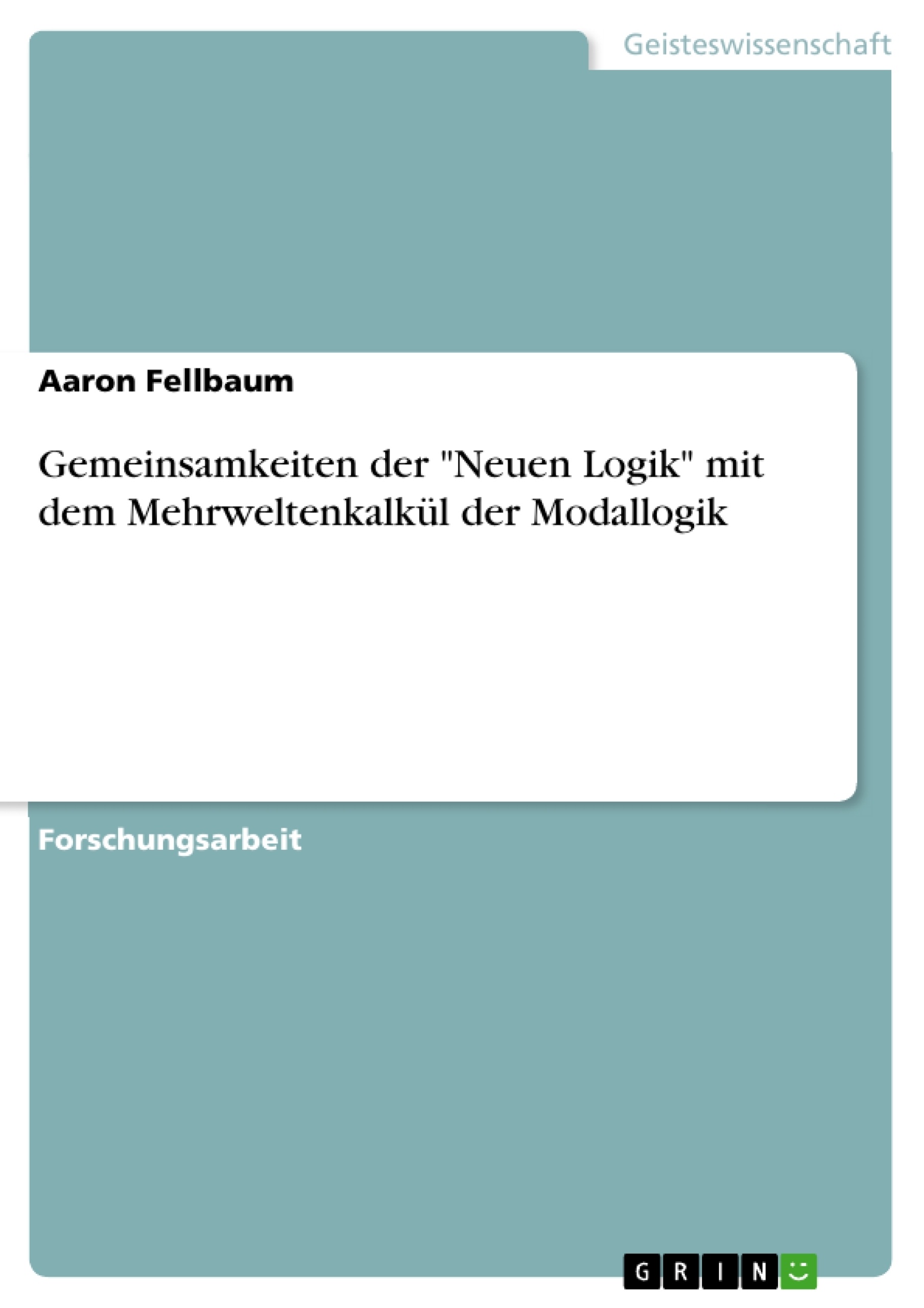Dieser Text beschäftigt sich mit der Entwicklung der Logik und der Einführung von Modallogik, insbesondere seit Gottlob Frege. Während die klassische Logik sich auf die Subsumption unter Begriffe stützte und von sinnlich Wahrnehmbarem abstrahierte, führte die "neue Logik" und die Modallogik zu einer neuen Ontologie. Diese Ontologie beruht nicht mehr auf sinnlicher Anschauung, sondern auf der Errechenbarkeit aus gegebenen Regeln. Trotzdem wird die begriffliche Vorstellung von möglicher Wirklichkeit aufrechterhalten. Die "neue Logik" und die Modallogik ähneln sich in dieser Hinsicht.
Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung der logischen Richtigkeit und der begrifflichen Fassung von Gewissheit, die in der Modallogik eine Rolle spielen. Es wird hervorgehoben, dass logisch Richtiges auch möglich sein muss, da es sonst zu sinnlosen Sätzen führt. Die syntaktische Richtigkeit hängt von der möglichen Zuordnung zur materiellen Wirklichkeit ab, die nicht notwendigerweise der sinnlichen Anschauung entsprechen muss. Die Modallogik erweitert die traditionelle Logik, indem sie verschiedene Grade der Möglichkeit und Notwendigkeit in den Betrachtungen berücksichtigt.
Der Text geht auf verschiedene Konzepte von Möglichkeit und die klassische Logik als ideale Wissenschaft des Möglichen ein. Die klassische Logik stellt das Logisch Richtige als Vision gegenüber dem faktischen Zustand der Welt und dient als Richtschnur für normatives Denken und zukünftige Entwicklungen. Die Modallogik hebt sich jedoch ab, indem sie den Begriff der Möglichkeit anders behandelt. "Gegeben p" und "Möglicherweise gegeben p" sind in der Modallogik unterschiedliche Konzepte, die sich nicht nur durch den Grad der Gegebenheit in unserer Welt unterscheiden. Die Modallogik behandelt "Es ist möglich dass ..." oder "Es ist notwendig, dass ..." als begriffliche Ausdrücke, um Gewissheit auszudrücken, die weniger als Wahrheit oder absolute Gewissheit ist. Die Modallogik ermöglicht die Darstellung von Aussagen in einer logischen Form. Es handelt sich nicht um Wahrheit oder Falschheit im klassischen Sinne, sondern um die Möglichkeit und Notwendigkeit von Aussagen in einer logischen Struktur.
Inhaltsverzeichnis
- Gemeinsamkeiten der „Neuen Logik“ mit dem Mehrweltenkalkül der Modallogik
- Verschiedene Begriffe von „Möglichkeit“ und die klassische Logik als eine ideale Wissenschaft des Möglichen
- Modallogik als epistemische Gewissheit
- Ontologische Unterschiede zwischen Modallogik und klassischer Logik
- Platzierung der Modallogik in Bezug auf andere Logiken
- Quines Einwand gegen eine quantifizierte Modallogik
- Gemeinsamkeiten von „Modallogik“ und „Neuer Logik“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht die Gemeinsamkeiten zwischen der „Neuen Logik“, beginnend mit Gottlob Frege und Bertrand Russell, und dem Mehrweltenkalkül der Modallogik. Die Arbeit analysiert die ontologischen Unterschiede zwischen diesen Logiken und der klassischen Logik, fokussiert auf den Möglichkeitsbegriff und die epistemischen Aspekte der Modallogik.
- Vergleich der „Neuen Logik“ und der Modallogik
- Analyse des Möglichkeitsbegriffs in verschiedenen Logiksystemen
- Untersuchung der ontologischen Grundlagen der Modallogik
- Bewertung der epistemischen Aspekte der Modallogik
- Diskussion von Quines Einwand gegen quantifizierte Modallogik
Zusammenfassung der Kapitel
Gemeinsamkeiten der „Neuen Logik“ mit dem Mehrweltenkalkül der Modallogik: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gemeinsamkeiten zwischen der "Neuen Logik" und der Modallogik dar. Sie hebt den Paradigmenwechsel von der Subsumption unter Begriffe hin zur Errechenbarkeit aus Regeln hervor, der sowohl für die "Neue Logik" als auch die Modallogik charakteristisch ist. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der ontologischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten an, die sich aus dem Verzicht auf sinnliche Anschauung und der Fokussierung auf logische Räume ergeben.
Verschiedene Begriffe von „Möglichkeit“ und die klassische Logik als eine ideale Wissenschaft des Möglichen: Dieses Kapitel vertieft den Unterschied zwischen dem Möglichkeitsbegriff in der klassischen Logik und der Modallogik. Während die klassische Logik das logisch Richtige als Ideal für den Zustand der Wirklichkeit betrachtet, konzentriert sich die Modallogik auf die begriffliche Fassung einer geringeren Gewissheit als die absolute Wahrheit. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Sätzen wie "Es ist möglich, dass..." oder "Es ist notwendig, dass..." in logischer Form, ohne direkten Bezug auf die empirische Welt. Die klassische Logik wird als wahrheitsfunktional beschrieben, im Gegensatz zur Modallogik.
Modallogik als epistemische Gewissheit: Dieses Kapitel argumentiert, dass Modallogik vorwiegend ein epistemisches Anliegen verfolgt, das sich auf die Konsistenzprüfung logischer Sätze konzentriert. Die Wahrscheinlichkeit wird als ein wichtiger Aspekt diskutiert, der zwischen absoluter Gewissheit und Nichtwissen verschiedene Grade zulässt. Im Gegensatz zur klassischen Logik, die sich mit dem (möglichen) Gegebensein in der Welt befasst, konzentriert sich die Modallogik auf die Gegebenheit im "logischen Raum". Dieser Unterschied wird als ontologisch relevant dargestellt.
Ontologische Unterschiede zwischen Modallogik und klassischer Logik: Das Kapitel vertieft die ontologischen Unterschiede zwischen Modallogik und klassischer Logik. Es wird erklärt, wie die Modallogik von einer Dinglogik zu einer Satzlogik übergeht, wobei die Wahrheit oder Falschheit von Sätzen nicht mehr von sinnlich Angeschautem abhängt, sondern von Beziehungen zwischen Sprachen (Objektsprachen und Metasprachen). Die rekursive Wahrheitstheorie von Alfred Tarski wird als Grundlage für die Modallogik diskutiert, welche die Abstraktion von Angeschautem irrelevant macht.
Platzierung der Modallogik in Bezug auf andere Logiken: Dieses Kapitel positioniert die Modallogik im Verhältnis zur Aussagenlogik und Prädikatenlogik. Die Aussagenlogik bezieht sich auf feste Gegebenheiten in der wirklichen Welt, während die Prädikatenlogik Annahmen über diese Welt macht. Die Modallogik hingegen wird als ein Kalkül der Wahrscheinlichkeiten beschrieben, der keine Annahmen über den idealen Zustand der Welt trifft, sondern sich auf epistemische Sachverhalte konzentriert.
Quines Einwand gegen eine quantifizierte Modallogik: Dieses Kapitel behandelt Quines Kritik an quantifizierter Modallogik, derzufolge die Einführung von Modalquantoren den Wahrheitswert unkontrolliert verändern kann. Quines Argument zielt auf die Unzuverlässigkeit des Modaloperators bezüglich der Wahrheitsfunktionalität ab, da die Ersetzung von co-designativen Termini nicht immer den Wahrheitswert erhält.
Gemeinsamkeiten von „Modallogik“ und „Neuer Logik“: Dieses Kapitel schließt mit einem Vergleich der Modallogik und der "Neuen Logik" nach Rudolf Carnap. Beide Systeme verzichten auf die sinnlich anschauliche Basis des Erkennens, was zu ähnlichen Einwänden wie denen gegen die "Neue Logik" seit Frege führt. Die Diskussion beleuchtet die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Sinnlichkeit als Erkenntnisquelle und der Notwendigkeit, den Unterschied zwischen Logischem und Faktischem zu erhalten.
Schlüsselwörter
Modallogik, Neue Logik, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Mehrweltenkalkül, Möglichkeit, Notwendigkeit, Wahrheitsfunktionalität, Epistemologie, Ontologie, Quines Einwand, klassische Logik, Alfred Tarski, Saul Kripke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gemeinsamkeiten der „Neuen Logik“ mit dem Mehrweltenkalkül der Modallogik
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der „Neuen Logik“ (Frege, Russell) und dem Mehrweltenkalkül der Modallogik. Im Fokus stehen der Möglichkeitsbegriff, ontologische und epistemische Aspekte beider Logiken sowie Quines Kritik an quantifizierter Modallogik.
Welche Logiksysteme werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die „Neue Logik“, die klassische Logik und die Modallogik (insbesondere den Mehrweltenkalkül). Der Vergleich konzentriert sich auf die ontologischen Grundlagen und den Umgang mit dem Begriff der Möglichkeit.
Wie wird der Möglichkeitsbegriff in den verschiedenen Logiksystemen behandelt?
Die klassische Logik betrachtet das logisch Richtige als Ideal der Wirklichkeit. Die Modallogik hingegen befasst sich mit verschiedenen Graden der Gewissheit ("möglich", "notwendig"), ohne direkten Bezug auf die empirische Welt. Die Arbeit analysiert diese unterschiedlichen Zugänge zum Möglichkeitsbegriff.
Welche ontologischen Unterschiede bestehen zwischen Modallogik und klassischer Logik?
Die Modallogik wird als Satzlogik beschrieben, die im Gegensatz zur klassischen Logik (Dinglogik) die Wahrheit von Sätzen nicht von sinnlich Angeschautem abhängig macht, sondern von Beziehungen zwischen Sprachen (Objektsprachen und Metasprachen). Die rekursive Wahrheitstheorie von Tarski spielt hierbei eine Rolle.
Welche epistemischen Aspekte der Modallogik werden untersucht?
Die Arbeit argumentiert, dass die Modallogik ein epistemisches Anliegen verfolgt, das sich auf die Konsistenzprüfung logischer Sätze und die Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten konzentriert. Im Gegensatz zur klassischen Logik, die sich mit dem Gegebensein in der Welt befasst, konzentriert sich die Modallogik auf die Gegebenheit im „logischen Raum“.
Wie wird Quines Kritik an quantifizierter Modallogik behandelt?
Die Arbeit diskutiert Quines Einwand, dass die Einführung von Modalquantoren den Wahrheitswert unkontrolliert verändern kann, da die Ersetzung von co-designativen Termini nicht immer den Wahrheitswert erhält. Quines Argument zielt auf die Unzuverlässigkeit des Modaloperators bezüglich der Wahrheitsfunktionalität ab.
Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen „Modallogik“ und „Neuer Logik“?
Beide Systeme verzichten auf eine sinnlich anschauliche Basis des Erkennens. Die Arbeit untersucht die daraus resultierenden Gemeinsamkeiten und die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Sinnlichkeit als Erkenntnisquelle und dem Unterschied zwischen Logischem und Faktischem.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Modallogik, Neue Logik, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Mehrweltenkalkül, Möglichkeit, Notwendigkeit, Wahrheitsfunktionalität, Epistemologie, Ontologie, Quines Einwand, klassische Logik, Alfred Tarski, Saul Kripke.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitel zu den Gemeinsamkeiten von „Neuer Logik“ und Modallogik, verschiedenen Möglichkeitsbegriffen, Modallogik als epistemische Gewissheit, ontologischen Unterschieden, der Platzierung der Modallogik im Verhältnis zu anderen Logiken, Quines Einwand und abschließend den Gemeinsamkeiten von „Modallogik“ und „Neuer Logik“.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnten Sie einen Link zu der vollständigen Arbeit einfügen, falls verfügbar)
- Quote paper
- Aaron Fellbaum (Author), 2023, Gemeinsamkeiten der "Neuen Logik" mit dem Mehrweltenkalkül der Modallogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1414030