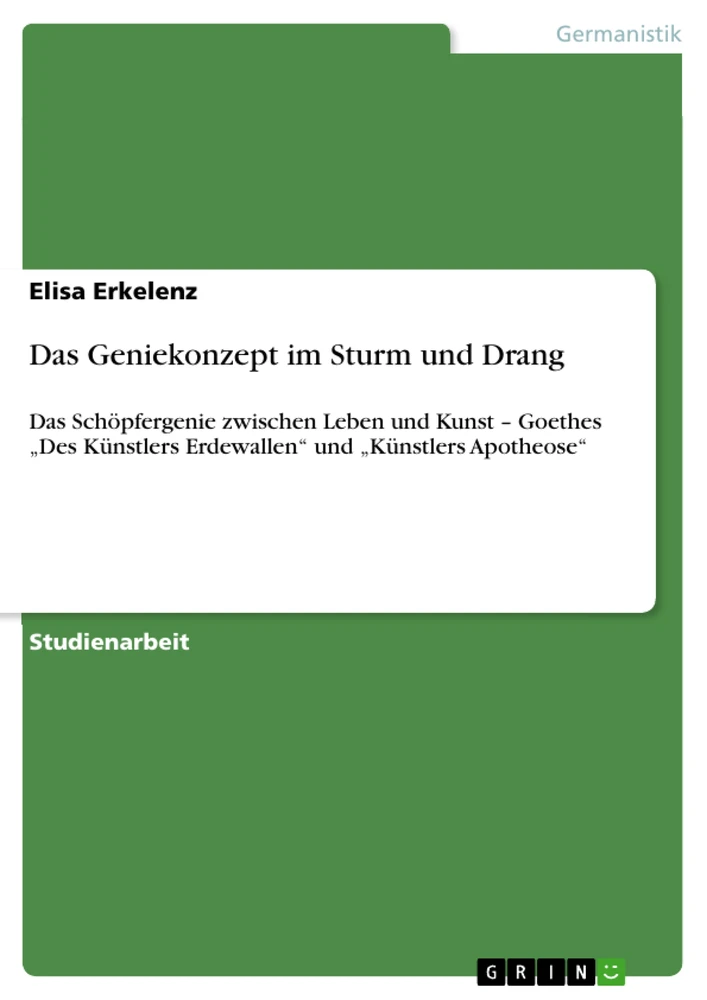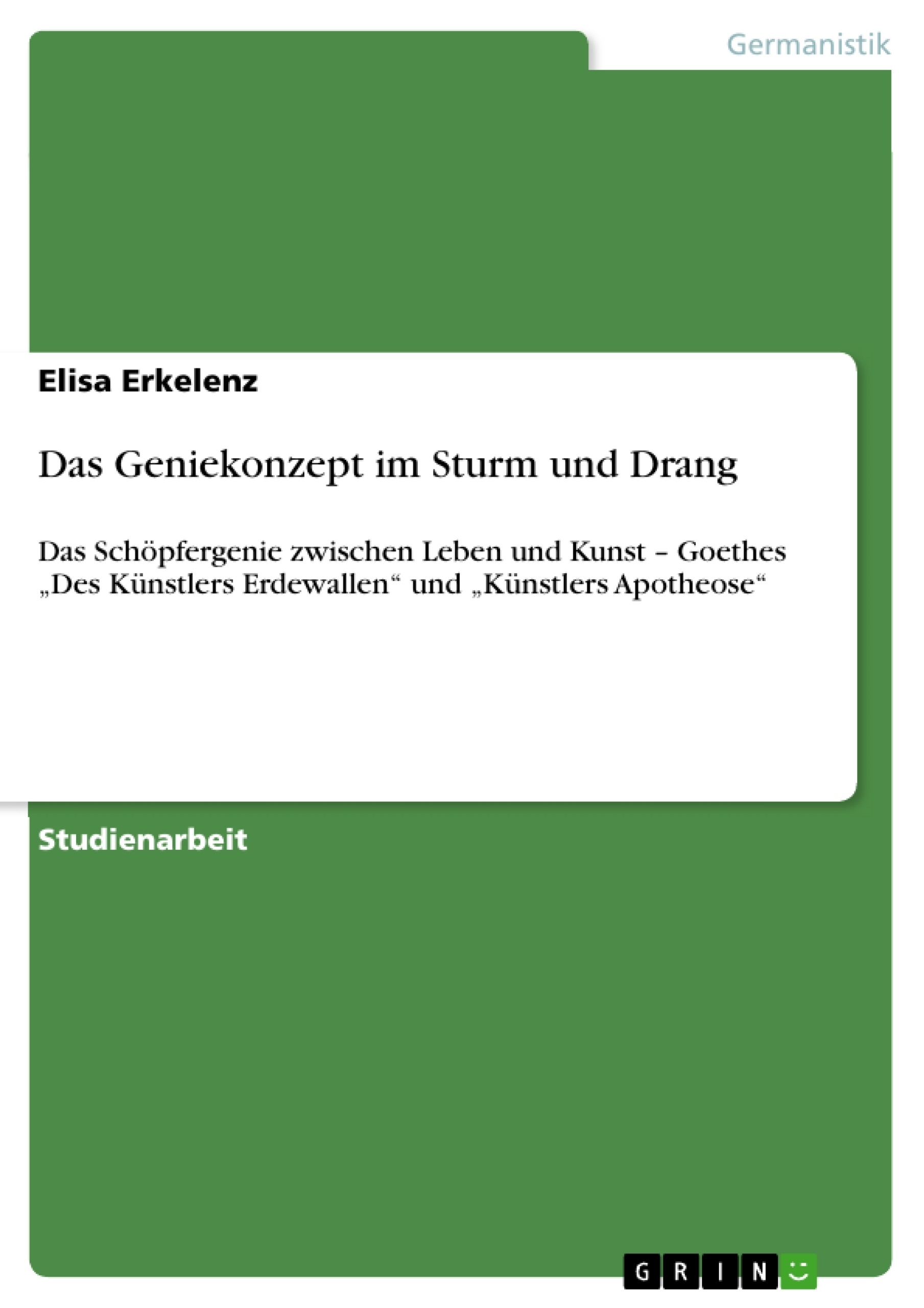In keiner literarischen Epoche wird der Künstler derart vergöttert wie im Sturm und Drang. Der literarische Geniekult erfährt hier seinen Höhepunkt: Der Künstler wird zum gottgleichen Schöpfergenius erhoben. Goethes Künstlerdramolette „Des Künstlers Erdewallen“ und „Künstlers Apotheose“ zeichnen jedoch ein anderes Tableau der Situation des Künstlers zu dieser Zeit. In vorliegender Arbeit soll vor dem Hintergrund der theoretischen Konzeption des Künstlers in der Geniezeit untersucht werden, welche Auswirkungen die Vergötterung des Künstlers auf das Leben desselben hatte und welche Konfliktpotenziale daraus entstanden.
In diesem Sinne erfolgt zunächst eine Darstellung der Geniekonzeption im Sturm und Drang. Anhand des Kurzdramas „Des Künstlers Erdewallen“ soll im Anschluss daran die irdische Realität des Künstlers untersucht werden. Auch wenn es sich hier zunächst um eine ‚literarische Realität’ handelt, gelten Künstlerdramen durch ihr subjektives Moment als besonders geeignet, ein bestimmtes Zeitalter und den Standpunkt des Künstlers der Welt gegenüber abzubilden. Dem Aufbau als Stationendrama folgend schließt die Arbeit mit der Analyse von „Künstlers Apotheose“, dem 1788 erschienenen Pendant zu „Des Künstlers Erdewallen“, in dem der Künstler aus der Jenseitsperspektive erscheint. Ziel der Arbeit ist es, textnah der Frage nachzugehen, inwiefern die Sakralisierung der Kunst sich auf das Leben des Künstlers ausgewirkt hat und ob die Erhebung des Künstlers zum Genie nicht vielmehr zu einem Konflikt zwischen Kunst und Leben geführt hat, dessen Tragik das soziale Umfeld des Künstlers nicht zu erkennen vermochte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Thema und Vorgehensweise
- II. Die Disproportion des Genies mit dem Leben: Der Künstler im Sturm und Drang
- 1. Geniekonzept im Sturm und Drang: Der Künstler als Schöpfer
- 2. Die irdischen Klagen des Künstlers in „Des Künstlers Erdewallen“
- 3. Die posthume Anerkennung des Genies in „Des Künstlers Vergötterung“ und „Künstlers Apotheose“
- III. Ergebniszusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Vergötterung des Künstlers im Sturm und Drang auf dessen Leben und die daraus resultierenden Konflikte. Sie analysiert Goethes Künstlerdramolette „Des Künstlers Erdewallen“ und „Künstlers Apotheose“ vor dem Hintergrund der theoretischen Konzeption des Künstlers als Genie. Die Arbeit geht der Frage nach, inwiefern die Sakralisierung der Kunst das Leben des Künstlers beeinflusste und ob die Erhebung zum Genie zu einem Konflikt zwischen Kunst und Leben führte.
- Das Geniekonzept im Sturm und Drang und die Rolle des Künstlers als Schöpfer
- Die irdischen Herausforderungen und Leiden des Künstlers
- Der Konflikt zwischen Kunst und Leben
- Die posthume Anerkennung des Genies
- Die soziale Wahrnehmung des Künstlers und seiner Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Thema und Vorgehensweise: Die Einleitung skizziert das zentrale Thema der Arbeit: die Diskrepanz zwischen der idealisierten Vorstellung des Künstlers als gottgleiches Genie im Sturm und Drang und der Realität seines Lebens. Sie beschreibt die methodische Vorgehensweise, die die Analyse der Geniekonzeption im Sturm und Drang mit einer textnahen Untersuchung von Goethes „Des Künstlers Erdewallen“ und „Künstlers Apotheose“ verbindet. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen der Vergötterung der Kunst auf das Leben des Künstlers und der daraus entstehenden Konflikte. Die Arbeit verfolgt die These, dass die Erhebung des Künstlers zum Genie zu einem tragischen Konflikt zwischen Kunst und Leben führte, der von seinem sozialen Umfeld oft nicht erkannt wurde.
II. Die Disproportion des Genies mit dem Leben: Der Künstler im Sturm und Drang: Dieses Kapitel untersucht die Diskrepanz zwischen der idealisierten Vorstellung des Künstlers als Genie und seiner realen Lebenssituation im Sturm und Drang. Es beginnt mit einer Darstellung des Geniekonzepts dieser Epoche, in dem der Künstler als gottgleicher Schöpfer dargestellt wird, vergleichbar mit Prometheus. Anschließend analysiert es Goethes „Des Künstlers Erdewallen“, um die irdischen Klagen und die soziale Situation des Künstlers zu beleuchten. Es wird argumentiert, dass Künstlerdramen aufgrund ihres subjektiven Charakters besonders geeignet sind, die Sichtweise des Künstlers auf die Welt widerzuspiegeln. Das Kapitel endet mit einem Ausblick auf die Analyse von „Künstlers Apotheose“, um die Perspektive des Künstlers aus der Jenseitsperspektive zu betrachten und die Frage nach dem Einfluss der Sakralisierung der Kunst auf das Leben des Künstlers zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Tragik des Konflikts zwischen Kunst und Leben, die oft vom sozialen Umfeld des Künstlers nicht erkannt wird.
Schlüsselwörter
Sturm und Drang, Geniekonzept, Künstlerdrama, Goethe, „Des Künstlers Erdewallen“, „Künstlers Apotheose“, Kunst und Leben, Konfliktpotenziale, soziale Emanzipation, Schöpfergenie, posthume Anerkennung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Diskrepanz zwischen Genie-Ideal und Lebensrealität des Künstlers im Sturm und Drang
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen der idealisierten Vorstellung des Künstlers als Genie im Sturm und Drang und den Realitäten seines Lebens. Sie analysiert, wie die Vergötterung des Künstlers dessen Leben beeinflusste und zu Konflikten führte. Im Fokus stehen Goethes Künstlerdramolette „Des Künstlers Erdewallen“ und „Künstlers Apotheose“.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert die Analyse des Geniekonzepts im Sturm und Drang mit einer textnahen Interpretation von Goethes „Des Künstlers Erdewallen“ und „Künstlers Apotheose“. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen der Vergötterung der Kunst auf das Leben des Künstlers und der daraus resultierenden Konflikte.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind das Geniekonzept des Sturm und Drang, die Rolle des Künstlers als Schöpfer, die irdischen Herausforderungen und Leiden des Künstlers, der Konflikt zwischen Kunst und Leben, die posthume Anerkennung des Genies und die soziale Wahrnehmung des Künstlers und seiner Konflikte.
Welche Rolle spielt Goethes „Des Künstlers Erdewallen“ und „Künstlers Apotheose“ in der Analyse?
Goethes Dramolette dienen als Fallstudien zur Untersuchung der Diskrepanz zwischen Genie-Ideal und Lebensrealität. „Des Künstlers Erdewallen“ beleuchtet die irdischen Klagen und die soziale Situation des Künstlers, während „Künstlers Apotheose“ die Perspektive des Künstlers aus der Jenseitsperspektive betrachtet.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt die These, dass die Erhebung des Künstlers zum Genie zu einem tragischen Konflikt zwischen Kunst und Leben führte, der oft vom sozialen Umfeld nicht erkannt wurde.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Sturm und Drang, Geniekonzept, Künstlerdrama, Goethe, „Des Künstlers Erdewallen“, „Künstlers Apotheose“, Kunst und Leben, Konfliktpotenziale, soziale Emanzipation, Schöpfergenie und posthume Anerkennung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel I beschreibt Thema und Vorgehensweise. Kapitel II analysiert die Disproportion zwischen Genie und Leben anhand von Goethes Dramoletten. Kapitel III fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Erkenntnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert Erkenntnisse über die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem idealisierten Bild des Künstlers als Genie und den Herausforderungen seines realen Lebens im Sturm und Drang. Sie zeigt auf, wie die Vergötterung der Kunst zu inneren Konflikten und sozialer Isolation führen konnte.
- Quote paper
- Elisa Erkelenz (Author), 2008, Das Geniekonzept im Sturm und Drang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141174