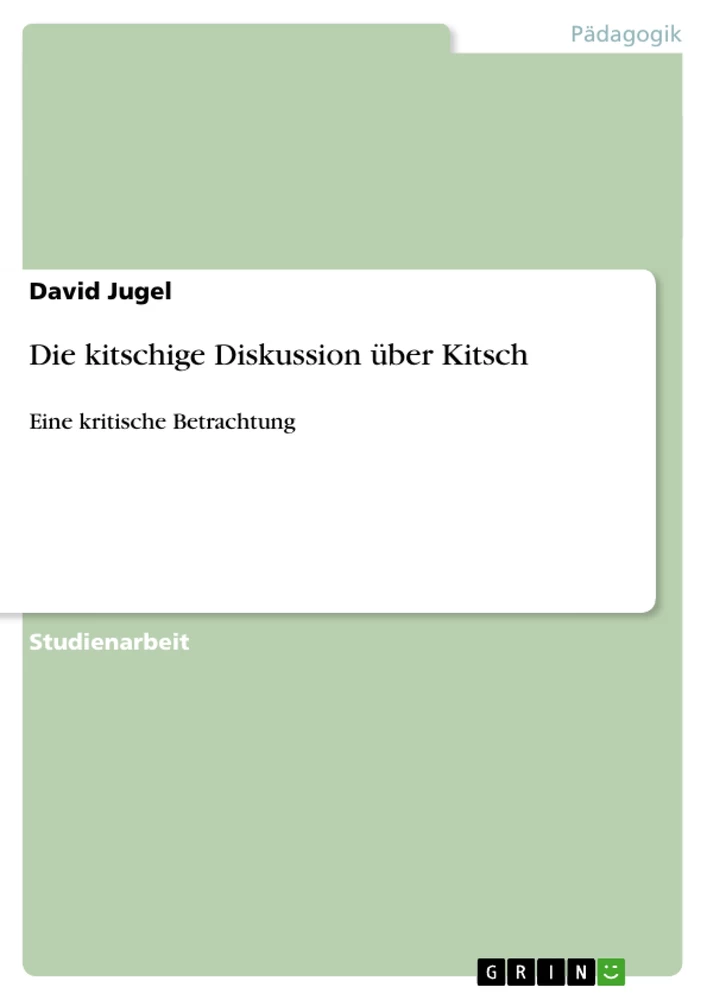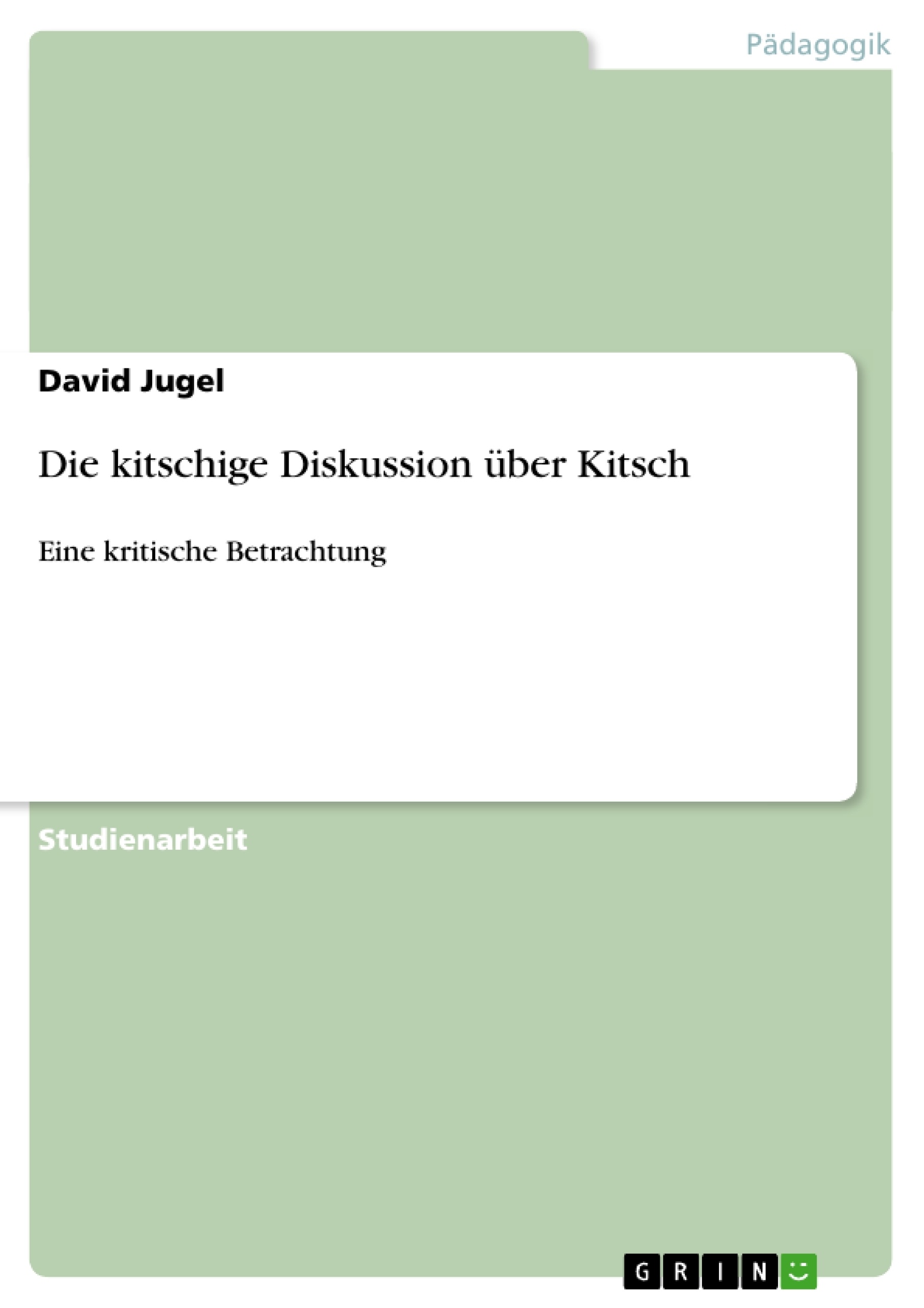Beschäftigt man sich mit dem Gegenstand Kitsch, strömt eine Fülle von Ansichten, Werken, Deutungen und Distinktionsversuchen auf den Beobachter ein. Wenn wir aber im Alltag von „Kitsch“ sprechen, schnellen augenblicklich Assoziationen in das menschliche Bewusstsein und das Wort wird vom Sprecher wie auch vom Hörer als ähnlich assoziierter Begriff hingenommen. Die Spannung, welche jedoch zwischen Wort und Begriff herrscht, wird deutlich auf der Suche nach einer Definition. Dieser Aufgabe stellt sich die vorliegende Arbeit. Dabei geht sie nicht rekursiv vor, indem sie Kitsch auf Eigenschaften reduziert, welche solche Gegenstände aufweisen, die als Kitsch deklariert sind. Vielmehr ist sie eine kritische und konstruktive Betrachtung des Untersuchungsfeldes, aus dem sie die Prozesse und Deutungsmuster von Kitsch abzuleiten versucht. Abschließend stellt der Autor anhand der Schlüsse dieser Betrachtung die Sinnhaftigkeit des Untersuchungsfeld per se in Frage, ohne dabei das Feld inhaltlich zu verlassen
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Etymologie und die Problematik der Definition – eine Diskussion
- 3. Die Interdependenz von Kitsch und Kunst und der gewagte Versuch einer Definition
- 4. Kitsch als Deutungsprozess und der Einzug des Kitsches in die Welt der Kunst
- 5. Warum die wissenschaftliche Diskussion über Kitsch beendet werden sollte (k)eine Schlussbetrachtung?
- 6. Literaturnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht kritisch den Begriff „Kitsch“ und die anhaltende Diskussion um seine Definition und Abgrenzung von Kunst. Sie geht über rein beschreibende Ansätze hinaus und analysiert die Zusammenhänge zwischen Kitsch und Kunst sowie die historischen und kulturellen Kontexte seiner Entstehung und Rezeption.
- Etymologie und Definitionsproblematik des Begriffs „Kitsch“
- Die Beziehung zwischen Kitsch und Kunst
- Kitsch als Deutungsprozess und seine Präsenz in der Kunstwelt
- Kritik an der anhaltenden wissenschaftlichen Diskussion über Kitsch
- Produktions-, objekt- und rezeptionsorientierte Betrachtungsweisen von Kitsch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Definition und dem Wesen von Kitsch. Sie kritisiert den gängigen Ansatz, Kitsch anhand von Objekten zu definieren, und kündigt eine kritische und konstruktive Betrachtung des Themas an. Der Fokus liegt auf der Analyse der Zusammenhänge und Abhängigkeiten, in denen sich Kitsch befindet, um eine eigene Definition zu entwickeln und die Notwendigkeit der anhaltenden Debatte zu hinterfragen. Die Arbeit bezieht sich auf die Thesen von Umberto Eco, Severin Zebhauser, Andreas Dörner und Ludgera Vogt, hebt aber gleichzeitig ihren Anspruch auf eine individuelle Argumentationsstruktur und Schlussfolgerung hervor.
2. Etymologie und die Problematik der Definition - eine Diskussion: Dieses Kapitel beleuchtet die etymologische Herkunft des Begriffs „Kitsch“ und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Definition. Die Unsicherheit über den Ursprung des Wortes (möglicherweise aus dem süddeutschen „kitschen“ oder dem englischen „sketch“) spiegelt die Vielfältigkeit der Interpretationen wider. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition von Kitsch vorgestellt, darunter produktions-, distributions-, objekt- und rezeptionsorientierte Perspektiven. Die Arbeit zeigt, dass massenhafte Produktion allein kein ausreichendes Kriterium für Kitsch ist, da auch klassische Kunstwerke massenhaft verbreitet wurden. Die Diskussion über die Objektorientrierung von Kitsch führt zu der Schlussfolgerung, dass eine rein merkmalsbasierte Definition problematisch ist, da diese Merkmale auch in der Hochkunst vorkommen können.
Schlüsselwörter
Kitsch, Kunst, Definition, Etymologie, Massenproduktion, Rezeption, Deutungsprozess, Kunstfertigkeit, Objektorientrierung, Distributionsorientierung, wissenschaftliche Diskussion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Kitsch – Eine kritische Auseinandersetzung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht kritisch den Begriff „Kitsch“ und die anhaltende Diskussion um seine Definition und Abgrenzung von Kunst. Sie analysiert die Zusammenhänge zwischen Kitsch und Kunst sowie die historischen und kulturellen Kontexte seiner Entstehung und Rezeption. Dabei geht sie über rein beschreibende Ansätze hinaus und entwickelt eine eigene Argumentationslinie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die etymologische Herkunft des Begriffs „Kitsch“, die Problematik seiner Definition (Produktions-, Distributions-, Objekt- und Rezeptionsorientierte Perspektiven), die Beziehung zwischen Kitsch und Kunst, Kitsch als Deutungsprozess und seine Präsenz in der Kunstwelt, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der anhaltenden wissenschaftlichen Diskussion um Kitsch.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Etymologie und die Problematik der Definition, Die Interdependenz von Kitsch und Kunst und der gewagte Versuch einer Definition, Kitsch als Deutungsprozess und der Einzug des Kitsches in die Welt der Kunst, Warum die wissenschaftliche Diskussion über Kitsch beendet werden sollte (k)eine Schlussbetrachtung?, und Literaturnachweis.
Wie wird Kitsch in der Arbeit definiert?
Die Arbeit kritisiert den gängigen Ansatz, Kitsch anhand von Objekten zu definieren. Sie strebt eine eigene Definition an, indem sie die Zusammenhänge und Abhängigkeiten analysiert, in denen sich Kitsch befindet, und hinterfragt die Notwendigkeit der anhaltenden Debatte. Die Arbeit bezieht sich auf Thesen von Umberto Eco, Severin Zebhauser, Andreas Dörner und Ludgera Vogt, entwickelt aber eine individuelle Argumentationsstruktur und Schlussfolgerung.
Welche Perspektiven auf Kitsch werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Kitsch aus verschiedenen Perspektiven: produktions-, distributions-, objekt- und rezeptionsorientiert. Sie zeigt, dass massenhafte Produktion allein kein ausreichendes Kriterium für Kitsch ist und dass eine rein merkmalsbasierte Definition problematisch ist, da diese Merkmale auch in der Hochkunst vorkommen können.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit hinterfragt die Notwendigkeit der anhaltenden wissenschaftlichen Diskussion über Kitsch und präsentiert eine kritische und konstruktive Betrachtung des Themas, die über rein beschreibende Ansätze hinausgeht. Die genaue Schlussfolgerung wird in der Arbeit selbst dargelegt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kitsch, Kunst, Definition, Etymologie, Massenproduktion, Rezeption, Deutungsprozess, Kunstfertigkeit, Objektorientrierung, Distributionsorientierung, wissenschaftliche Diskussion.
- Quote paper
- David Jugel (Author), 2009, Die kitschige Diskussion über Kitsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141146