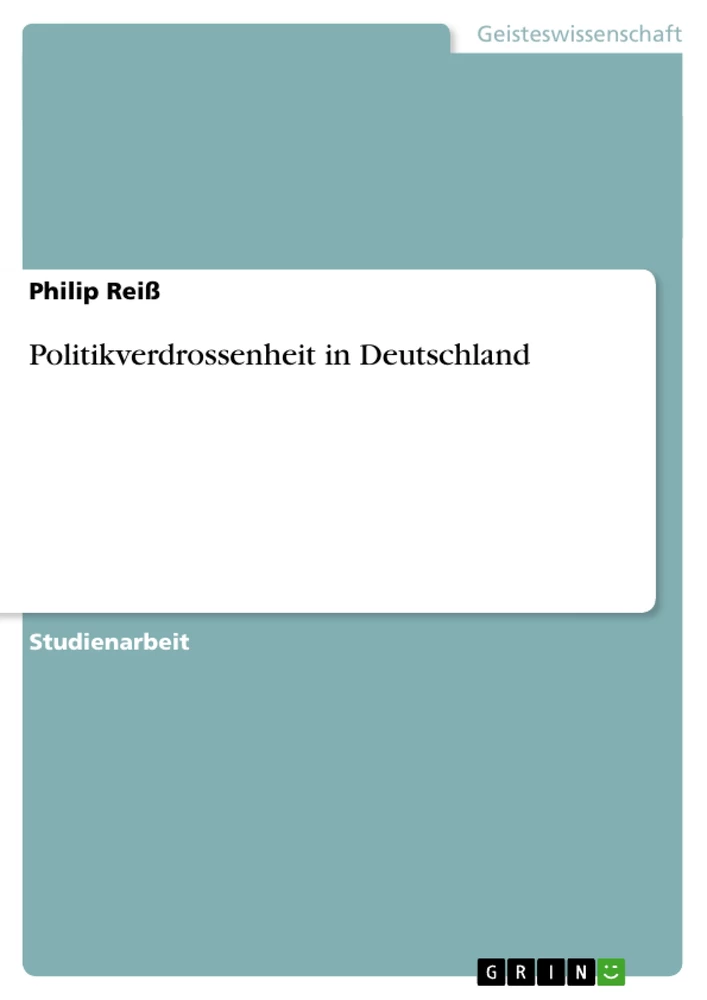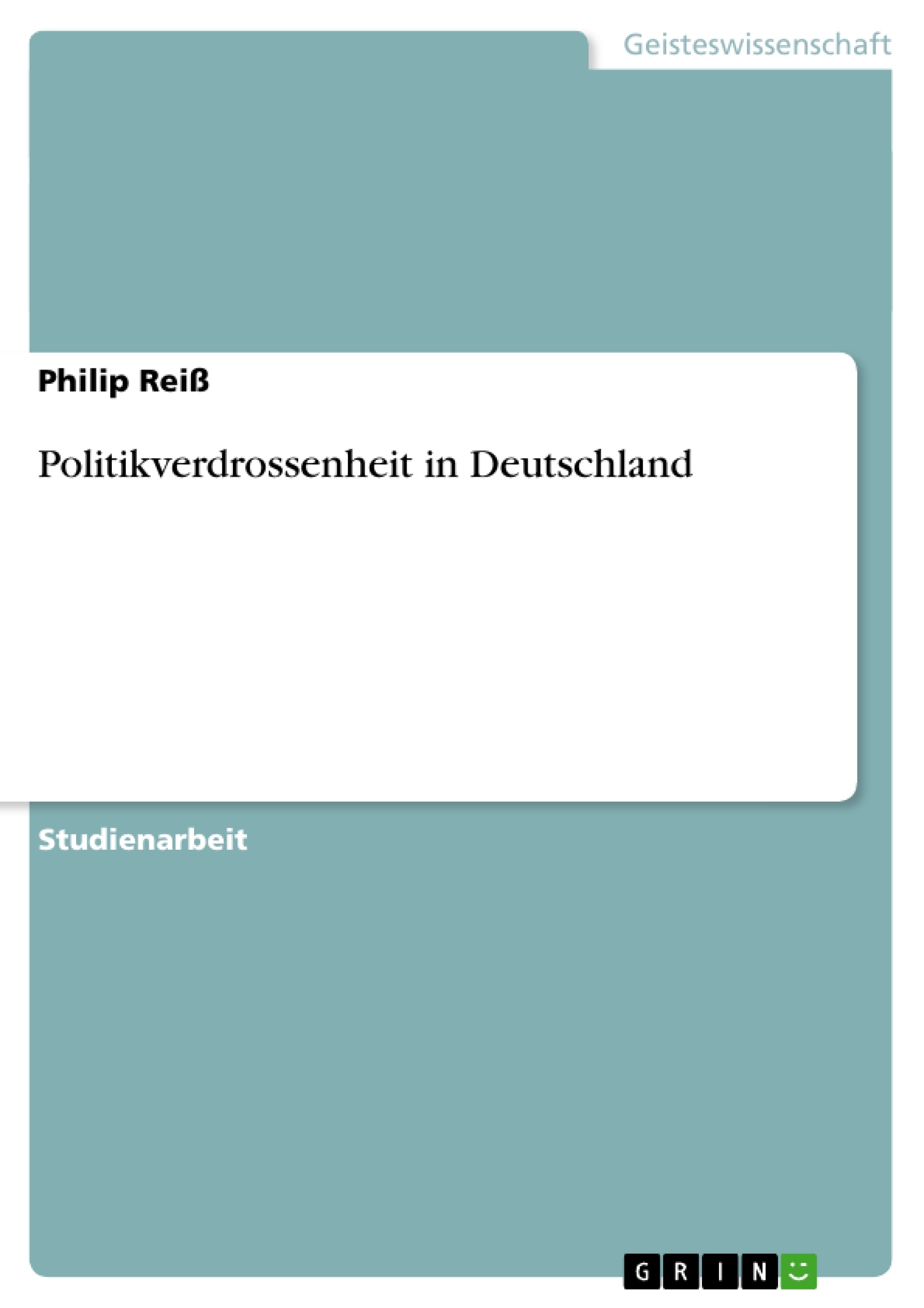Die Wahlbeteiligung sinkt. Während auf Bundesebene in den Siebzigerjahren noch fast 90
Prozent der Bürger wählen gingen, waren es 2002 nur noch 80 Prozent. Bei Kommunal- und
Europawahlen entschieden sich zuletzt sogar nur noch knapp 50 Prozent der Deutschen für die
Stimmabgabe. sehen darin eine Anpassung an den Stand anderer westlicher Demokratien, in denen schon
immer weniger Wähler registriert wurden als in der Bundesrepublik Deutschland. Anhänger der
"Krisenthese" deuten die Wahlverweigerung hingegen als Krisensymptom. Nach ihrer Ansicht
bleiben die Bürger den Wahlurnen aus Unzufriedenheit oder Protest fern. Doch beide Ansätze
reichen als Erklärung nicht aus, denn die Gründe der Nichtwähler sind weitaus komplexer(vgl.
http://wahl-fang.de/index.php?action=wahl-beteiligung; [Stand: 29.07.2009]).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Warum Nichtwähler auf die Stimmabgabe verzichten
- 1.1 Motive für das nachlassende Wahlverhalten
- 1.2 Definition des Begriffs Politikverdrossenheit
- 2. Politikerverdrossenheit
- 3. Parteienverdrossenheit
- 3.1 Symptome der Parteienverdrossenheit
- 3.2 Gründe für die Parteienverdrossenheit
- 4. Demokratieverdrossenheit
- 5. Mediale Berichterstattung
- 5.1 Aufgaben der Massenmedien
- 5.2 Kritik an den Medien
- 6. Kleinbürgerlicher Egoismus
- 7. Folgen der Verdrossenheit
- 7.1 Auswege aus der Politikverdrossenheit
- 7.2 Fazit
- 8. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen und Auswirkungen von Politikverdrossenheit in Deutschland. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte des Phänomens, von sinkenden Wahlbeteiligungsraten bis hin zu Misstrauen gegenüber Politikern und Parteien. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis für die Komplexität des Themas zu schaffen.
- Sinkende Wahlbeteiligung in Deutschland und die zugrundeliegenden Motive
- Analyse der Politiker-, Parteien- und Demokratieverdrossenheit
- Die Rolle der Medien in der Berichterstattung und Meinungsbildung
- Der Einfluss des „kleinbürgerlichen Egoismus“
- Mögliche Folgen und Lösungsansätze für die Politikverdrossenheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Warum Nichtwähler auf die Stimmabgabe verzichten: Dieses Kapitel untersucht den Rückgang der Wahlbeteiligung in Deutschland. Es analysiert verschiedene Theorien, die diese Entwicklung zu erklären versuchen, wie die „Normalisierungsthese“ und die „Krisenthese“. Der Fokus liegt auf der Komplexität der Motive von Nichtwählern, die über einfache Unzufriedenheit hinausgehen. Drei entscheidende Gründe werden hervorgehoben: politisches Desinteresse, fehlende Parteibindung und politische Unzufriedenheit. Der Rückgang der Wahlbeteiligung wird als vielschichtiges Problem dargestellt, das durch den Wandel der gesellschaftlichen Strukturen und das zunehmende Misstrauen gegenüber dem politischen System beeinflusst wird.
2. Politikerverdrossenheit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem negativen Image von Politikern in der Öffentlichkeit. Es argumentiert, dass die moralischen Ansprüche an Politiker oft mit den Realitäten der politischen Praxis kollidieren. Die starke Machtverteilung in modernen Demokratien zwischen Politik, Medien und Interessengruppen führt zu gegenseitigen Blockaden und einer Politik der kleinen Schritte. Zusätzlich wird die Rolle von Skandalen und ethischen Verstößen durch Politiker hervorgehoben, die das Misstrauen der Bevölkerung weiter verstärken. Der Ruf der Unehrlichkeit und des Anrüchigen wird als Folge der Komplexität des politischen Systems und des Drucks, diverse Interessen zu vereinen, dargestellt.
3. Parteienverdrossenheit: Dieses Kapitel analysiert die Symptome und Ursachen von Parteienverdrossenheit. Es beschreibt den Verlust an Parteibindung in der Bevölkerung, den Rückgang der Mitgliederzahlen und den Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die traditionelle Parteistreue. Die zunehmende Mobilität der Gesellschaft und die Auflösung sozio-politischer Milieus werden als Gründe für die schwächere Identifikation mit politischen Parteien genannt. Das Kapitel untersucht die Herausforderungen der Parteien, in einer sich verändernden Gesellschaft weiterhin die Wähler zu erreichen und zu mobilisieren.
4. Demokratieverdrossenheit: Der Fokus liegt hier auf der generellen Unzufriedenheit mit dem politischen System und demokratischen Institutionen. Es werden die Zusammenhänge zwischen dem Misstrauen in Politik und Parteien und der grundsätzlichen Skepsis gegenüber der Demokratie beleuchtet. Das Kapitel analysiert, wie die erlebte Ineffizienz und mangelnde Transparenz des politischen Systems zum Gefühl beitragen, dass die Demokratie nicht mehr den Bedürfnissen der Bürger entspricht. Mögliche Ursachen dieser generellen Unzufriedenheit werden skizziert.
5. Mediale Berichterstattung: Das Kapitel untersucht die Rolle der Medien in der politischen Meinungsbildung und deren Einfluss auf die Politikverdrossenheit. Die Aufgaben der Massenmedien werden diskutiert, gefolgt von einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Berichterstattung. Die Medien werden sowohl als wichtige Informationsquelle als auch als potenzieller Verstärker von Politikverdrossenheit betrachtet, abhängig von ihrer Berichterstattungspraxis und der Art und Weise, wie politische Ereignisse präsentiert werden.
6. Kleinbürgerlicher Egoismus: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des individuellen Egoismus und der fehlenden sozialen Verantwortung in Bezug auf die Politikverdrossenheit. Es wird untersucht, wie ein Fokus auf individuelle Interessen und das mangelnde Engagement für die Allgemeinheit zu einer Passivität gegenüber dem politischen System beitragen. Es werden mögliche gesellschaftliche Faktoren und deren Auswirkungen auf politische Beteiligung beleuchtet.
7. Folgen der Verdrossenheit: Das Kapitel widmet sich den Konsequenzen der Politikverdrossenheit. Es werden mögliche Auswirkungen auf die politische Stabilität, die demokratische Partizipation und die gesellschaftliche Kohäsion untersucht. Außerdem werden mögliche Strategien zur Bekämpfung der Politikverdrossenheit und zur Stärkung des politischen Engagements der Bürger erörtert. Das Kapitel schließt mit einem Fazit, das die zentralen Ergebnisse der Hausarbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Politikverdrossenheit, Wahlbeteiligung, Parteienverdrossenheit, Politikerverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit, Medien, politische Partizipation, politische Unzufriedenheit, gesellschaftlicher Wandel, Misstrauen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Ursachen und Auswirkungen von Politikverdrossenheit in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht umfassend die Ursachen und Folgen von Politikverdrossenheit in Deutschland. Sie beleuchtet verschiedene Facetten des Phänomens, von sinkenden Wahlbeteiligungsraten bis hin zu Misstrauen gegenüber Politikern, Parteien und dem demokratischen System selbst.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Sinkende Wahlbeteiligung und die dahinterliegenden Motive; Analyse der Politiker-, Parteien- und Demokratieverdrossenheit; die Rolle der Medien in der Berichterstattung und Meinungsbildung; der Einfluss des „kleinbürgerlichen Egoismus“; mögliche Folgen und Lösungsansätze für die Politikverdrossenheit.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Kapitel 1 untersucht den Rückgang der Wahlbeteiligung und die Motive von Nichtwählern; Kapitel 2 analysiert die Politikerverdrossenheit und das negative Image von Politikern; Kapitel 3 befasst sich mit der Parteienverdrossenheit, ihren Symptomen und Ursachen; Kapitel 4 untersucht die Demokratieverdrossenheit und das generelle Misstrauen im politischen System; Kapitel 5 analysiert die Rolle der Medien in der Meinungsbildung und deren Einfluss auf die Politikverdrossenheit; Kapitel 6 beleuchtet den Einfluss des „kleinbürgerlichen Egoismus“; Kapitel 7 beschäftigt sich mit den Folgen der Politikverdrossenheit und möglichen Lösungsansätzen. Zusätzlich gibt es ein Quellenverzeichnis.
Welche Ursachen für Politikverdrossenheit werden in der Hausarbeit genannt?
Die Hausarbeit nennt vielfältige Ursachen für Politikverdrossenheit, darunter: sinkende Wahlbeteiligung aufgrund von politischem Desinteresse, fehlender Parteibindung und politischer Unzufriedenheit; das negative Image von Politikern aufgrund von Skandalen und ethischen Verstößen; der Verlust an Parteibindung und der gesellschaftliche Wandel; die erlebte Ineffizienz und mangelnde Transparenz des politischen Systems; die Rolle der Medienberichterstattung; und der Einfluss des „kleinbürgerlichen Egoismus“ und fehlender sozialer Verantwortung.
Welche Folgen werden der Politikverdrossenheit zugeschrieben?
Die Hausarbeit untersucht mögliche Folgen der Politikverdrossenheit wie die Beeinträchtigung der politischen Stabilität, die Schwächung der demokratischen Partizipation und die Gefährdung der gesellschaftlichen Kohäsion.
Welche Lösungsansätze werden in der Hausarbeit diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert mögliche Strategien zur Bekämpfung der Politikverdrossenheit und zur Stärkung des politischen Engagements der Bürger. Konkrete Vorschläge werden im siebten Kapitel im Abschnitt "Auswege aus der Politikverdrossenheit" präsentiert.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Hausarbeit relevant?
Schlüsselwörter sind: Politikverdrossenheit, Wahlbeteiligung, Parteienverdrossenheit, Politikerverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit, Medien, politische Partizipation, politische Unzufriedenheit, gesellschaftlicher Wandel, Misstrauen.
- Quote paper
- Philip Reiß (Author), 2009, Politikverdrossenheit in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141025