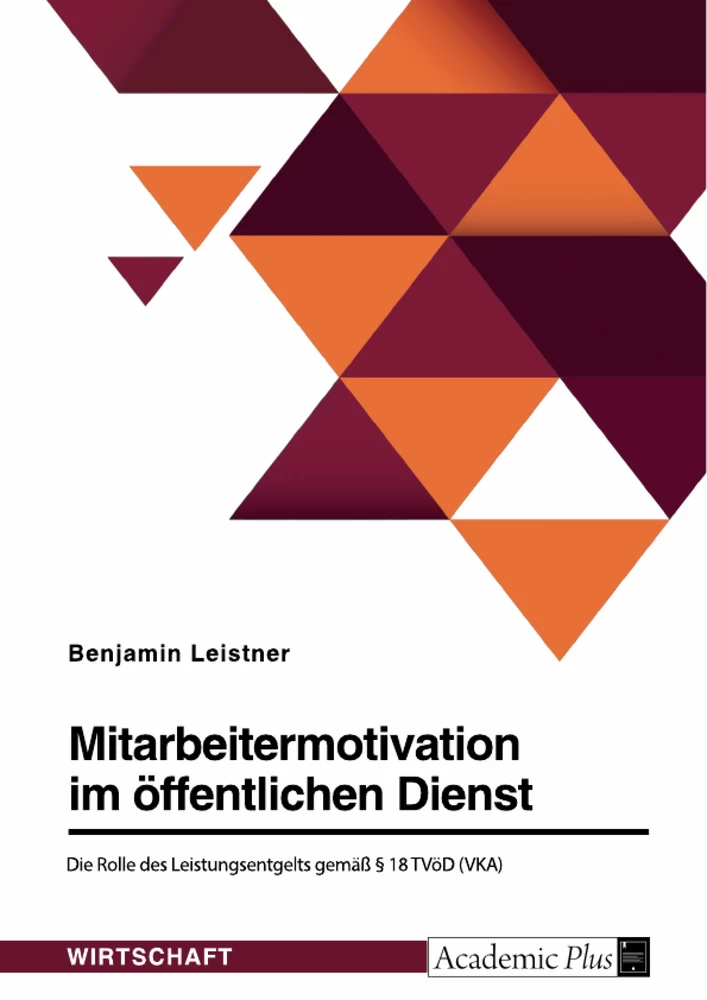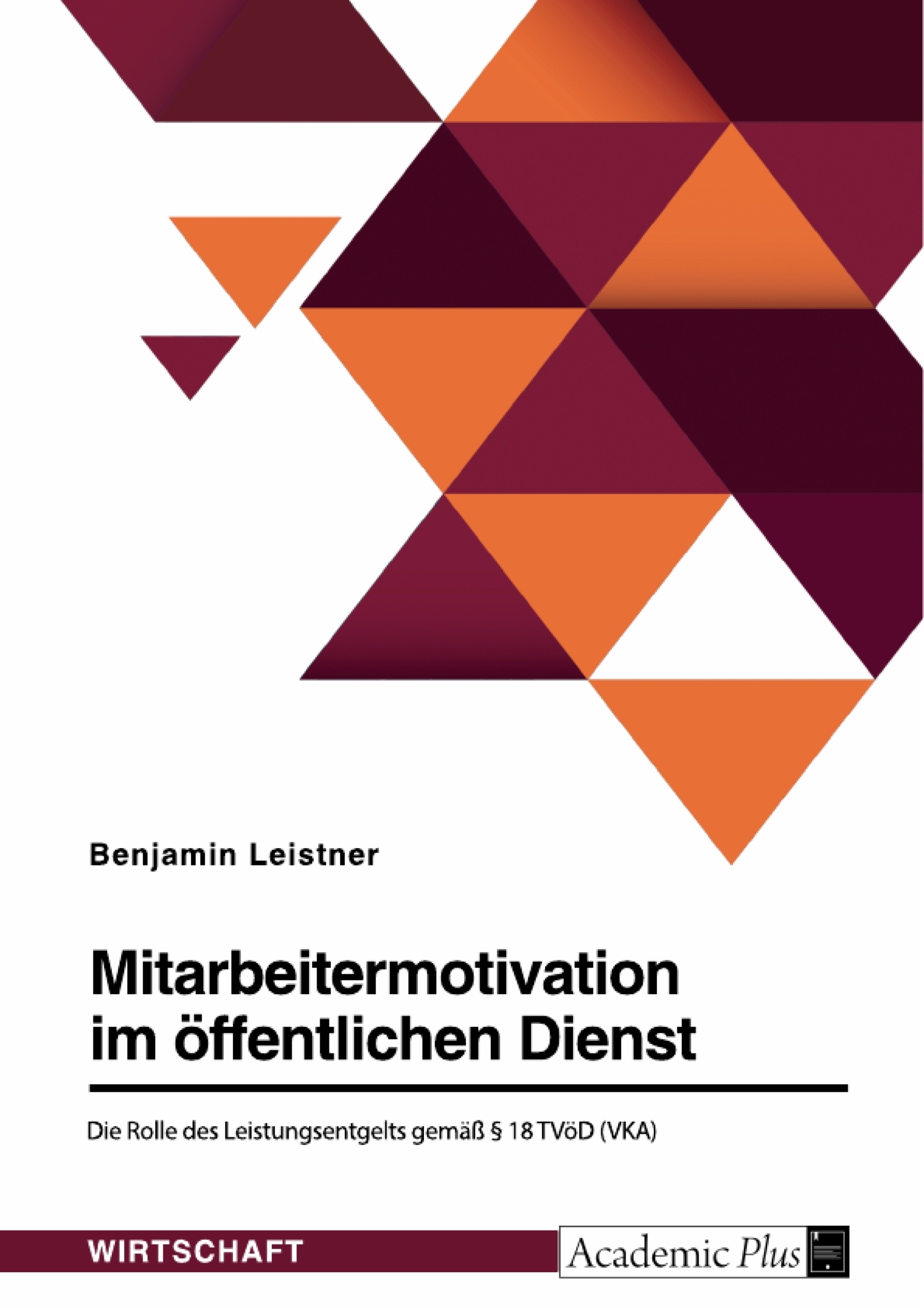Mit der Ablösung des BAT durch den TVöD im Jahr 2005 wurden für die Kommunen und dem Bund die Voraussetzungen für eine flächendeckende Einführung eines Leistungsentgelts resp. einer leistungsorientierten Bezahlung für die angestellten Tarifbeschäftigten geschaffen. Damit ging im öffentlichen Dienst ein regelrechter Paradigmenwechsel vom sog. Alimentationsprinzip zum Grundsatz leistungs- und erfolgsabhängiger Entlohnung durch eine verstärkte Einbeziehung von mehr Flexibilität, größerer Effektivität und Effizienz einher.
Eine moderne Managementphilosophie und eine verbesserte Unternehmenskultur im öffentlichen Sektor sollten von nun an als oberste Maxime gelten. Seit dem Jahr 2007 ist es insbesondere den Kommunen, mit denen sich diese wissenschaftliche Arbeit vorrangig auseinandersetzt, demnach gestattet, den Beschäftigten ein Leistungsentgelt zu gewähren, sofern sich Arbeitgeber und Personal-/Betriebsrat unter Berücksichtigung des äußerst abstrakt normierten § 18 TVöD (VKA) auf den Abschluss einer konsensualen Dienstvereinbarung verständigen können. Innerhalb der Tarifvertragsparteien ist das Modell des Leistungsentgelts jedoch weiterhin umstritten.
Die VKA erhofft sich neben der klassischen Anreiz- und Motivationsfunktion nicht zuletzt eine Verbesserung der gemeinhin als sehr restriktiv geltenden Führungskultur. Ver.di hingegen zweifelt grundsätzlich an der Wirkung der Bestimmungen und hat diese im Rahmen der Tarifverhandlungen auch nur deshalb konzediert, um den TVöD und den Flächentarifvertrag in Gänze nicht zur Disposition zu stellen. Angesichts des Umstandes, dass nicht nur die Einführung leistungsbezogener Entlohnung im deutschen öffentlichen Dienst ein generelles Novum darstellt, sondern die Tarifvertragsparteien zur leistungsorientierten Bezahlung eine basal divergierende Auffassung vertreten.
Darüber hinaus die fakultative Implementierung des Systems zur Leistungsfeststellung und -bewertung disparate kommunale Verhältnisse evoziert sowie die grundlegende Wirksamkeit des Leistungsentgelts auf die Steigerung der intrinsischen Motivation des einzelnen Beschäftigten und auf die Verbesserung der Aufgabenabwicklung bisweilen bezweifelt wird.
1.1 Forschungsanlass und Hintergrund der Studie
1.2 Forschungsfragen und Aufbau der Studie
2 Tarifrecht des öffentlichen Dienstes
2.2 Tarifvertragsparteien und Tarifbindung
2.2.1 Tarifpartner auf Arbeitgeberseite
2.2.2 Tarifpartner auf Arbeitnehmerseite
2.2.3 Beiderseitige Tarifgebundenheit
2.2.4 Tarifanwendung aufgrund individueller Vereinbarung
2.3.1 Zeitlicher Geltungsbereich
2.3.2 Räumlicher Geltungsbereich
2.3.3 Betrieblicher Geltungsbereich
2.3.4 Persön licher Geltungsbereich
2.4 Ausnahmen vom Geltungsbereich
3 Leistungsentgelt für Kommunen gemäß § 18 TVöD (VKA)
3.1 Tarifhistorische Entwicklung leistungsorientierter Bezahlung
3.2 Vorbemerkung zum tariflichen Leistungsentgelt
3.3 Geltungs- und Anwendungsbereich
3.4 Ziele des Leistungsentgelts
3.5 Finanzierung und Gesamtvolumen des Leistungsentgelts
3.6 Formen des Leistungsentgelts
4 Methoden der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung
4.1 Zielvereinbarungssysteme
4.1.1 Vorbemerkung zur Zielvereinbarung
4.1.2 Leistungsfeststellung durch Zielvorgaben
4.1.3 Arten der Zielvereinbarung
4.1.3.1 Individuelle Zielvereinbarungen
4.1.3.2 Gruppenbezogene Zielvereinbarungen
4.1.4 Zielvereinbarungsgespräche
4.1.5 Chancen und Risiken der Zielvereinbarung
4.1.5.1 Vorteile und Chancen
4.1.5.2 Nachteile und Risiken
4.2 Leistungsbewertungssysteme
4.2.1 Kriterienorientierte Leistungsbewertung
4.2.2 Aufgabenorientierte Leistungsbewertung
4.3 Beurteilungsgespräch
4.4 Vor- und Nachteile systematischer Leistungsbewertungen
4.5 Zeitraum der Beurteilung
4.6 Kombinierte Zielvereinbarungs- und Leistungsbewertungsverfahren (sog. Kombi- resp. Verknüpfungsmodelle)
5 Ausgestaltung des betrieblichen Leistungsentgeltsystems
5.1 Inhalt einer Betriebs- resp. einvernehmlichen Dienstvereinbarung
5.2 Betriebliche Kommission und Konfliktlösung
5.3 Mitbestimmung durch Betriebs-/Personalrat
6 Wirkungen und Akzeptanz des Leistungsentgelts in der kommunalen Praxis
6.1 Meinungen der Tarifvertragsparteien zu den Effekten des Leistungsentgelts
6.2 Meinungen der psychologischen Forschung zur Wirksamkeit des Leistungsentgelts
6.3 Durchführung einer Untersuchung
6.3.1 Empirische Analyse und Erhebungsmethode
6.3.2 Ergebnisse
6.3.2.1 Ausgestaltung und Präsenz der Kriterien
6.3.2.2 Funktionalität und Methodik
6.3.2.3 Sozialbeziehungen
6.3.2.4 Akzeptanz und Änderungsbedarf
6.3.3 Leistungsentgelt – Quo vadis?
7 Fazit
8 Anhang
8.1 (Muster)Dienst-/Betriebsvereinbarung „Leistungsentgelt gemäß § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD (VKA)“
8.2 Musterbeurteilungsbogen zur Einzelzielvereinbarung
8.3 Musterbeurteilungsbogen zur systematischen Leistungsbewertung
8.4 Musterbeurteilungsbogen für ein Kombi- resp. Verknüpfungsmodell
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Anwendung Bewertungsmodul Leistungsentgelt
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 2: Präsenz der Kriterien von systematischen Leistungsbewertungen
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 3: Präsenz der Kriterien von Zielvereinbarungen
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 4: Motivationseffekt des Leistungsentgelts
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 5: Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem Leistungsentgelt
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 6: Bemühungen der Beschäftigten zur Erreichung einer guten Bewertung
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 7: Neid und Konkurrenzdenken zwischen den Kollegen
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 8: Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 9: Beurteilung des Systems von Verwaltungsspitze insgesamt
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 10: Beurteilung des Systems von Führungskräften insgesamt
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 11: Beurteilung des Systems von Personalräten insgesamt
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 12: Beurteilung des Systems von Beschäftigten insgesamt
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 13: Beurteilung des § 18 TVöD (VKA) insgesamt
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 14: Keine Änderung nötig
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 15: Weitere tarifliche Ausweitung des Volumens
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 16: Volle Ausschüttung des Topfes auch bei fehlender Anwendung des Leistungsentgelts
(Quelle: Eigene Umfrage, 2023)
Abbildung 17: Freiwillige Einführung des Leistungsentgelts für alle Kommunen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Unterscheidung Maßnahme und Zielvorgabe
(Quelle: Eigene Darstellung, 2022)
Abkürzungsverzeichnis
a. a. O. am angegebenen Ort
Abs. Absatz
Art. Artikel
BAG Bundesarbeitsgericht
BAGE Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts
BAT Bundesangestelltentarifvertrag
BayPVG Bayerisches Personalvertretungsgesetz
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BMI Bundesministerium des Innern und für Heimat
bzw. beziehungsweise
dbb dbb beamtenbund und tarifunion
d. h. das heißt
ff. folgende/n Seite/n
GdP Gewerkschaft der Polizei
GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
ggf. gegebenenfalls
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
H. Heft
Hs. Halbsatz
Hrsg. Herausgeber
IG BAU Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
i. S. d. im Sinne des
i. V. m. in Verbindung mit
Jg. Jahrgang
KAV Kommunaler Arbeitgeberverband
LoB Leistungsorientierte Bezahlung
Nr/n. Nummer/n
öAT Zeitschrift für das öffentliche Arbeits- und Tarifrecht
resp. respektive
Rdnr/n. Randnummer/n
S. Seite/n
sog. sogenannt/e/n
TVG Tarifvertragsgesetz
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u. a. unter anderem
URL Uniform Resource Locator
usw. und so weiter
ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Vgl. Vergleiche
VKA Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
WSI Zeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung
z. B. zum Beispiel
ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft
ZTR-Online Online-Zeitschrift für Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht des öffentlichen Dienstes
1 Einleitung
1.1 Forschungsanlass und Hintergrund der Studie
Mit der Ablösung des BAT durch den TVöD im Jahr 2005 wurden für die Kommunen und dem Bund die Voraussetzungen für eine flächendeckende Einführung eines Leistungsentgelts resp. einer leistungsorientierten Bezahlung für die angestellten Tarifbeschäftigten geschaffen. Damit ging im öffentlichen Dienst ein regelrechter Paradigmenwechsel vom sog. Alimentationsprinzip zum Grundsatz leistungs- und erfolgsabhängiger Entlohnung durch eine verstärkte Einbeziehung von mehr Flexibilität, größerer Effektivität und Effizienz einher. Eine moderne Managementphilosophie und eine verbesserte Unternehmenskultur im öffentlichen Sektor sollten von nun an als oberste Maxime gelten. Seit dem Jahr 2007 ist es insbesondere den Kommunen, mit denen sich diese wissenschaftliche Arbeit vorrangig auseinandersetzt, demnach gestattet, den Beschäftigten ein Leistungsentgelt zu gewähren, sofern sich Arbeitgeber und Personal-/Betriebsrat unter Berücksichtigung des äußerst abstrakt normierten § 18 TVöD (VKA) auf den Abschluss einer konsensualen Dienstvereinbarung verständigen können. Innerhalb der Tarifvertragsparteien ist das Modell des Leistungsentgelts jedoch weiterhin umstritten. Die VKA erhofft sich neben der klassischen Anreiz- und Motivationsfunktion nicht zuletzt eine Verbesserung der gemeinhin als sehr restriktiv geltenden Führungskultur. Ver.di hingegen zweifelt grundsätzlich an der Wirkung der Bestimmungen und hat diese im Rahmen der Tarifverhandlungen auch nur deshalb konzediert, um den TVöD und den Flächentarifvertrag in Gänze nicht zur Disposition zu stellen[1]. Angesichts des Umstandes, dass nicht nur die Einführung leistungsbezogener Entlohnung im deutschen öffentlichen Dienst ein generelles Novum darstellt, sondern die Tarifvertragsparteien zur leistungsorientierten Bezahlung eine basal divergierende Auffassung vertreten. Darüber hinaus die fakultative Implementierung des Systems zur Leistungsfeststellung und -bewertung disparate kommunale Verhältnisse evoziert sowie die grundlegende Wirksamkeit des Leistungsentgelts auf die Steigerung der intrinsischen Motivation des einzelnen Beschäftigen und auf die Verbesserung der Aufgabenabwicklung bisweilen bezweifelt wird, Anlass zur Untersuchung und Beantwortung nachfolgender Fragen geben.
1.2 Forschungsfragen und Aufbau der Studie
· Welche konkreten Interessen und Ansätze verfolgten einst die Tarifvertragsparteien mit der Ablösung des alten Tarifrechts BAT durch den neuen TVöD, und für wen sollen diese gelten?
· Was ist unter dem Terminus Leistungsentgelt i. S. d. § 18 TVöD (VKA) grundlegend zu verstehen, und welche Kernziele sollen damit erreicht werden?
· Welche Methoden zur Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung können angewendet werden, und wie unterscheiden sich diese? Sind Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme bekannt?
· Wie erfolgt die Ausgestaltung der Vereinbarung zur Einführung eines betrieblichen Leistungsentgeltsystems? Sind Vertretungsorgane des Arbeitgebers oder der Beschäftigten zu beteiligen?
· Wie verhält es sich mit der Umsetzung in der kommunalen Praxis? Welche Effekte und Akzeptanz entfaltet das Leistungsentgeltsystem vor Ort? Haben die Modelle Einfluss auf die betrieblichen Sozialbeziehungen? Besteht für die Zukunft Änderungsbedarf und bejahendenfalls, welcher?
Die vorliegende Arbeit stellt eine Analyse des tariflich erstmalig implizierten Leistungsentgelts im öffentlichen Dienst zur Steigerung der Motivation der Beschäftigten sowie zur Verbesserung der Aufgabenerledigung dar. Ausgehend von der Einleitung werden im Kapitel 2 die Grundlagen und der Geltungsbereich des neuen Tarifrechts TVöD näher beschrieben. Darauf aufbauend konzentriert sich der weitere Abschnitt 3 auf das eingeführte Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD (VKA) und erläutert dabei insbesondere die Ziele und Modelle der leistungsorientierten Entlohnung. Kapitel 4 setzt sich mit den unterschiedlichen Methoden der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung auseinander und zeigt die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme auf. Im Abschnitt 5 werden die formellen und materiellen Voraussetzungen für die Ausgestaltung des betrieblichen Systems des Leistungsentgelts erkundet und näher dargelegt. Abschließend wird im Kapitel 6 eine Untersuchung durchgeführt, um einerseits die Anwendung der Bewertungsmodule zum Leistungsentgelt in der bayerischen kommunalen Praxis sowie andererseits die damit in Korrelation stehenden Effekte mit etwaigem Änderungsbedarf zu erforschen. Ausweislich der Ergebnisse erfolgt ein Ausblick des Leistungsentgelts in die Zukunft, der mit dem persönlichen Fazit zur Masterthesis seinen Abschluss finden wird.
2 Tarifrecht des öffentlichen Dienstes
2.1 Tarifreform
Obgleich die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes das Tarifrecht im Laufe der 1990er-Jahre in einem ständigen Prozess an die veränderten Verhältnisse und Anforderungen anpassten, gab es übereinstimmende Meinungen zum Bedarf einer grundsätzlichen Reform[2]. Bis zum Inkrafttreten des TVöD am 01.10.2005 umfasste das über vier Jahrzehnte geltende Manteltarifrecht des öffentlichen Dienstes von Kommunen und Bund eine Vielzahl an Manteltarifverträgen, unterteilt nach den Tarifgebieten Ost und West sowie nach Statusgruppen der Arbeiter und Angestellten. Demzufolge war zentrales Thema zu Beginn der Tarifverhandlungen im Jahr 2003 eine grundlegende und ausführliche Modernisierung des Tarifrechts, das sich besonders widerspiegelte durch die Zusammenfassung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche des kommunalen öffentlichen Dienstes, den Wegfall der Differenzierung zwischen Arbeiter und Angestellten sowie die Trennung der Tarifgebiete Ost und West[3]. Materieller Schwerpunkt der Reform war die Öffnung der Tarifbestimmungen für mehr Flexibilität vor allem bei den Arbeitszeitregelungen, der Entgeltgestaltung und den Führungsinstrumenten sowie für mehr Leistungsorientierung im Speziellen durch die Einführung erfolgsabhängiger Faktoren[4]. Nach über zwei Jahren Verhandlungsphase konnten die Tarifvertragsparteien am 13.09.2005 die Einigung auf einen im Vergleich zum bestehenden Kontrakt äußerst progressiven und einheitlichen Tarifvertrag mit Inkrafttreten zum 01.10.2005 verkünden[5].
2.2 Tarifvertragsparteien und Tarifbindung
2.2.1 Tarifpartner auf Arbeitgeberseite
Der TVöD wird auf Arbeitgeberseite zum einen von der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMI, für die Arbeitnehmer der Bundesministerien und der nachgeordneten Bundesbehörden sowie zum anderen von der VKA, vertreten durch den Vorstand, für die Arbeitnehmer der Mitglieder des KAVs, der seinerseits Mitglied der VKA ist, abgeschlossen[6]. Die VKA weist derzeit 16 Mitgliedsverbände auf, nämlich die KAV in den einzelnen Bundesländern.
2.2.2 Tarifpartner auf Arbeitnehmerseite
Auf der Gewerkschaftsseite wird der TVöD vereinbart mit ver.di und dem dbb, vertreten durch den Fachvorstand Tarifpolitik. Zudem schließt ver.di den TVöD mit Vollmacht für die GdP, die IG BAU und die GEW[7]. Der Marburger Bund hingegen hat kurz vor Abschluss der Tarifverhandlungen zum TVöD im Jahr 2005 die bis dahin bestehende Verhandlungsgemeinschaft mit ver.di aufgekündigt und ist damit aus dem Kreis der den TVöD tarifverhandelten Gewerkschaften ausgeschieden[8].
2.2.3 Beiderseitige Tarifgebundenheit
Nach § 4 Abs. 1 TVG gelten die Rechtsnormen des Tarifvertrags, die den Inhalt, den Abschluss oder die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags, z. B. dem TVöD, fallen[9]. Demzufolge besteht eine normative Tarifbindung an den TVöD ausschließlich, wenn sowohl der Arbeitgeber (z. B. durch Mitgliedschaft im KAV Bayern) als auch der Arbeitnehmer als Mitglied einer tarifvertragsschließenden Gewerkschaft (z. B. ver.di) tarifgebunden sind.
2.2.4 Tarifanwendung aufgrund individueller Vereinbarung
Ungeachtet fehlender Geltung des Tarifvertrags wegen nicht beiderseitiger Tarifbindung, bleibt es dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst allerdings unbenommen, die Anwendung des TVöD einzelarbeitsvertraglich zu vereinbaren. Die tarifgebundenen Arbeitgeber vollziehen dies grundsätzlich auch, um einheitliche Arbeitsbedingungen in den Verwaltungen und sonstigen öffentlichen Betrieben sicherzustellen[10]. Dadurch wird eine reibungslose Abwicklung öffentlicher Aufgaben gewährleistet und verhindert zudem Wettbewerbsvorteile und -nachteile innerhalb des öffentlichen Dienstes.
2.3 Geltungsbereich
Hinsichtlich des Geltungsbereiches des TVöD ist zwischen dem zeitlichen, räumlichen, betrieblichen und dem persönlichen Geltungsbereich zu unterscheiden.
2.3.1 Zeitlicher Geltungsbereich
Der Tarifvertrag ist gemäß § 39 Abs. 1 TVöD am 01.10.2005 in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt begann sein zeitlicher Geltungsbereich. Der Tarifvertrag kann nach § 39 Abs. 2 TVöD mit dem Außerkrafttreten enden, sobald dieser durch eine der Tarifvertragsparteien mit einer Drei-Monatsfrist zum Schluss eines Kalenderhalbjahres gekündigt wird. Jedoch würden die tariflichen Vorschriften im Hinblick auf den im § 4 Abs. 5 TVG verpflichteten Nachwirkungseffekt auch nach Ablauf des TVöD noch so lange weiter gelten, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden.
2.3.2 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des TVöD umfasst nun das gesamte Bundesgebiet. Im Vergleich zum alten, abgelösten Tarifrecht, das noch in allen Belangen eine strikte Differenzierung der Tarifgebiete Ost und West vorsah, ist dies als signifikante Neuerung zu konstatieren. Lediglich für wenige Regelungstatbestände, wie z. B. Bestimmung zu befristeten Arbeitsverträgen nach § 30 TVöD oder Kündigung des Arbeitsverhältnisses i. S. d. § 34 TVöD, wurde noch eine Unterscheidung zwischen den Tarifgebieten Ost und West beibehalten.
2.3.3 Betrieblicher Geltungsbereich
Der betriebliche Geltungsbereich des TVöD erstreckt sich auf alle Behörden, Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe des Bundes und der Kommunen, sofern diese Mitglied im KAV ihres jeweiligen Bundeslandes sind. Sämtliche öffentliche Einrichtungen und Betriebe, die jedoch einer privaten Rechtsform unterlegen sind, fallen nur dann unter den betrieblichen Geltungsbereich, wenn diese eine Mitgliedschaft in eines der VKA angehörenden kommunalen Arbeitgeberverbands nachweisen können[11].
2.3.4 Persön licher Geltungsbereich
Für alle Beschäftigten eines öffentlichen Arbeitgebers, insoweit für jene Arbeitnehmer, die nicht selbstständig sind, aber bei denen die Verpflichtung zur Arbeitsleistung im Zuge eines bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses erfolgt, gilt der TVöD. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis liegt vor, wenn die Arbeitsleistung vom Arbeitgeber nach Art, Ort und Zeit bestimmt werden darf[12]. Demzufolge stellen Beamte auch keine Beschäftigten i. S. d. TVöD dar, weil deren Tätigkeiten, im Gegensatz zu den Arbeitnehmern, nicht in Form eines privatrechtlichen, sondern im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ausgeübt werden. Gleiches gilt für Personen, deren rechtliche Verpflichtung zur Arbeitsleistung auf einen speziellen Arbeitserfolg abzielt und demnach mit dem öffentlichen Arbeitgeber in einem Werkvertrags-, Dienstbesorgungsvertrags- oder Werklieferungsvertragsverhältnis stehen.
2.4 Ausnahmen vom Geltungsbereich
Die Tarifvertragsparteien haben sich - wie bereits in den Vorgängertarifverträgen - im § 1 Abs. 2 TVöD auf eine Reihe von Beschäftigtengruppen (u. a. Leitende Angestellte i. S. d. § 5 Abs. 3 BetrVG, Chefärzte, Ortskräfte von Auslandsdienststellen, Fleischbeschaupersonal) verständigt, die von der Geltung des TVöD explizit ausgenommen sind. Hierbei handelt es sich jedoch um eine abdingbare Tarifvorschrift, die es den Parteien im Rahmen der einzelarbeitsvertraglichen Verhandlungen dennoch ermöglicht, die Anwendung des TVöD zu erklären[13].
3 Leistungsentgelt für Kommunen gemäß § 18 TVöD (VKA)
3.1 Tarifhistorische Entwicklung leistungsorientierter Bezahlung
Bereits lange vor Inkrafttreten des TVöD im Oktober 2005 hatten die Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst - wenngleich nur in speziellen Sparten - erste Berührungspunkte mit einer leistungsorientierten Bezahlung. So wurde z. B. in den 1990er-Jahren im Bereich der Versorgungsbetriebe über Leistungszulagen diskutiert[14]. Die VKA veröffentlichte am 17.11.1995 eine Richtlinie zur freiwilligen Gewährung von Leistungszulagen und Leistungsprämien, wobei die überwiegende Mehrheit der kommunalen Arbeitgeber diese in der praktischen Tätigkeit nie anwendeten[15]. Dies war insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Umsetzung des neu geschaffenen Leistungsvergütungsmodells vor Ort als kultureller Veränderungsprozess sowohl bei Arbeitgeber als auch bei Arbeitnehmer auf wenig Akzeptanz stieß. Eine Analyse aus dem Jahr 2004 zeigte unterdessen ein äußerst fragmentarisches Bild von Initiativen und Maßnahmen zur Begleitung des erforderlichen kulturellen Wandels auf[16]. In der Untersuchung mehrerer Kommunen konnte kaum ein Fall konstatiert werden, in dem der Einführungs- und Anwendungsvorgang inhaltlich und zeitlich sorgfältig geplant war sowie Führungskräfte ausreichend qualifiziert und Mitarbeiter durch Gespräche motiviert wurden. Oftmals reduzierten sich die Initiativen auf Informationen über die in Kraft gesetzten Bestimmungen und generierten dadurch eher ein kontraproduktives Ergebnis. Dies sollte sich mit der Einführung des flächendeckenden und verpflichtend umzusetzenden Leistungsentgelts i. S. d. § 18 TVöD (VKA) nicht erneut wiederholen.
3.2 Vorbemerkung zum tariflichen Leistungsentgelt
Grundtenor der Tarifvertragsparteien mit der Einführung des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD (VKA) war die Schaffung einer progressiven Managementdenkweise und einer verbesserten betrieblichen Kultur im öffentlichen Dienstleistungssektor. Dabei setzten die Tarifvertragspartner auf folgende Eckpunkte:
· Eine stärkere Differenzierung zwischen guten und schlechten Leistungen.
· Entgeltbestandteile erfolgen variabilisiert und widerruflich.
· Tatsächlich erreichte Ergebnisse sollen bewertet werden (sog. Output-Orientierung).
· Die Verwaltungsführungen erhalten ein Instrumentarium, um genaue Ziele zu definieren, die mit den Mitarbeitern zu erörtern sind, um ein gemeinsames, abgestimmtes Handeln zu erreichen[17].
Im Ergebnis sollten den öffentlichen Arbeitgebern und ihren Beschäftigten dadurch entsprechende Handlungsmechanismen in Anlehnung an das sog. Neue Steuerungsmodell eröffnet werden, um das eigene Prozess-Benchmarking zu optimieren.
Ab dem 01.01.2007 müssen die öffentlichen Arbeitgeber daher unter Einhaltung gewisser Parameter ein entsprechendes Leistungsentgelt an die Beschäftigten entrichten. Das Leistungsentgelt stellt gemäß § 18 Abs. 2 TVöD (VKA) ein zusätzlich zum Tabellenentgelt zu zahlender variabler und leistungsorientierter Vergütungsbestandteil dar. Dafür gibt § 18 TVöD (VKA) die Mindestanforderungen äußerst abstrakt vor, denen ein leistungs- und/oder erfolgsbezogenes Entgeltsystem künftig zu genügen hat und öffnet somit den jeweiligen Betriebsparteien die Möglichkeit, die nähere Ausgestaltung des Entgeltsystems in Form einer Dienst-/Betriebsvereinbarung zu definieren.
3.3 Geltungs- und Anwendungsbereich
Da das Leistungsentgelt ein integraler Bestandteil des TVöD ist, lässt sich der Geltungsbereich demzufolge aus dem § 1 TVöD entnehmen. Dieser Geltungsbereich unterliegt den verpflichteten Bestimmungen des Tarifrechts und ist insofern auch nicht derogierbar. Zur Abhandlung des Geltungsbereiches, differenziert nach einzelnen Sektoren, wird auf das unter Kapitel 2.3 Geschriebene verwiesen. Aus dem allgemeinen Geltungsbereich resultiert der konkrete betriebliche Anwendungsbereich. § 18 Abs. 4 Satz 6 TVöD (VKA) führt hierzu aus, dass das Leistungsentgelt grundsätzlich allen Beschäftigten zugänglich gemacht werden muss. Diese Rechtslage begründet noch keineswegs einen individual-rechtlichen Anspruch eines Arbeitnehmers auf Entrichtung von Leistungsentgelt in einer bestimmten Höhe. Allerdings können die Mitarbeiter die konkrete Umsetzung des § 18 TVöD (VKA) postulieren. Dass dabei Ausnahmen vom allgemeinen Anwendungsbereich statthaft sind, wird durch das Adjektiv grundsätzlich ermöglicht, das im juristischen Sprachgebrauch Abweichungen zulässt. Infolgedessen besteht die Möglichkeit, im Rahmen der noch abzuschließenden Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung eine Reihe von Beschäftigten – wie z. B. befristete Beschäftigte, Probezeitbeschäftigte, Beschäftigte in Elternzeit – nicht zu berücksichtigen[18]. Dies setzt aber eine substantiierte Begründung voraus.
3.4 Ziele des Leistungsentgelts
Das Leistungsentgelt an sich ist kein Ziel. Vielmehr darf es als Werkzeug zur Zielerreichung in Form einer intendierten Nebenfolge verstanden werden[19]. Die Tarifvertragsparteien berücksichtigten im Zuge der Verhandlungen zum Leistungsentgelt im § 18 Abs. 1 und 6 TVöD (VKA) stets allgemeine Rahmenziele, die dem äußeren und inneren Zweck dienen sollen. Insofern wird mit der leistungs- und erfolgsorientierten Bezahlung
· die Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen,
· die Sicherung und Verbesserung von Effektivität und Effizienz, insbesondere für Mehrwertsteigerungen (z. B. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Dienstleistungsqualität und der Kunden-/Bürgerorientierung),
· sowie die Stärkung von Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz verfolgt.
Die vorbezeichneten Kernanliegen sind für die Betriebsparteien als nicht disponible Bedingungen zu verstehen und sollen eine bindende Mindestgrundlage für das betriebliche System zur Umsetzung des Leistungsentgelts darstellen[20]. Mit der Intention der Tarifvertragsparteien zur Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen soll eine zeitgemäße, moderne und leistungsgerechte Form der tariflichen Entlohnung einhergehen. Gerade im Hinblick auf die Personalstruktur, die Personalentwicklung sowie die künftige Personalgewinnung erscheint dieser Aspekt insofern von großer Bedeutung, als dass in der gegenwärtigen Zeit gut qualifizierte Stellenbewerber flexible, leistungsorientierte Entgeltelemente vom öffentlichen Arbeitgeber voraussetzen[21].
Durch die Verbesserung von Effektivität und Effizienz wird beabsichtigt, dass die Beschäftigten selbst eine stärkere Ergebnisorientierung perzipieren, und sich dabei elementare kontextuelle Faktoren – wie z. B. höhere Entgeltgerechtigkeit und Motivation – bilden[22]. Davon soll letztendlich nicht nur das Erscheinungsbild des Arbeitgebers bei den Kunden öffentlicher Dienstleistungen profitieren. Vielmehr müsse sich das Leistungsentgelt als avantgardistisches Führungsinstrumentarium bei leitenden und personalverantwortlichen Angestellten etablieren, in dem das künftige Führen mit Zielen als Erleichterung wirken und zugleich die Verantwortungsbereitschaft sowie die Delegationsmöglichkeit bei der Aufgabenwahrnehmung verstärkt werden sollen.
3.5 Finanzierung und Gesamtvolumen des Leistungsentgelts
Das Leistungsentgelt wird nicht aus zusätzlichen öffentlichen Mitteln finanziert, sondern erfolgt für die Arbeitgeber stets kostenneutral. Folgende Elemente sind für die Finanzierung des Leistungsentgelts vorgesehen:
· Umgewidmete tarifliche Entgeltbestandteile, z. B. die im Jahr 2007 vorgenommenen Einsparungen bei der Umstrukturierung von Urlaubsgeld und Zuwendung zur sog. Jahressonderzahlung.
· Rückfließende Besitzstände, u. a. durch sog. wegfallende Kinder, welche bis zum Zeitpunkt des Wegfallens einen Besitzstand in Höhe des Kinderanteils am Orts- bzw. Sozialzuschlag begründet haben.
· Gesonderte Dotierungen im Rahmen künftiger Tarifrunden[23].
Im Ergebnis erhalten daher die Beschäftigten mit dem Leistungsentgelt ihre entsprechenden Bezüge zurück, auf die sie im Rahmen der Einführung des TVöD sowie im Zuge der Tarifverhandlungen einst verzichten mussten. Jedoch erfolgt die Entlohnung nicht automatisch und linear, sondern – so auch die Kernzielsetzung der Vorschrift – leistungsorientiert und variabel, d. h. im Rahmen einer durch den Arbeitgeber durchgeführten Leistungsbewertung auf Grundlage eines betrieblichen Bewertungssystems[24]. Für Arbeitnehmer, die wegen des Bewertungsergebnisses kein Leistungsentgelt empfangen werden, ist auch keine Kompensation des Ausfalles vorgesehen.
Zur Auszahlung des Leistungsentgelts wird jährlich unter Berücksichtigung der Beurteilungsperiode ein Leistungstopf gebildet. Dieser Leistungstopf weist das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen im jeweiligen Leistungsjahr auf und muss an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden. Somit besteht eine kollektive Sicherung, jedoch kann die Binnenverteilung unter den Beschäftigten sehr unterschiedlich ausfallen. Zur Einführung des Systems im Jahr 2007 wurde bestimmt, dass zunächst 1 % der ständigen Monatsentgelte aller Beschäftigten eines Arbeitgebers bezogen auf das Vorjahr in einen Budgettopf einzubringen sind[25]. Im Zuge der Tarifeinigung im Jahr 2010 verständigten sich die Tarifvertragsparteien auf folgende schrittweise, über vier Jahre gestreckte Staffelung:
· ab 01.01.2010 1,25 %
· ab 01.01.2011 1,50 %
· ab 01.01.2012 1,75 %
· ab 01.01.2013 2,00 %
Die Tarifrunde im Jahr 2018 hat die Höhe des Leistungsentgelts seit dem Jahr 2013 unberührt gelassen, so dass es vorläufig bei diesem Volumen bleibt. Gemäß § 18 Abs. 3 TVöD (VKA) haben die Tarifvertragsparteien allerdings als Zielgröße für die leistungsorientierte Bezahlung 8 % der Entgeltsummen vorgesehen. Jedoch ist es derzeit nicht absehbar, wann diese Größenordnung tatsächlich erreicht werden soll[26]. Ungeachtet dessen können die kommunalen Arbeitgeberverbände es ihren Mitgliedern freistellen, das Volumen des Leistungsentgelts freiwillig bis zu einer bestimmten Höchstgrenze anzuheben. U. a. hat der Hauptausschuss des KAV Bayern mit jüngstem Beschluss vom 06.10.2022 einer Verlängerung der Möglichkeit einer freiwilligen Erhöhung bis maximal 4 % befristet zum 31.12.2024 zugestimmt[27].
Für das Gesamtvolumen des jährlichen Leistungstopfes sind ausschließlich die ständigen Monatsentgelte von Bedeutung. Nach der Protokollerklärung zu § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD (VKA) fallen hierunter das
· Tabellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche Altersvorsorge),
· die in Monatsbeiträgen festgelegten Zulagen einschließlich Besitzstandszulagen, z. B. ständige (Wechsel-)Schichtzulagen,
· Entgelt im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlung und Krankengeldzuschuss), soweit diese im betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt wurden und
· vermögenswirksame Leistungen.
Nicht einbezogen werden hingegen unständige Entgeltbestandteile wie insbesondere Abfindungen, Einmalzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturausgleiche sowie Zeitzuschläge[28].
3.6 Formen des Leistungsentgelts
Das Leistungsentgelt kann nach § 18 Abs. 4 Satz 1 TVöD (VKA) in Form einer Leistungsprämie und/oder Leistungszulage und/oder Erfolgsprämie gewährt werden. Es besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Leistungsformen miteinander zu kombinieren.
3.6.1 Leistungsprämie
Die Leistungsprämie stellt in der Praxis das Hauptinstrumentarium des Leistungsentgelts dar[29].
Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 TVöD (VKA) ist sie in der Regel eine einmalige Zahlung, auch in zeitlicher Abfolge, die im Allgemeinen auf der Basis einer Zielvereinbarung mit dem Beschäftigten oder einer Gruppe von Beschäftigten entrichtet wird. Alternativ kann die Leistungsprämie unter Berücksichtigung des § 18 Abs. 5 Satz 1 TVöD (VKA) auf Grundlage einer systematischen Leistungsbewertung gezahlt werden.
3.6.2 Leistungszulage
Die Leistungszulage ist nach § 18 Abs. 4 Satz 4 TVöD (VKA) eine zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkehrende Zahlung auf der Basis betrieblich vereinbarter systematischer Leistungsbewertung. Von der praktischen Anwendung der Leistungszulage wird jedoch wegen des Verwaltungsaufwands und Dauercharakters abgeraten[30].
3.6.3 Erfolgsprämie
§ 18 Abs. 4 Satz 3 TVöD (VKA) zufolge ist die Erfolgsprämie eine ertragsbezogene Zahlung, die in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bezahlt werden kann. Dabei ist hervorzuheben, dass sie neben dem unter Kapitel 3.5 genannten Gesamtvolumen der Jahresentgeltsummen gewährt wird. Damit erfüllt die Zahlung der Erfolgsprämie – im Gegensatz zur Leistungsprämie oder Leistungszulage – keine Ausschüttungspflicht. Generell ist die Erfolgsprämie nur in den Bereichen sinnvoll, wo sich der wirtschaftliche Unternehmenserfolg tatsächlich messen lässt, demzufolge meist nur bei Kommunalunternehmen oder öffentlichen Arbeitgebern in privater Rechtsform, wie z. B. einer Stadtwerke oder Krankenhaus GmbH[31]. Maßgeblich ist hierbei eine Gesamtwirtschaftlichkeitsbetrachtung, um substanzlose Einspareffekte auszuschließen. Insofern können u. a. durch die Steigerung der Produktivität, das Einsparen von Betriebsmitteln bei gleichen Arbeitsergebnissen oder Entwicklung von Hilfsmitteln zur Effizienzsteigerung einer Erfolgsprämie zugänglich sein[32].
- Quote paper
- Benjamin Leistner (Author), 2023, Mitarbeitermotivation im öffentlichen Dienst. Die Rolle des Leistungsentgelts gemäß § 18 TVöD (VKA), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1407816