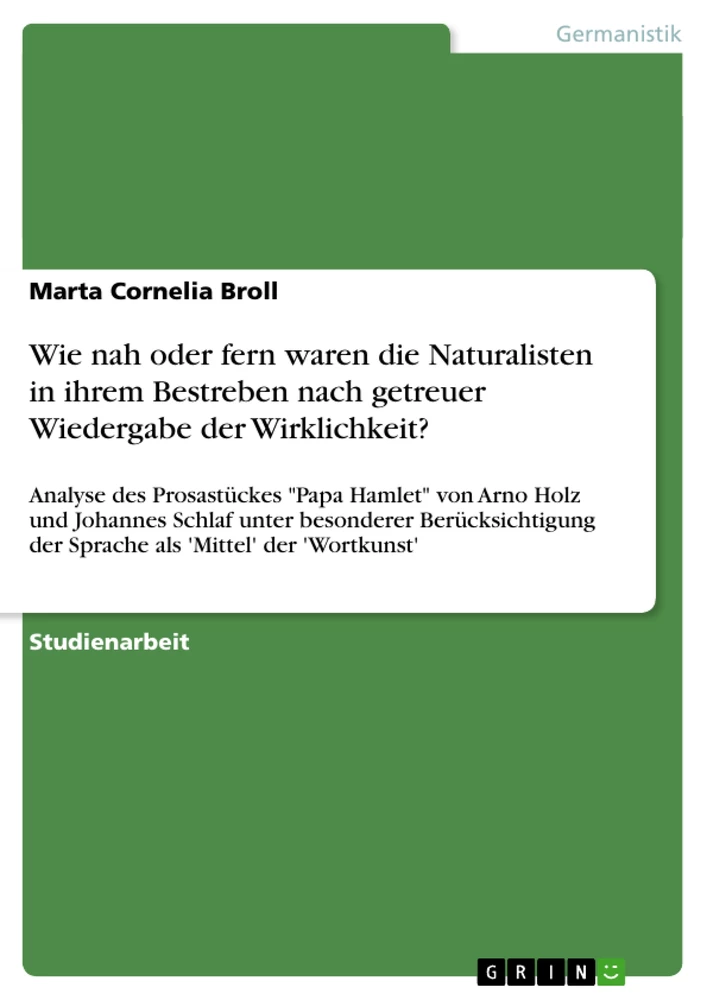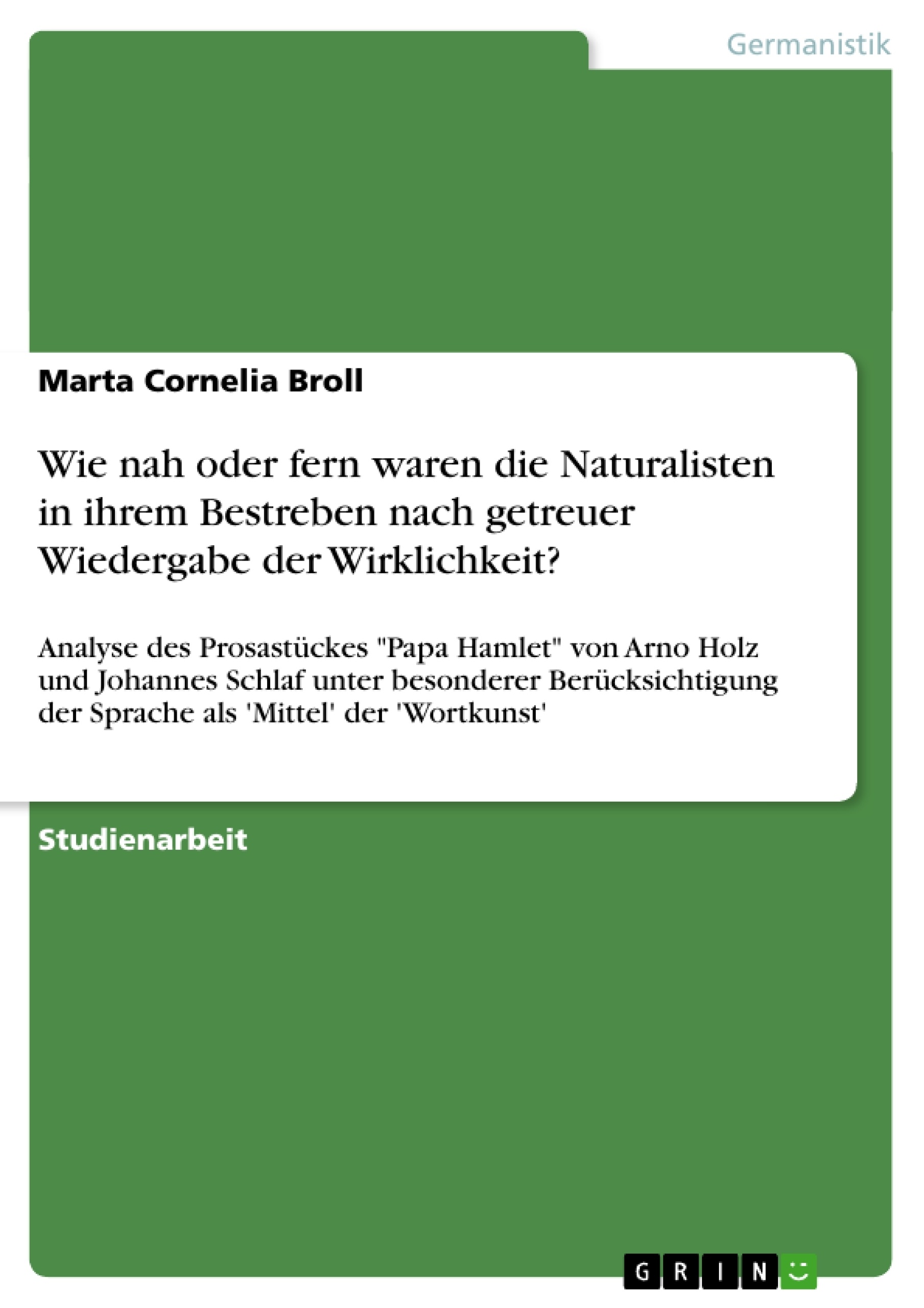Franz von Stuck (1863 - 1928), Mitbegründer der Münchner Sezession (1892), gefeierter Vertreter des Neoklassizismus mit starker Wirkung auf den Jugendstil, wird zu den Münchner
Malerfürsten gezählt und bevorzugte in seinen Werken schwebend-unwirkliche Darstellungen aus dem Reich der Fabel so wie allegorische und symbolhafte Gestaltungsweisen, und
Heinrich Rudolf Zille (1858 - 1929) bevorzugte in seiner Kunst eher Themen aus dem Berliner "Milljöh". Sozialkritisch wie lokalpatriotisch stellte er Szenen und Figuren dar, die
vornehmlich aus sozialen Unterschichten und/oder Randgruppen herausresultierten. Wenn es überhaupt so etwas wie eine naturalistische Zeichenkunst gegeben hat, dann war der
Schilderer der Proletarier- und Kleinbürgerwelt mit Sicherheit einer ihrer Hauptvertreter. Zwei Künstler einer Generation – wodurch sich die berechtigte Frage stellt: „[K]ann es größere Gegensätze zwischen zeitgenössischen Künstlern geben? Und doch, neben ihrem Herkommen aus einfachen Verhältnissen gibt es eine weitere Gemeinsamkeit: beide haben nach Photographien gearbeitet. Zille hat sein »Milieu«, das nach ihm seinen Namen bekommen hat, immer wieder mit der Kamera eingefangen und uns eine Reihe
dokumentarisch wertvoller Aufnahmen hinterlassen. [...] Sein typisch weicher Strich, die in die Szene hineingesetzten Figuren und der makabre Witz der Unterschrift sind freilich seine
Zugaben und geben dem Bild eine Aggressivität, die die Photographie bei aller bedrückenden Düsterheit nicht hat. Von Franz von Stuck wissen wir seit ein paar Jahren, daß er bei
Bildnissen die Umrisse des Kopfes von selbstgefertigten Porträtaufnahmen auf die Leinwand durchpauste.“1 Bei aller Ähnlichkeit des vollendeten Bildes mit der Photographie treten auch bei Franz von Stuck die Unterschiede deutlich hervor. Die eher glasig harte Farbgebung in Stucks Bildern gibt etwas Statuarisch-Pompöses wider, die den Photographien in ihrer
weichen Charakteristik nicht eigen ist. Aber wozu einleitend der Vergleich zwischen Franz von Stuck und Heinrich Rudolf Zille?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der "konsequente" Naturalismus
- Der Zusammenhang – Naturalismus und Industrialisierung
- Die Kunst: Ihr Wesen und ihre Gesetze
- Das literarische Leben – Die revolutionäre Prosa Papa Hamlet als "Dachstubenidyll"
- Holz' und Schlafs Papa Hamlet
- Die Entstehungsgeschichte des Papa Hamlet oder zur Wahl des Pseudonyms
- Rhetorik und Jargon – Die Bedeutung der Sprache als »Mittel« der »Wortkunst« in Papa Hamlet
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Naturalismus in der deutschen Literatur, genauer gesagt mit der Frage, inwiefern sich die Naturalisten dem Streben nach getreuer Wiedergabe der Wirklichkeit verpflichtet fühlten. Im Zentrum der Analyse steht das Prosastück Papa Hamlet von Arno Holz und Johannes Schlaf, wobei besonderes Augenmerk auf die Sprache als "Mittel" der "Wortkunst" gelegt wird.
- Zusammenhang zwischen Naturalismus und Industrialisierung
- Naturwissenschaft als Basis des naturalistischen Selbstverständnisses
- Die Rolle der Sprache in der naturalistischen Literatur
- Die Entstehung und Bedeutung des Prosastücks Papa Hamlet
- Analyse von Arno Holzs literaturtheoretischen Schriften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Unterschiede zwischen den Künstlern Franz von Stuck und Heinrich Rudolf Zille und stellt die Frage nach dem Verhältnis des Naturalismus zur Wirklichkeit. Das erste Kapitel widmet sich dem "konsequenten" Naturalismus, insbesondere Arno Holzs literaturtheoretischen Schriften, die den Zusammenhang zwischen Naturalismus und Industrialisierung, die Rolle der Naturwissenschaften und die Anwendung naturwissenschaftlicher Prinzipien auf die Literatur thematisieren. Im zweiten Kapitel wird der Fokus auf das Prosastück Papa Hamlet von Arno Holz und Johannes Schlaf gerichtet. Hier werden die Entstehungsgeschichte des Werkes, die sprachlichen Besonderheiten und die Rolle der Sprache als "Mittel" der "Wortkunst" beleuchtet.
Schlüsselwörter
Naturalismus, Industrialisierung, Naturwissenschaft, Literaturtheorie, Arno Holz, Johannes Schlaf, Papa Hamlet, Sprache, Wortkunst, Sekundenstil, "Dachstubenidyll".
- Quote paper
- Marta Cornelia Broll (Author), 2009, Wie nah oder fern waren die Naturalisten in ihrem Bestreben nach getreuer Wiedergabe der Wirklichkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140694