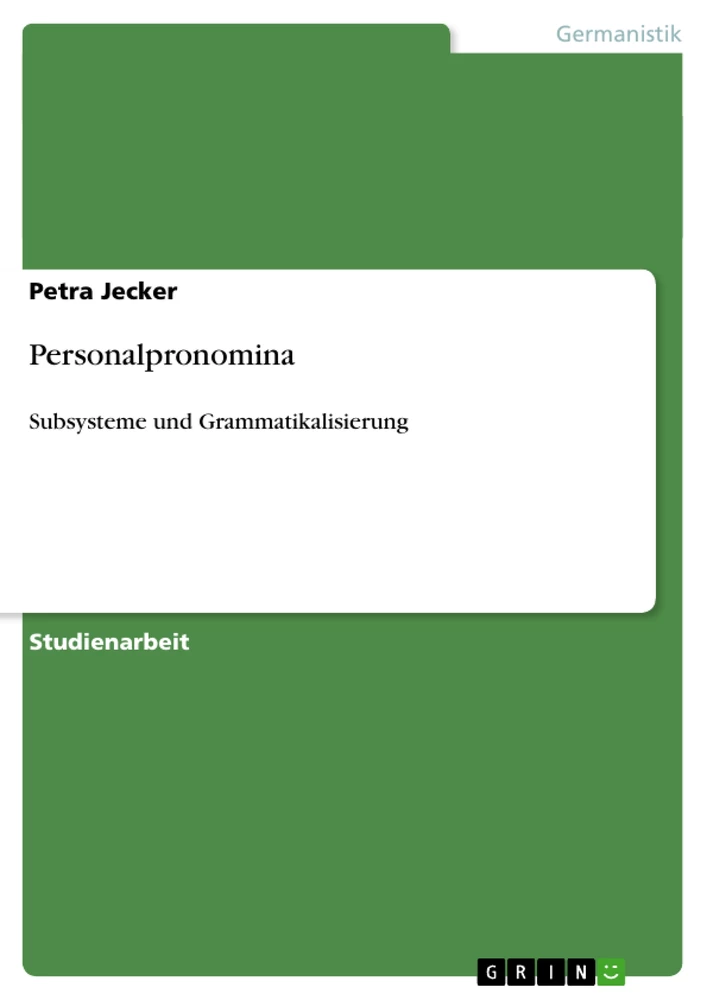Personalpronomina bilden eine Unterklasse der Pronomina. In vielen Sprachen lassen sie sich hinsichtlich ihrer Funktion und z. T. auch ihrer morphologischen Form noch weiter unterteilen. So unterscheidet man in den romanischen Sprachen gängigerweise zwischen starken und klitischen Pronomina. Und auch im Deutschen kann hinsichtlich ihrer Verwendung zwischen betonten und unbetonten Pronomina unterschieden werden. Neuere Untersuchungen von Anna Cardinaletti und Michal Starke weisen darauf hin, dass sich Personalpronomina generell und über verschiedene Sprachen hinweg in drei Typen unterteilen lassen: starke, schwache und klitische Pronomina.
Diese Einteilung in drei Typen entspricht bei näherer Betrachtung einer Abstufung von eher lexikalischen hin zu mehr funktionalen Zeichen. Funktionale (oder auch grammatische) Zeichen unterscheiden sich von lexikalischen dadurch, dass sie keine lexikalisch-semantischen Merkmale tragen. Sie referieren nicht selbständig, sondern sind ausschließlich für die grammatischen Aspekte des Sprachsystems verantwortlich. Dabei ist der Unterschied zwischen lexikalischen und grammatischen Zeichen graduell, d. h., sprachliche Zeichen können nach der Grammatikalisierungstheorie von Christian Lehmann auf einer Skala zwischen diesen beiden Polen eingeordnet werden.
In dieser Arbeit werden die von Cardinaletti und Starke erarbeiteten drei Typen von Personalpronomina anhand deutscher und italienischer Beispiele vorgestellt und auf ihre unterschiedliche Grammatizität hin untersucht. Darauf aufbauend soll festgestellt werden, inwieweit sich diese Unterteilung mit der Grammatikalisierungstheorie von Lehmann vereinbaren lässt und inwiefern die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen füreinander von Nutzen sein können, um gemeinsam zu einem tieferen Verständnis grammatischer Zusammenhänge beizutragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Verschiedene Typen von Personalpronomina
- 2 Das System der Personalpronomina
- 2.1 Personalpronomina: stark vs. defizient
- 2.2 Defiziente Pronomina: schwach vs. klitisch
- 2.2.1 Die defizienten Pronomina des Italienischen
- 2.2.2 Die defizienten Pronomina des Deutschen
- 2.3 Personalpronomina: stark – schwach - klitisch
- 3 Das Grammatikalisierungsmodell von Lehmann
- 3.1 Grammatikalisierung
- 3.2 Bestimmung der Grammatizität
- 3.3 Die Grammatikalisierungsskala
- 3.4 Grammatikalisierungszyklen
- 3.4.1 Grammatikalisierung auf diachroner Ebene
- 3.4.2 Grammatikalisierung auf synchroner Ebene
- 3.4.3 Der Grammatikalisierungszyklus der Personalpronomina
- 4 Die Grammatizität der Personalpronomina
- 4.1 Integrität
- 4.2 Skopus
- 4.2.1 Das Pronomen als Argument des Verbs
- 4.2.2 Das Pronomen und die koreferente DP
- 4.3 Paradigmatizität
- 4.4 Fügungsenge
- 4.4.1 Die Fügungsenge zwischen Pronomen und Verb
- 4.4.2 Die Fügungsenge zwischen Pronomen und koreferenter DP
- 4.5 Wählbarkeit
- 4.5.1 Die Wahl des Paradigmas
- 4.5.2 Die Wahl des Zeichens
- 4.6 Stellungsfreiheit
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Grammatizität der Personalpronomina im Deutschen und Italienischen und analysiert deren Einteilung in drei Typen: starke, schwache und klitische Pronomina. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit diese Einteilung mit der Grammatikalisierungstheorie von Lehmann vereinbar ist.
- Analyse der drei Pronominaltypen nach Cardinaletti und Starke
- Anwendung der Grammatikalisierungstheorie von Lehmann auf die Personalpronomina
- Untersuchung der Grammatizität der Personalpronomina hinsichtlich verschiedener Kriterien
- Vergleich der deutschen und italienischen Personalpronomina
- Beziehung zwischen lexikalischen und grammatischen Zeichen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt die drei Pronominaltypen (stark, schwach, klitisch) vor und erläutert deren Eigenschaften. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die für die Arbeit relevanten Aspekte der Grammatikalisierungstheorie von Lehmann. Kapitel 4 analysiert die Grammatizität der Personalpronomina anhand verschiedener Kriterien, wie Integrität, Skopus, Paradigmatizität, Fügungsenge, Wählbarkeit und Stellungsfreiheit. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Relevanz der Arbeit im Kontext der Grammatikalisierungstheorie.
Schlüsselwörter
Personalpronomina, Grammatikalisierung, Grammatizität, stark, schwach, klitisch, Defizienz, Italienisch, Deutsch, Lehmann, Cardinaletti, Starke, lexikalische Zeichen, grammatische Zeichen, Skopus, Fügungsenge, Wählbarkeit, Stellungsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen zu Personalpronomina
Welche Typen von Personalpronomina werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet nach Cardinaletti und Starke zwischen drei Typen: starken, schwachen und klitischen Pronomina.
Was ist der Unterschied zwischen lexikalischen und grammatischen Zeichen?
Funktionale (grammatische) Zeichen tragen keine lexikalisch-semantischen Merkmale und referieren nicht selbstständig, sondern steuern grammatische Aspekte.
Welche Sprachen werden in der Untersuchung verglichen?
Die drei Pronominaltypen werden anhand von Beispielen aus der deutschen und der italienischen Sprache analysiert.
Welche Rolle spielt die Theorie von Christian Lehmann?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Unterteilung der Pronomina mit Lehmanns Grammatikalisierungstheorie und seiner Skala zwischen lexikalischen und grammatischen Polen vereinbar ist.
Nach welchen Kriterien wird die Grammatizität untersucht?
Die Analyse erfolgt anhand von Kriterien wie Integrität, Skopus, Paradigmatizität, Fügungsenge, Wählbarkeit und Stellungsfreiheit.
- Quote paper
- Petra Jecker (Author), 2000, Personalpronomina, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140445