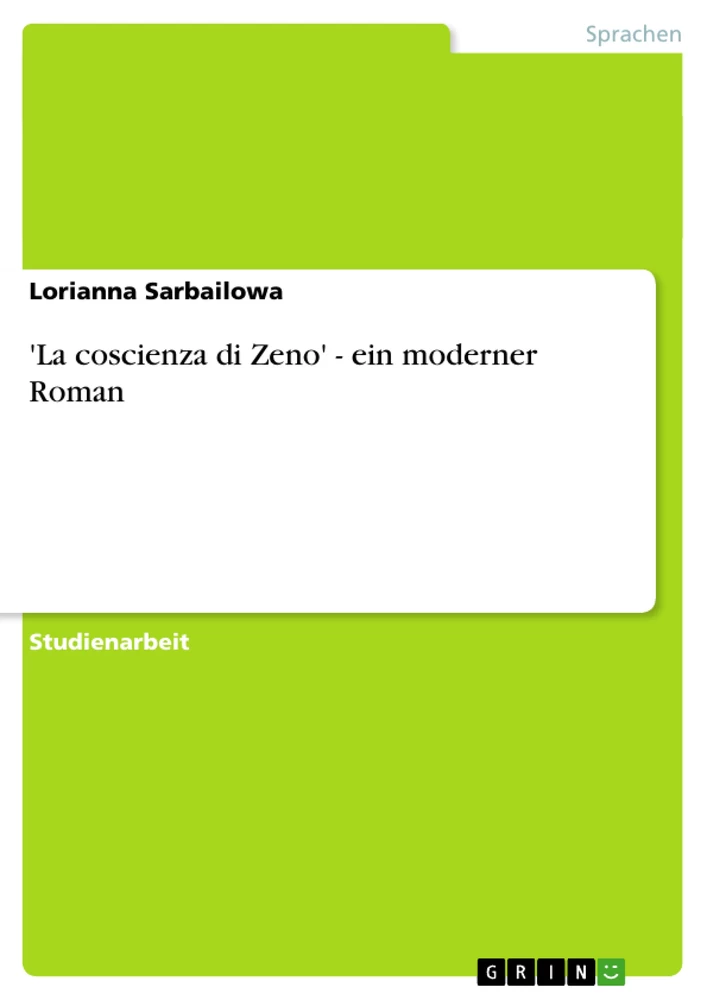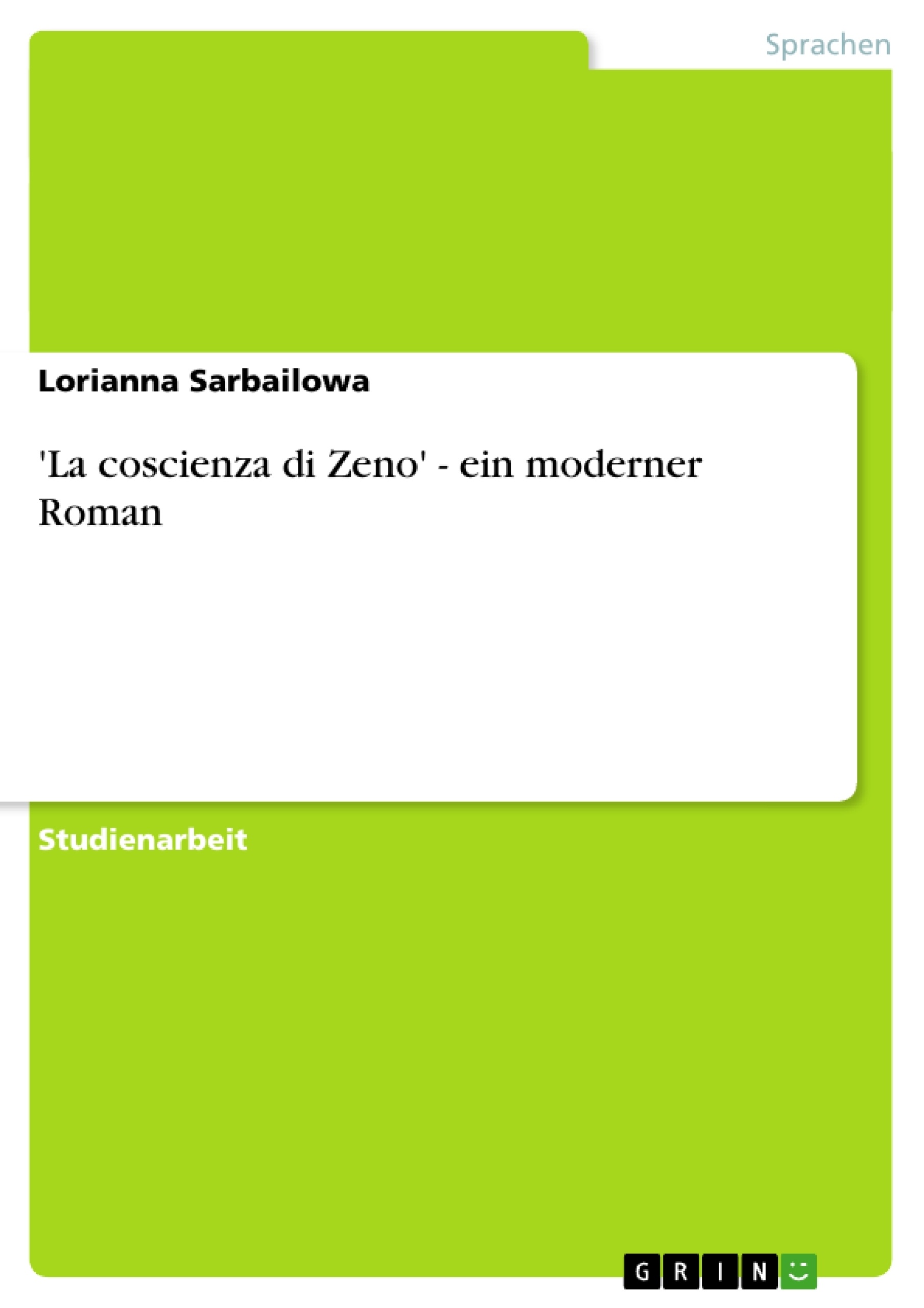Nach Goethe ist die Moderne ein eher moralisch-psychologischer als ein historischer Begriff, der sich durch die Freiheit und das Wollen definiert. Kennzeichnend, als das Charakteristikum der Literatur in der Moderne, ist der Bezug auf sich selbst. Diese Selbstreferenz ist das Resultat der historischen Entwicklungen, wie z. B. der Aufklärung, der Menschenrechte, der Industrialisierung, durch welche der Mensch zum alleinigen Fundament des Lebens wird.
Als Konsequenz der durch die Differenzierung der Gesellschaft sich ergebenen Freiräume der Selektion, die der persönlichen Entscheidung des Einzelnen überlassen und ihm nicht mehr vorgeschrieben sind, wird der Mensch zum Maß aller Dinge. Die Problematik besteht darin, dass diese neu erworbene Freiheit mit Eigenverantwortung und existenzieller Angst verbunden ist, da nun alle Rechtfertigung vom Mensch und nicht mehr von einem Gott ausgeht.
Dieser Paradigmenwechsel beeinflusst die Art und Weise der Repräsentation der Wirklichkeit in der Literatur- immer wichtiger wird die Darstellung der menschlichen Innenwelt und der subjektiven Wahrnehmung gegenüber der Darstellung von der Außenwelt, was die interne Fokalisierung zu einer typisch modernen Form der Wahrnehmungsdarstellung macht.
Eine grundlegende Wandlung hat sich nicht nur in den Erzähltechniken, sondern auch in der Thematik der Inhalte vollzogen. Das nun zentrierte Subjekt ist widersprüchlich, unzuverlässig, gelangweilt oder sogar apathisch und grundsätzlich durch l’inetto geprägt. Mit der Abkehr von der traditionellen epischen Erzählform, die ein Wissen vom Ende des erzählten Geschehens voraussetzt, wird im Zusammenhang mit der Krise des Romans unter anderem das Erzählen an sich problematisiert. Die traditionelle Autorfunktion ändert sich radikal, denn der moderne Autor weiß seinem Leser keinen Rat zu geben, was die Moral der Geschichte im Epos konstituiert. Der Zweck des Schreibens an sich wird zur selbsttherapeutischen Natur und dient oft der Flucht aus der Realität.
Darauf, inwiefern La coscienza di Zeno den Anforderungen der literarischen Moderne bezüglich der eben angesprochen Veränderungen entspricht, wird in den folgenden Kapiteln näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Wahrnehmung vs. Ereignisse
- 2.2 Der Held als inetto
- 2.3 Das Schreiben
- 3. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Italo Svevos Roman "La coscienza di Zeno" im Kontext der literarischen Moderne. Ziel ist es, die Übereinstimmung des Romans mit den charakteristischen Merkmalen der Moderne aufzuzeigen, insbesondere in Bezug auf Erzähltechnik und Thematik. Die Arbeit analysiert, wie Svevo die neu gewonnene Freiheit des modernen Menschen und die damit verbundene existenzielle Angst darstellt.
- Die Dominanz der subjektiven Wahrnehmung über die objektive Darstellung der Ereignisse.
- Die Darstellung des "inetto" als modernen Antihelden.
- Die Funktion des Schreibens als Selbstreflexion und Flucht vor der Realität.
- Die Rolle der Psychoanalyse in der Interpretation des Romans.
- Die Problematik des Erzählens in der Moderne.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der literarischen Moderne ein und definiert sie anhand von Goethes Verständnis als moralisch-psychologischen Begriff, der durch Freiheit und Wollen gekennzeichnet ist. Sie hebt die Selbstreferenzialität moderner Literatur hervor, ein Resultat historischer Entwicklungen wie Aufklärung und Industrialisierung, die den Menschen zum Mittelpunkt des Lebens machen. Die damit verbundene Freiheit wird als ambivalent dargestellt, verbunden mit Eigenverantwortung und existenzieller Angst aufgrund fehlender göttlicher Rechtfertigung. Die Einleitung skizziert die Veränderungen in Erzähltechniken und Thematik, die die moderne Literatur prägen, und kündigt die Analyse von "La coscienza di Zeno" in diesem Kontext an.
2. Hauptteil: Der Hauptteil analysiert verschiedene Aspekte von "La coscienza di Zeno". Zunächst wird der Schwerpunkt auf die Dominanz der Erlebnisebene über die Ereignisebene gelegt, wobei die Selbstanalyse des Protagonisten Zeno Cosini im Mittelpunkt steht. Zenos Negierung metaphysischen Glaubens und die Wahrnehmung der Sinnlosigkeit des Lebens werden diskutiert. Der Hauptteil untersucht, wie Reflexion und Denkexperimente die Handlung in den Hintergrund drängen. Die Arbeit beleuchtet die Anwendung psychoanalytischer Konzepte im Roman, wobei Svevos kritische Distanz zur Psychoanalyse betont wird. Die Thematik von Krankheit und Gesundheit wird als durchgängiges Motiv des Romans herausgestellt, das Svevo spielerisch ironisiert. Der Abschnitt befasst sich mit der Unzuverlässigkeit der Erinnerungen und der Auflösung des Handlungs- und Zeitablaufs, die für den modernen Roman typisch sind. Die Ratlosigkeit des Erzählers spiegelt die Ratlosigkeit des modernen Menschen wider, im Kontrast zur traditionellen Erzählform, in der der Erzähler dem Leser Rat geben kann.
Schlüsselwörter
La coscienza di Zeno, Italo Svevo, Moderne Literatur, inetto, Selbstreflexion, Psychoanalyse, Subjektivität, Erinnerung, Erzähltechnik, Existenzialismus, Sinnlosigkeit des Lebens.
Häufig gestellte Fragen zu Italo Svevos "La coscienza di Zeno"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Italo Svevos Roman "La coscienza di Zeno" im Kontext der literarischen Moderne. Sie untersucht, wie Svevo die charakteristischen Merkmale der Moderne in Bezug auf Erzähltechnik und Thematik in seinem Roman darstellt, insbesondere die neu gewonnene Freiheit des modernen Menschen und die damit verbundene existenzielle Angst.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Dominanz der subjektiven Wahrnehmung über die objektive Darstellung der Ereignisse, die Darstellung des "inetto" als modernen Antihelden, die Funktion des Schreibens als Selbstreflexion und Flucht vor der Realität, die Rolle der Psychoanalyse in der Interpretation des Romans und die Problematik des Erzählens in der Moderne.
Wie ist der Roman nach Kapiteln strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und Schlussbemerkungen. Die Einleitung führt in die Thematik der literarischen Moderne ein und definiert sie anhand von Goethes Verständnis. Sie hebt die Selbstreferenzialität moderner Literatur hervor und kündigt die Analyse von "La coscienza di Zeno" an. Der Hauptteil analysiert verschiedene Aspekte des Romans, wie die Dominanz der Erlebnisebene, die Selbstanalyse des Protagonisten, die Anwendung psychoanalytischer Konzepte und die Unzuverlässigkeit der Erinnerungen. Die Schlussbemerkungen fassen die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse in der Interpretation des Romans?
Die Arbeit beleuchtet die Anwendung psychoanalytischer Konzepte im Roman, wobei Svevos kritische Distanz zur Psychoanalyse betont wird. Psychoanalytische Konzepte dienen als Werkzeug zur Interpretation von Zenos Charakter und Handlungen, aber der Roman wird nicht rein psychoanalytisch interpretiert.
Wie wird der "inetto" in dem Roman dargestellt?
Der Roman stellt Zeno Cosini als "inetto" dar, einen modernen Antihelden, der durch seine Unfähigkeit zum Handeln und seine ständige Selbstreflexion charakterisiert ist. Seine Ratlosigkeit spiegelt die Ratlosigkeit des modernen Menschen wider.
Welche Bedeutung hat das Schreiben im Roman?
Das Schreiben im Roman dient als Mittel der Selbstreflexion und als Flucht vor der Realität. Durch das Aufschreiben seiner Erinnerungen versucht Zeno, sich selbst und sein Leben zu verstehen, aber gleichzeitig entzieht er sich der direkten Konfrontation mit seinen Problemen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Roman und die Analyse?
Schlüsselwörter sind: La coscienza di Zeno, Italo Svevo, Moderne Literatur, inetto, Selbstreflexion, Psychoanalyse, Subjektivität, Erinnerung, Erzähltechnik, Existenzialismus, Sinnlosigkeit des Lebens.
Welche Erzähltechniken werden im Roman verwendet und wie werden diese im Kontext der Moderne interpretiert?
Der Roman zeichnet sich durch eine unzuverlässige Erzählperspektive aus, die die subjektive Wahrnehmung Zenos betont. Die Auflösung des Handlungs- und Zeitablaufs sowie die Dominanz der Reflexion über die Handlung sind typisch für moderne Erzähltechniken und spiegeln die Unsicherheit und Fragmentierung der modernen Erfahrung wider.
- Citation du texte
- Lorianna Sarbailowa (Auteur), 2009, 'La coscienza di Zeno' - ein moderner Roman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140426