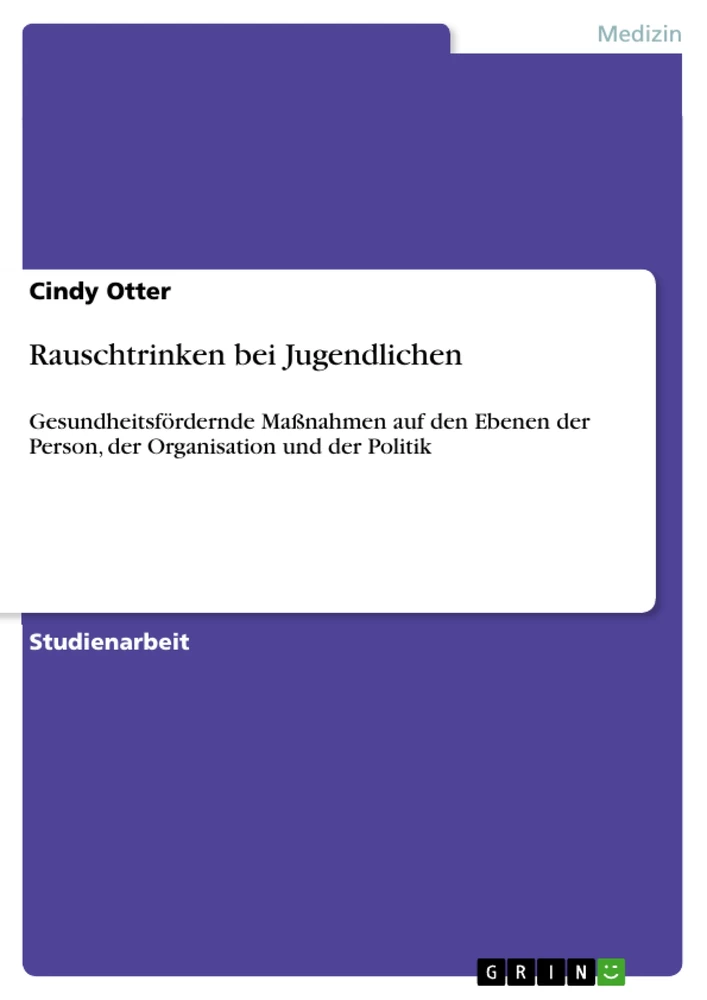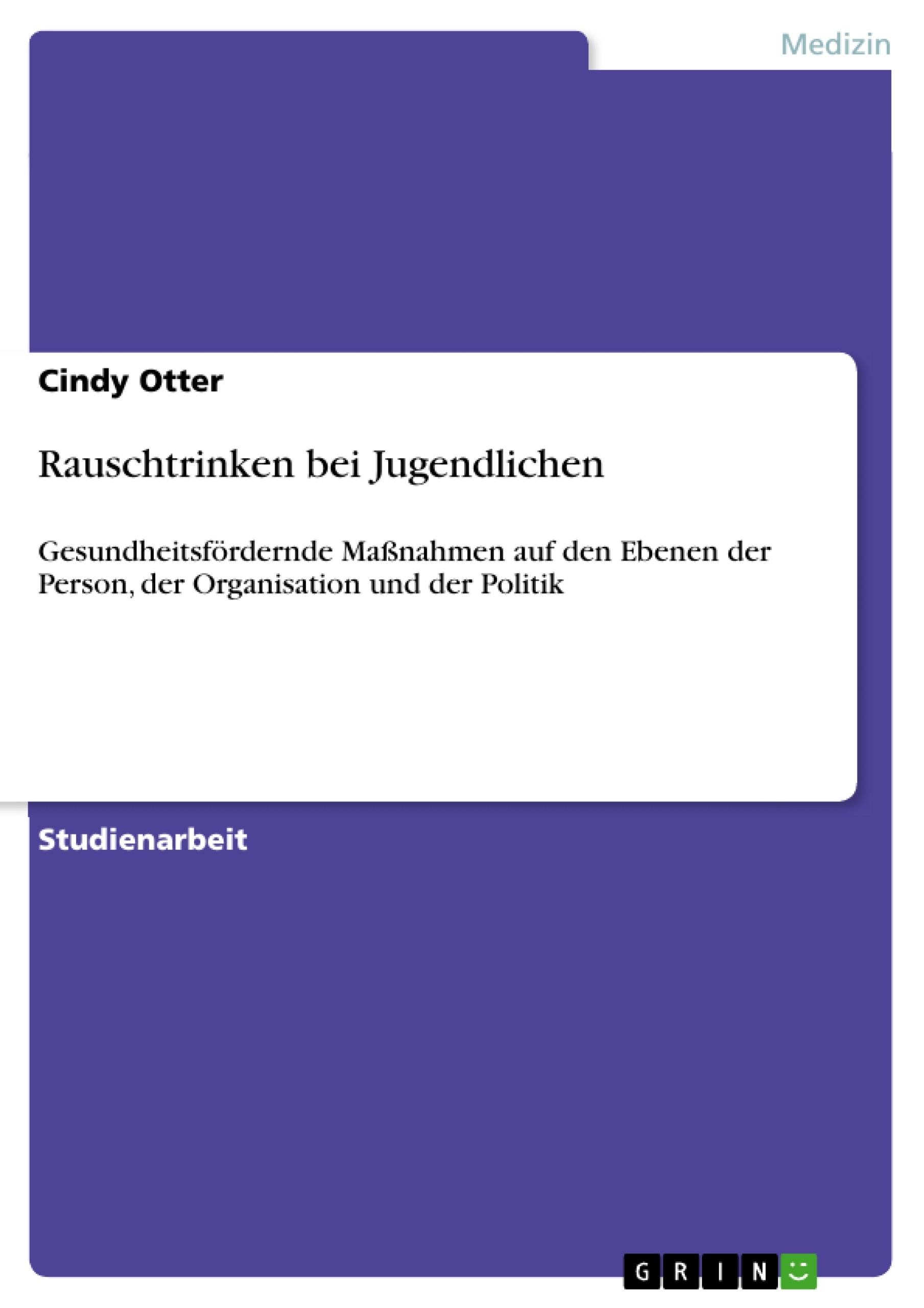Das Rauschtrinken ist in der Bundesrepublik Deutschland weit verbreitet, derzeit sehr präsent und nimmt seit Jahren unter den Jugendlichen stetig zu. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, gesundheitsfördernde Ansätze für Jugendliche im Hinblick auf ihre Person, die Organisation und die Politik zu entwickeln.
Gliederung
1. Einleitung
2. Definitionen
2.1. Gesundheitsförderung
2.2. Rauschtrinken
3. Problemdarstellung
4. Ansätze zur Gesundheitsförderung
4.1. Allgemein
4.2. Ebene der Person
4.3. Ebene der Organisation
4.4. Ebene der Politik
5. Schlussfolgerung
6. Literaturverzeichnis
7. Internetverzeichnis
1. Einleitung
Das Rauschtrinken ist in der Bundesrepublik Deutschland weit verbreitet, derzeit sehr präsent und nimmt seit Jahren unter den Jugendlichen stetig zu. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, gesundheitsfördernde Ansätze für Jugendliche im Hinblick auf ihre Person, die Organisation und die Politik zu entwickeln.
2. Definitionen
2.1. Gesundheitsförderung
„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 1996, S. 45-46).
2.2. Rauschtrinken
Die Weltgesundheitsorganisation definiert den englischen Begriff ‚binge drinking’ (binge [engl.]: Gelage) als „heftigen episodischen Alkoholkonsum mit dem Ziel, einen Alkoholrausch herbeizuführen“. Im deutschsprachigen Raum wird die Trinkmotivation, „einen Rausch herbeizuführen“ in der Wortwahl ‚Rauschtrinken’ noch deutlicher hervorgehoben (Gusy u. Quappen, 2007).
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Sabine Bätzing spricht in der Publikation „Drogen- und Suchtbericht 2009“ vom „Binge-Drinking“, wenn mindestens fünf Gläser alkoholischer Getränke hintereinander getrunken werden (Bätzing, 2009).
3. Problemdarstellung
Nach der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von 2008 haben bereits 75% der Zwölf- bis 17-Jährigen wenigstens einmal in ihrem Leben Alkohol konsumiert. In einer Befragung der BZgA geben 20,8% der Jugendlichen an, dem innerhalb der letzen 30 Tage mindestens einmal nachgekommen zu sein. 8,2% der Jugendlichen konsumieren Alkohol in riskanten und gefährlichen Mengen. Gemäß der aktuellen Datenlage trinken im Durchschnitt 17,4% der Zwölf- bis 17-jährigen einmal wöchentlich alkoholische Getränke. Auch der tägliche Konsum bei Jugendlichen ist nicht unbedenklich. 8% überschreiten hierbei den Maximalwert an Alkohol, den ein Erwachsener körperlich bewältigen kann (bei Männern 24 Gramm bzw. bei Frauen 12 Gramm reiner Alkohol). Bereits 2,5% der männlichen und 1,5% der weiblichen Jugendlichen erreichen Werte, die bei Erwachsenen als gefährlicher oder Hochkonsum gelten (bei Männern 60 Gramm bzw. bei Frauen 40 Gramm reiner Alkohol) (Bätzing, S., 2009).
2007 mussten 23.165 Kinder und Jugendliche aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums stationär behandelt werden. Damit ist seit dem Jahr 2000 ein Anstieg um 105% zu verzeichnen (Statistika, 2009).
Im Juni 2009 wurden von der Berliner Polizei 163 Kinder und Jugendliche alkoholisiert aufgegriffen. Im ersten Halbjahr waren es insgesamt 1.083 Personen dieser Altersgruppen (Pressemeldung Berliner Polizei, 2009).
Gründe für das Rauschtrinken sind unter anderem der Spaß daran, der Zeitvertreib, die gewollte Enthemmung sowie die Beeinflussung und Animation zum Mittrinken. Teilweise verfallen Jugendliche dem Rauschtrinken aufgrund des Leistungsdrucks, der durch die Schule, Familienangehörige oder Freunde ausgelöst wird. Aber auch Missbrauchs- und Gewalterfahrungen gehören dazu (Stumpp, G., Stauber, B., Reinl, H., 2009).
4. Ansätze zur Gesundheitsförderung
4.1. Allgemein
Um gesundheitsfördernd agieren zu können, ist eine konsequente und strukturierte Zusammenarbeit der Verantwortlichen der Regierung, des Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswesens, der nichtstaatlichen Einrichtungen sowie in den selbstorganisierten Vereinen und regionalen Institutionen Voraussetzung.
4.2. Ebene der Person
In erster Linie fungieren die Eltern als Vorbilder. Sie sollten sich dessen bewusst sein und ihren Aufsichtspflichten nachkommen. Hierbei sind sie insbesondere vor dem erstmaligen Kontakt ihrer Kinder mit Alkohol für eine gewissenhafte Aufklärung verantwortlich. Durch gezielte Erziehungsmaßnahmen können sie ihre Kinder beizeiten zum selbständigen und verantwortungsvollen Handeln instruieren, die Entwicklung von schulischen und beruflichen Perspektiven beeinflussen sowie die Stärkung der allgemeinen Lebenskompetenzen fördern. Eigenständiges Austragen von Konflikten, faires Verhalten, Abschätzen von Risiken, Selbstvertrauen und -bewusstsein sind eine hilfreiche Voraussetzung gegen eine Abhängigkeit und das Rauschtrinken. Ferner muss auch das soziale Umfeld beachtet werden. Jugendliche sollten Wert auf einen Freundeskreis legen, in dem sie sich frei bewegen und entfalten können und mit dem sie gemeinsam sinnvolle Tätigkeiten im Rahmen der Freizeitgestaltung anstreben. Der regelmäßige Schulbesuch bzw. eine Ausbildung könnten sich ebenso positiv auswirken. Um einen voreiligen Griff zum Alkohol vorzubeugen bzw. einen sorgfältigen Umgang damit zu erlernen, kann mit bestimmten Maßnahmen gezielt interveniert werden. Mögliche Ansätze sind Schulungen im Anti-Aggressions-, Mental- und autogenen Training, in der Einübung von Coping- und Konfliktstrategien sowie Meditation. Die Jugendlichen entwickeln Verhaltensweisen, um ihre Frustrationsgrenze weiter zu stabilisieren. Bei der personenbezogenen Ebene ist jedoch relevant, dass sich der Jugendliche selbstständig motiviert, die Initiativen zu ergreifen, um zu intervenieren.
4.3. Ebene der Organisation
Schulen und Ausbildungsbetriebe sollten auf der organisatorischen Ebene federführend sein. Gesundheitsfördernde Programme müssen integraler Bestandteil der Stundenpläne sein. Der Unterricht kann in Bezug auf die Gesundheitsförderung durch die Schüler frei gestaltet werden. Beispielsweise kann im Rahmen der Aufklärung die Konfrontationen mit jugendlichen Opfern übermäßigen Alkoholkonsums stattfinden, die von ihren „Erlebnissen“ berichten, die daraus resultierenden Folgen verdeutlichen und als „prägendes“ Beispiel fungieren. In Schulen muss eine übersichtliche Infrastruktur herrschen, um den Schülern entsprechende Informationen auszuhändigen oder an adäquate Stellen der Gesundheitsförderung weiter zu leiten.
Eine beträchtliche Anzahl von Jugendlichen hat alkoholabhängige Eltern. Es gibt vereinzelt Selbsthilfegruppe in Deutschland, die sich neben ihren eigentlichen Aufgaben auch Kinder- und Jugendgruppen widmen. Dazu gehören unter anderem die „Guttempler“. Zusammen mit anderen Betroffenen lernen Kinder und Jugendliche einen besseren Umgang mit der Erkrankung ihrer Eltern, werden zugleich aufgeklärt und bekommen Strategien vermittelt, um den Risiken des Rauschtrinkens oder der eigenen Abhängigkeit rechtzeitig zu begegnen. Die „Guttempler“ kooperieren mit anderen Vereinen, die insbesondere für Kinder und Jugendliche abhängiger Eltern konzipiert sind. Dieses zusätzliche Angebot in Selbsthilfegruppen muss stärker ausgebaut werden, um noch mehr Betroffene zu erreichen (Guttempler).
[...]
- Citation du texte
- Cindy Otter (Auteur), 2009, Rauschtrinken bei Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140269