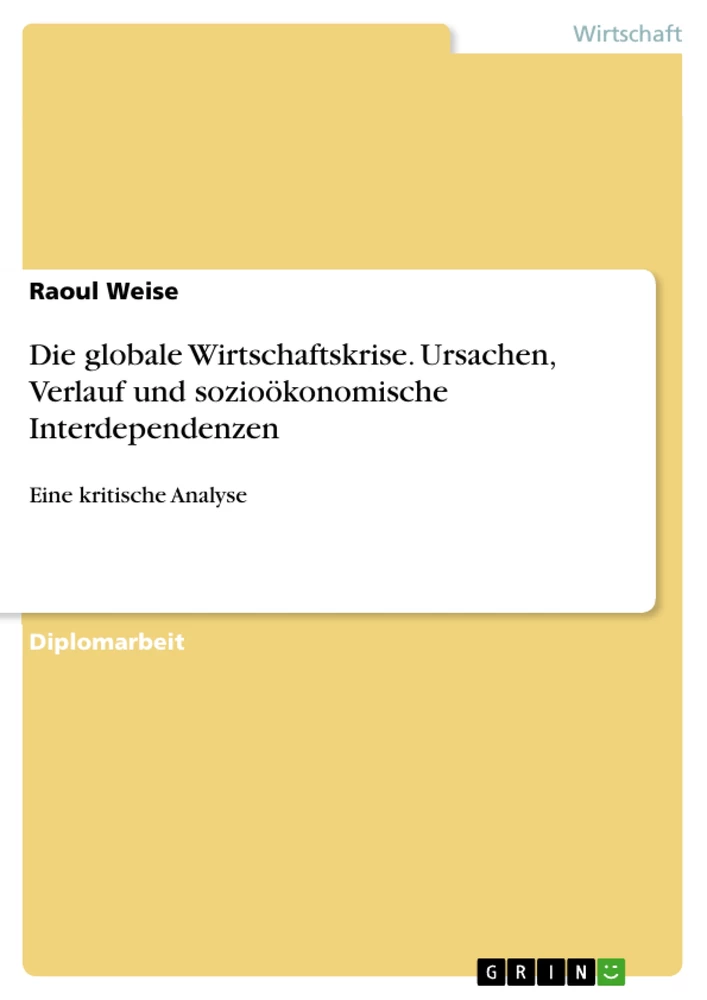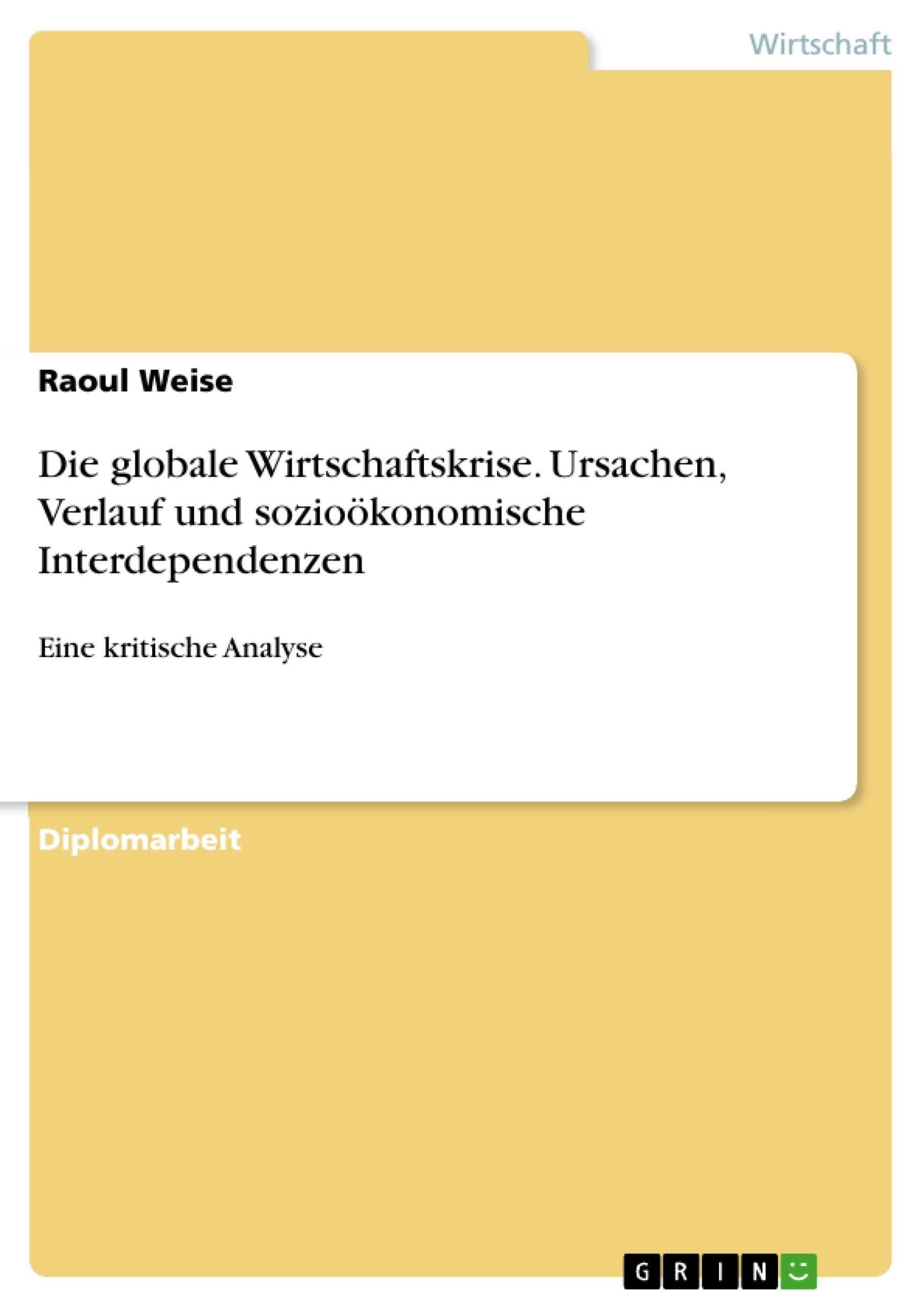Ausgelöst durch den Handel mit verbrieften Hypothekenkrediten entwickelte sich 2007 die so genannte Subprime-Krise, die den unmittelbaren Anlass, nicht jedoch die Ursache, für die Herausbildung der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise darstellt. In Anlehnung an grundlegende Thesen der ökonomischen Blasenmodelle von Galbraith, Fischer-Minsky-Kindleberger sowie Hayek wurden mögliche Krisenursachen sozioökonomisch analysiert, wobei auf eine formale Darstellung verzichtet wurde. Anhand der Thesen aus den Modellen konnten systemische Risiken nachgewiesen werden. Als ursächlich erwiesen sich in differenzierter Ausprägung die (De-)regulierung der Finanzmärkte seit dem Ende des Systems von Bretton Woods, eine wachsende Einkommens- und Vermögensungleichheit in der Bevölkerung sowie die gestiegene Bedeutung des Leverage-Effekts bzw. der Fremdfinanzierung. Darüber hinaus haben jüngere „Finanzinnovationen“ einen erheblichen Beitrag für das Entstehen der Krise geleistet und auch die Politik der Zentralbanken scheint ex-post Schwächen aufzuweisen. Eine weiterführende Untersuchung sollte sich diesen Themenbereichen widmen, um mögliche Reformansätze prüfen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Finanzmarkt
- Der Terminus Finanzmarkt-Kapitalismus
- Ökonomische Blasenmodelle
- Der Erklärungsversuch spekulativer Euphorie von Galbraith
- Das Fischer-Minsky-Kindleberger-Modell
- Unterschiede der ökonomischen Blasenmodelle
- Konjunkturelle Turbulenzen durch verzerrte Zinssätze nach Hayek
- Zwischenfazit
- Strukturelle Krisenursachen
- Die (De-)Regulierung der Finanzmärkte
- Die Shareholder-Value-Orientierung
- Entkopplung des Finanzsektors von der Realwirtschaft?
- Der wachsende Reichtum bei zunehmender Ungleichheit?
- Pensionsfonds und die kapitalgedeckte Altersvorsorge
- Zwischenfazit
- Unmittelbare Krisenursachen
- Verschuldung als Renditehebel
- Private-Equity-Fonds
- Hedge-Fonds
- Zwischenfazit
- Die Praxis der Kreditverbriefung
- Pfandbriefe, Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)
- Collateralized Debt Obligation (CDO) und weitere Finanzinnovationen
- Zwischenfazit
- Die Rolle der Zentralbanken
- Die Federal Reserve Bank und die Europäische Zentralbank
- Zwischenfazit
- Der vorläufige Verlauf des Finanzmarkt-Crashs
- Verschuldung als Renditehebel
- Resumé
- Die ökonomischen Blasenmodelle
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die globale Wirtschaftskrise von 2007 kritisch, indem sie die Ursachen, den Verlauf und die sozioökonomischen Interdependenzen untersucht. Es wird auf formale ökonomische Modelle verzichtet und stattdessen ein sozioökonomischer Ansatz gewählt.
- Analyse der Ursachen der globalen Wirtschaftskrise
- Untersuchung des Verlaufs der Krise
- Analyse der sozioökonomischen Interdependenzen
- Bewertung der Rolle der (De-)Regulierung der Finanzmärkte
- Beurteilung der Bedeutung von Einkommens- und Vermögensungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die globale Wirtschaftskrise ab 2007, beginnend mit der Subprime-Krise als unmittelbarem Anlass, aber nicht als alleinige Ursache. Es wird ein sozioökonomischer Ansatz verfolgt, der sich auf die Analyse systemischer Risiken konzentriert, ohne auf formale ökonomische Modelle zurückzugreifen. Die Arbeit skizziert die zentralen Fragestellungen und den methodischen Ansatz.
Der Finanzmarkt: Dieses Kapitel liefert eine grundlegende Einführung in die Struktur und Funktionsweise des Finanzmarktes, um den Kontext für die nachfolgende Krisenanalyse zu schaffen. Es beschreibt die verschiedenen Akteure, Instrumente und Mechanismen, die im Finanzsystem eine Rolle spielen und für das Verständnis der Krise unerlässlich sind.
Der Terminus Finanzmarkt-Kapitalismus: Dieses Kapitel definiert und kontextualisiert den Begriff „Finanzmarkt-Kapitalismus“ und diskutiert dessen Bedeutung im Zusammenhang mit der Entstehung und dem Verlauf der globalen Wirtschaftskrise. Es werden die verschiedenen Aspekte und Implikationen dieses Systems beleuchtet, um den Rahmen für die folgende Analyse zu setzen.
Ökonomische Blasenmodelle: Dieses Kapitel präsentiert und vergleicht verschiedene ökonomische Blasenmodelle von Galbraith, Fischer-Minsky-Kindleberger und Hayek. Es analysiert deren jeweilige Erklärungsansätze für die Entstehung von ökonomischen Blasen und deren Zusammenbruch, um ein umfassenderes Verständnis der Ursachen der Krise zu ermöglichen. Die Kapitel analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Modelle kritisch.
Strukturelle Krisenursachen: Dieses Kapitel beleuchtet strukturelle Faktoren, die zur globalen Finanzkrise beigetragen haben. Es untersucht die (De-)Regulierung der Finanzmärkte seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems, die Shareholder-Value-Orientierung, die Entkopplung des Finanzsektors von der Realwirtschaft und die zunehmende Einkommens- und Vermögensungleichheit. Zusätzlich wird die Rolle von Pensionsfonds und der kapitalgedeckten Altersvorsorge analysiert.
Unmittelbare Krisenursachen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die unmittelbaren Auslöser der Krise. Es analysiert die Rolle von Verschuldung als Renditehebel (u.a. Private-Equity- und Hedgefonds), die Praxis der Kreditverbriefung (ABS, MBS, CDOs und weitere Finanzinnovationen) und die Rolle der Zentralbanken (Fed und EZB). Die Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren werden detailliert untersucht.
Resumé: Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die wichtigsten Schlussfolgerungen dar. (Dies ist nur eine Platzhalter-Zusammenfassung, da der Inhalt des Kapitels nicht zur Verfügung steht.)
Die ökonomischen Blasenmodelle: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der ökonomischen Blasenmodelle und ihre Anwendbarkeit auf die globale Finanzkrise. (Dies ist nur eine Platzhalter-Zusammenfassung, da der Inhalt des Kapitels nicht zur Verfügung steht.)
Ausblick: Dieses Kapitel präsentiert einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und mögliche Konsequenzen der Krise. (Dies ist nur eine Platzhalter-Zusammenfassung, da der Inhalt des Kapitels nicht zur Verfügung steht.)
Schlüsselwörter
Globale Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Subprime-Krise, ökonomische Blasenmodelle, (De-)Regulierung, Finanzmärkte, Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, Leverage-Effekt, Fremdfinanzierung, Finanzinnovationen, Zentralbanken, systemische Risiken.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Analyse der globalen Wirtschaftskrise von 2007
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert kritisch die globale Wirtschaftskrise ab 2007. Sie untersucht die Ursachen, den Verlauf und die sozioökonomischen Interdependenzen der Krise. Dabei verzichtet sie auf formale ökonomische Modelle und verfolgt stattdessen einen sozioökonomischen Ansatz.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ursachen der globalen Wirtschaftskrise, den Verlauf der Krise, die sozioökonomischen Interdependenzen, die Rolle der (De-)Regulierung der Finanzmärkte, die Bedeutung von Einkommens- und Vermögensungleichheit, sowie verschiedene ökonomische Blasenmodelle (Galbraith, Fischer-Minsky-Kindleberger, Hayek).
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen sozioökonomischen Ansatz und verzichtet auf formale ökonomische Modelle. Der Fokus liegt auf der Analyse systemischer Risiken und der Untersuchung struktureller und unmittelbarer Krisenursachen.
Welche ökonomischen Blasenmodelle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht und vergleicht die ökonomischen Blasenmodelle von Galbraith, Fischer-Minsky-Kindleberger und Hayek. Sie analysiert deren Erklärungsansätze für die Entstehung und den Zusammenbruch ökonomischer Blasen und bewertet Gemeinsamkeiten und Unterschiede kritisch.
Welche strukturellen Krisenursachen werden behandelt?
Zu den behandelten strukturellen Krisenursachen gehören die (De-)Regulierung der Finanzmärkte, die Shareholder-Value-Orientierung, die mögliche Entkopplung des Finanzsektors von der Realwirtschaft und die zunehmende Einkommens- und Vermögensungleichheit. Die Rolle von Pensionsfonds und der kapitalgedeckten Altersvorsorge wird ebenfalls analysiert.
Welche unmittelbaren Krisenursachen werden untersucht?
Die unmittelbaren Auslöser der Krise, die in der Arbeit behandelt werden, sind Verschuldung als Renditehebel (mit Fokus auf Private-Equity- und Hedgefonds), die Praxis der Kreditverbriefung (ABS, MBS, CDOs und weitere Finanzinnovationen), und die Rolle der Zentralbanken (Fed und EZB).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Globale Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Subprime-Krise, ökonomische Blasenmodelle, (De-)Regulierung, Finanzmärkte, Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, Leverage-Effekt, Fremdfinanzierung, Finanzinnovationen, Zentralbanken, systemische Risiken.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum Finanzmarkt, zum Finanzmarktkapitalismus, zu ökonomischen Blasenmodellen, zu strukturellen und unmittelbaren Krisenursachen, einem Resümee, einer detaillierten Analyse der ökonomischen Blasenmodelle und einem Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis ist ebenfalls enthalten.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die jeweils die zentralen Inhalte und Ergebnisse kurz beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse der globalen Wirtschaftskrise von 2007 in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Raoul Weise (Author), 2009, Die globale Wirtschaftskrise. Ursachen, Verlauf und sozioökonomische Interdependenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140250