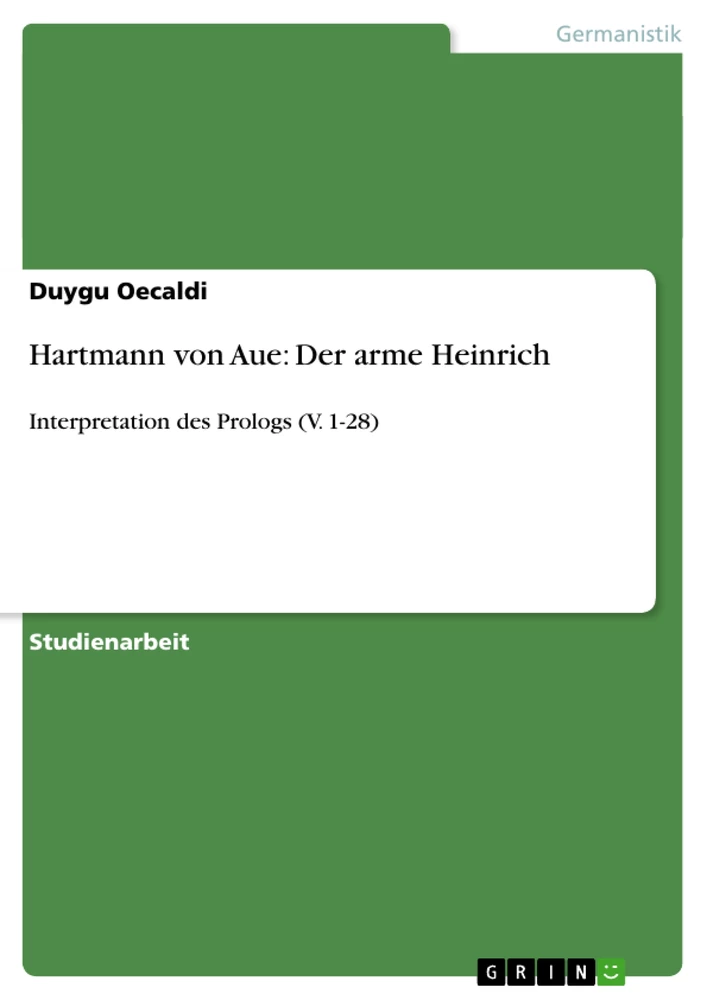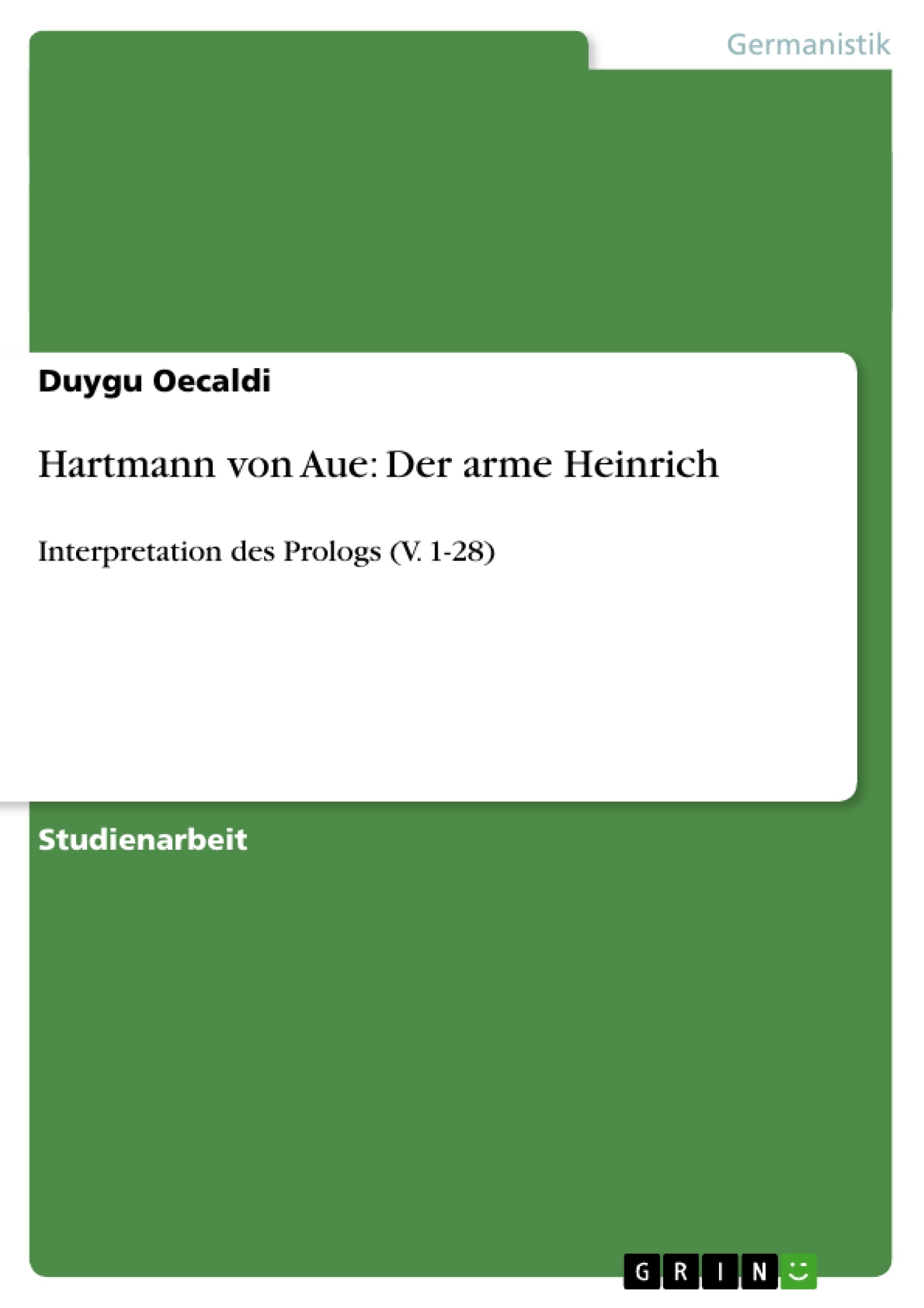Zu Beginn meiner Seminararbeit zum Prolog des Werkes Der arme Heinrich von Hartmann von Aue werde ich zunächst auf die Biographie des Autors eingehen, anschließend eine kurze Inhaltsangabe der gesamten Verserzählung vornehmen und daraufhin den Prolog (V.1-28) interpretieren. Zum Schluss werde ich noch ein kurzes Fazit ziehen.
Das Ziel dieser Strukturierung der Seminararbeit ist es, einen möglichst guten Zusammenhang zwischen Autor und Werk aufzubauen, um die Interpretation des Prologs verständlicher zu machen, da es sehr auf den Autor reflektiert ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Hartmann von Aues Biographie
2.2 Inhaltsangabe des Werkes Der Arme Heinrich
2.3 Interpretation des Prologs
3.Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Zu Beginn meiner Seminararbeit zum Prolog des Werkes Der arme Heinrich von Hartmann von Aue werde ich zunächst auf die Biographie des Autors eingehen, anschließend eine kurze Inhaltsangabe der gesamten Verserzählung vornehmen und daraufhin den Prolog (V.1-28) interpretieren. Zum Schluss werde ich noch ein kurzes Fazit ziehen.
Das Ziel dieser Strukturierung der Seminararbeit ist es, einen möglichst guten Zusammenhang zwischen Autor und Werk aufzubauen, um die Interpretation des Prologs verständlicher zu machen, da es sehr auf den Autor reflektiert ist.
2. Hauptteil
2.1 Hartmann von Aues Biographie
Über die Person Hartmann von Aue gibt es nur wenige biographische Angaben. Er soll um 1165 geboren und gegen 1210 gestorben sein[1]. Einige Informationen bezüglich seiner Person gewinnt man jedoch aus seinen eigenen Werken oder durch Zeugnisse anderer Literaten[2]. Aus dem Werk Der arme Heinrich geht zum Beispiel hervor, dass Hartmann von Aue sich selbst den Ministerialen, der Oberschicht der unfreien Dienstleute, zuordnet: „dienstman was er ze Ouwe“[3].
Das Gebiet aus dem Hartmann von Aue stammt ist umstritten, denn der Name „von Aue“ bezeichnet einen recht häufigen Ortsnamen, sodass nicht eindeutig bestimmbar ist, um welche Aue es sich in diesem Fall handelt[4]. Allerdings grenzt man seine Herkunft auf das Gebiet im Südwesten, das Herzogtum Schwaben, ein, worauf zum einen die Spur eines alemannischen Dialekts und zum anderen Heinrich von dem Türlin hinweisen[5].
Obwohl Hartmann von Aue dem Klerus nicht angehörig ist, weist er eine „fundierte[…] Schulbildung“[6] auf, denn neben Lateinkenntnissen sowie philosophischen und theologischen Grundlagen besteht die Möglichkeit, dass er zur französischen Sprache und Literatur Zugang hatte[7]. Mehrfach wird Hartmann von Aue mit dem Adelsgeschlecht in Verbindung gebracht. Unter anderem wegen seines Wappens. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Hartmann von Aue durch den Hochadel Verbindungen zu Frankreich genossen hat und so eventuell französische Werke als Vorbilder verwenden konnte[8]. Seine gesamten Werke lassen sich in keine eindeutige chronologische Reihenfolge bringen, jedoch ist die Abfolge von Erec, Gregorius über Der arme Heinrich zu Iwein weitgehend sicher[9]. Die Entstehung seiner literarischen Werke werden grob auf die Zeit von 1180 bis 1200 geschätzt, wobei vermutet wird, dass er in den Jahren 1189/90 an dem dritten Kreuzzug oder in den Jahren 1197/98 an dem vierten Kreuzzug teilgenommen hat[10].
Abschließend lässt sich über Hartmann von Aue festhalten, dass er als Epiker der mittelhochdeutschen Klassik um 1200 ein Vorreiter des höfischen Romans ist und neben seinen Verserzählungen auch Minne- und Kreuzlieder überliefert hat.
2.2 Inhaltsangabe des Werkes Der Arme Heinrich
In der Verserzählung Der arme Heinrich von Hartmann von Aue steht der Freiherr Heinrich im Mittelpunkt, der durch seine hervorragende Herkunft höchstes Ansehen in der Gesellschaft genießt und materiellen Reichtum besitzt. Heinrich wird aus diesem perfekten Leben gerissen, als er durch den Willen Gottes mit Aussatz gezeichnet wird. In Salerno erfährt er schließlich, dass er zur Heilung entweder Gottes Gnade oder eine Jungfrau, die für ihn aus freien Stücken ihr Leben opfert, benötigt. Als Heinrich sich und sein Leben soweit aufgegeben hat und sich hoffnungslos auf dem Hof des Bauern Meier zurückgezogen hat, begegnet er der Tochter des Bauern, die nicht von seiner Krankheit abgeschreckt ist und sich um ihn kümmert. Nach drei Jahren, in denen sie für Heinrich gesorgt hat, erfährt sie von dem einzigen möglichen Heilmittel für ihn und entschließt sich zu ihrer Opferung. Sie ist überzeugt davon, dadurch im Jenseits das ewige Leben zu erlangen. Schließlich reisen Heinrich und das Mädchen nach Salerno, wo das Opfer vollzogen werden soll. Allerdings besinnt sich Heinrich beim Anblick des Mädchens kurz vor der Vollstreckung des Opfers um und akzeptiert die Krankheit als Willen Gottes. Als sie sich auf der Rückreise befinden, wird Heinrich durch Gottes Hilfe geheilt, sodass er im Anschluss darauf, die Tochter des Bauern heiratet, womit auch die Verserzählung endet[11].
[...]
[1] Cormeau: Literatur Lexikon, S.37.
[2] Stammler / Langosch: Die deutsche Literatur des Mittelalters, S.500.
[3] Aue: Der arme Heinrich, S.1, V.5.
[4] Stammler / Langosch: Die deutsche Literatur des Mittelalters, S.500.
[5] Ebd.
[6] Ebd., S.502.
[7] Cormeau: Literatur Lexikon, S.37.
[8] Ebd.
[9] Ebd.
[10] Stammler / Langosch: Die deutsche Literatur des Mittelalters, S.502.
[11] Ebd., S.512f.
- Citation du texte
- Duygu Oecaldi (Auteur), 2008, Hartmann von Aue: Der arme Heinrich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140105