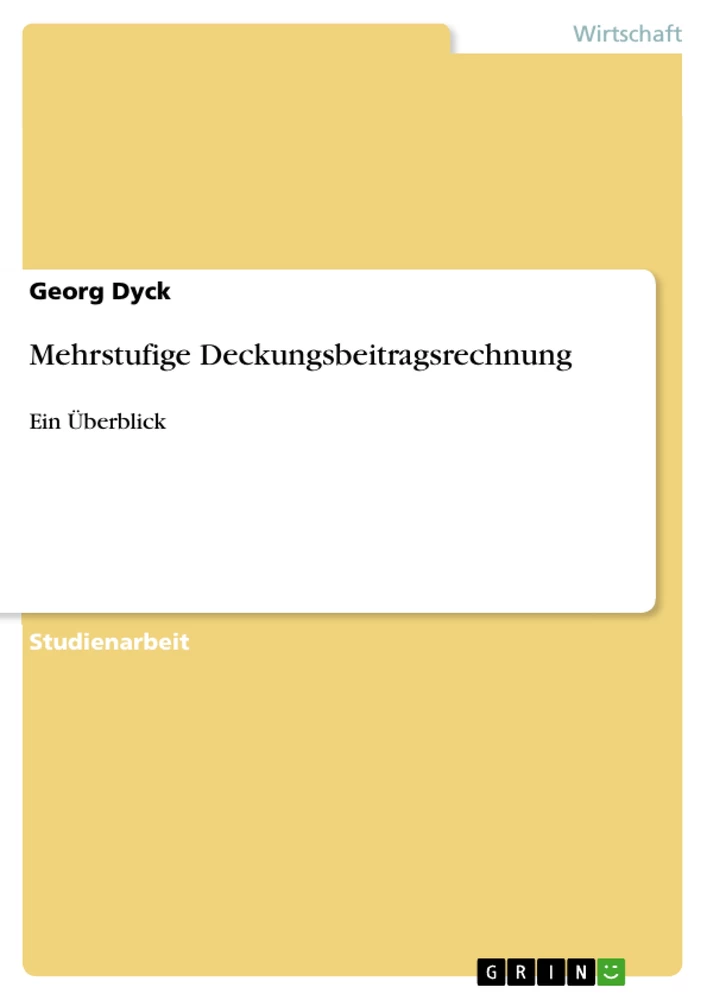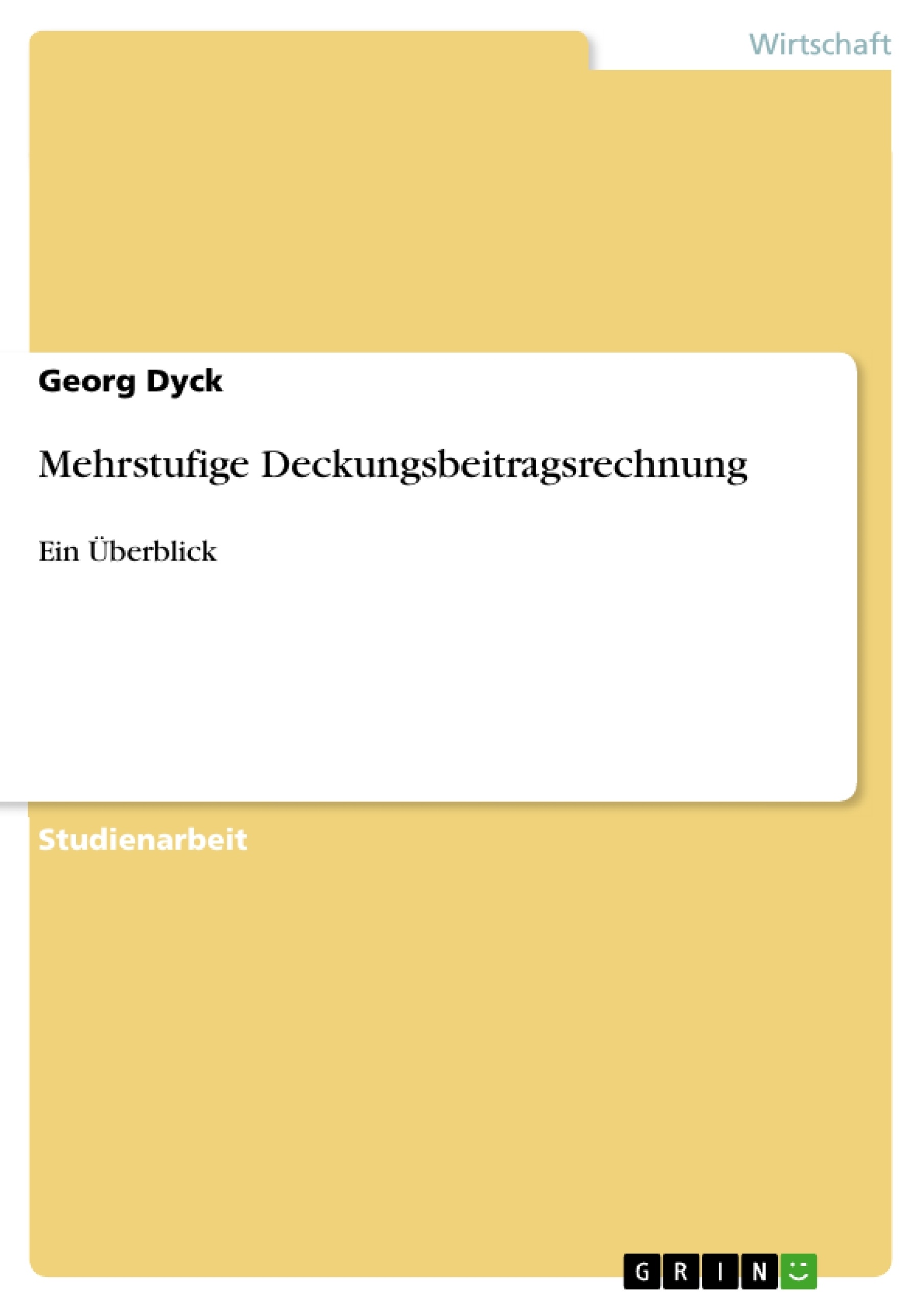Die Entstehung der Deckungsbeitragsrechnung in Deutschland reicht viel weiter zurück als in den USA. Trotzdem bildeten sich bei uns erst viel später Kostenrechnungssysteme die der amerikanischen einstufigen Deckungsbeitragsrechnung, dem direct costing, gleichen. Die Grundlage setzte 1889 E. Schmalenbach. In den 30er Jahren fand sie dann erstmals Anwendung in den USA und fand um 1950 durch H. G. Plaut wieder zurück in die Praxis deutscher Betriebe. Die wirtschaftliche Entwicklung der achtziger und neunziger Jahre hat Deutschland den Durchbruch der Deckungsbeitragsrechnung bei den Großunternehmungen gebracht. Mehr als zwei Drittel der Umsatzmilliardäre nutzen die Verfahren der Teilkostenrechnung. Bei mittleren und kleineren Unternehmungen dagegen ist die traditionelle Vollkostenrechnung auch heute noch weit verbreitet. Es ist zu erwarten, dass auch hier die Deckungsbeitragsrechnung zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Daher ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, genau dieses Rechnungssystem im Folgenden näher vorzustellen.
Inhaltsverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Vorgehensweise
2 Grundlagen der Deckungsbeitragsrechnung
2.1 Begriffserklärung Deckungsbeitrag
2.2 Aufgaben und Zielsetzung
2.4 Von der einstufigen zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung
2.5 Bedeutung der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung in verschiedenen Problemansätzen
3 Darstellung der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung
3.1 Kalkulation im Rahmen der Kostenträgerstückrechnung
3.1.1 Retrograde Kalkulation
3.2.1 Progressive Kalkulation
3.2 Kalkulation im Rahmen der Kostenträgerzeitrechnung
3.2.1 Retrograde Kalkulation
3.2.2 Progressive Kalkulation
3.3 Anwendung der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung
3.3.1 Voraussetzungen
3.3.2 Rahmenbedingungen
3.3.3 Beispiel einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung im Mehrproduktunternehmen
3.4 Kritische Würdigung
4 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
Darstellung 1: Mögliche Zerlegung des Fixkostenblocks
Darstellung 2: Kalkulationsschema der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung
Darstellung 3: Kalkulationsschema der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung
Darstellung 4: Rechenschema der retrograden Kostenträgerstückrechnung
Darstellung 5: Rechenschema der progressiven Kostenträgerstückrechnung
Darstellung 6: Rechenschema der retrograden Kostenträgerzeitrechnung
Darstellung 7: Rechenschema der progressiven Kostenträgerzeitrechnung
Darstellung 8: Kostenstruktur der XY AG
Darstellung 9: Beispiel: Einstufige Deckungsbeitragsrechnung
Darstellung 10: Beispiel: Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
Darstellung 11: Beispiel: Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung 2
Darstellung 12: Beispiel: Engpasssituation
Darstellung 13 Beispiel: Berechnung des relativen Deckungsbeitrags je Minute
Darstellung 14: Beispiel: Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung 3
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Symbolverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die Entstehung der Deckungsbeitragsrechnung in Deutschland reicht viel weiter zurück als in den USA. Trotzdem bildeten sich bei uns erst viel später Kostenrechnungssysteme die der amerikanischen einstufigen Deckungsbeitragsrechnung, dem direct costing, gleichen. Die Grundlage setzte 1889 E. Schmalenbach.[1] In den 30er Jahren fand sie dann erstmals Anwendung in den USA[2] und fand um 1950 durch H. G. Plaut wieder zurück in die Praxis deutscher Betriebe.[3] Die wirtschaftliche Entwicklung der achtziger und neunziger Jahre hat Deutschland den Durchbruch der Deckungsbeitragsrechnung bei den Großunternehmungen gebracht. Mehr als zwei Drittel der Umsatzmilliardäre nutzen die Verfahren der Teilkostenrechnung. Bei mittleren und kleineren Unternehmungen dagegen ist die traditionelle Vollkostenrechnung auch heute noch weit verbreitet. Es ist zu erwarten, dass auch hier die Deckungsbeitragsrechnung zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.[4] Daher ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, genau dieses Rechnungssystem im Folgenden näher vorzustellen.
1.2 Vorgehensweise
Die vorliegende Arbeit ist in vier Kapitel unterteilt. Nach einer kurzen Einleitung werden im zweiten Kapitel wichtige Begriffe im Zusammenhang mit der Deckungsbeitragsrechnung erläutert und die Grundlagen für das Verständnis der Thematik gelegt. Im dritten Kapitel wird speziell auf die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung eingegangen. Methoden werden differenziert, Rahmenbedingungen gesetzt und Voraussetzungen erläutert. Es folgen Beispiele zur Veranschaulichung, wonach auch Vor- und Nachteile genannt werden. Abgeschlossen wird die Arbeit im vierten Kapitel mit dem Fazit.
2 Grundlagen der Deckungsbeitragsrechnung
2.1 Begriffserklärung Deckungsbeitrag
Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Umsatzerlösen und den variablen Kosten eines Bezugsobjekts. Er zeigt auf in welchem Umfang dieser Kostenträger am Betriebserfolg beteiligt ist. Den Umsätzen des Bezugsobjekts werden nur seine variablen Kosten, nicht die fixen Kosten, abgezogen. Der Begriff Deckungsbeitrag ist also gleichbedeutend mit Bruttogewinn.[5]
Der Deckungsbeitrag kann sich auf ein einzelnes Produkt beziehen. Dann wird er Stückdeckungsbeitrag genannt und wie folgt berechnet:
Stückdeckungsbeitrag (db) = Stückpreis (p) – variable Stückkosten (kv)
Der Deckungsbeitrag kann sich auf die ganze Unternehmung beziehen. Dann wird er Bruttogewinn genannt und wie folgt berechnet:
Deckungsbeitrag (DB) = Umsatzerlöse (U) – variable Gesamtkosten (Kv)
Darüber hinaus kann sich der Deckungsbeitrag auch auf eine Reihe von Zwischenstufen, wie z.B. einer Produktart, Produktgruppe usw., beziehen.
2.2 Aufgaben und Zielsetzung
Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ist ein Instrument der Teilkostenrechnung und eine Erweiterung der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung.[6] „Sie ist ein Verfahren zur langfristigen Programmoptimierung, bei dem die Fixkosten stufenweise differenziert und bestimmten Bezugsgrößen verursachungsgerecht, ohne Schlüsselung zugerechnet werden.“[7] Die Teilkostenrechnung setzt an, wo unternehmerische Entscheidungen zur Verbesserung der Beschäftigung oder des Betriebserfolgs zu treffen sind. Sie orientiert sich an den Bedingungen des Marktes hinsichtlich Preis, Absatzmenge und Sortiment. Entscheidend ist letztendlich der Preis des Erzeugnisses, der Grundlage der Kalkulation ist. Er legt den Gewinn nach Abzug der Kosten offen[8] und ermittelt somit, welche der Kalkulationsobjekte maßgeblich zum Betriebserfolg beitragen.
Die Zielsetzung der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung, ist die verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten. Wobei sie als erweitertes Verfahren der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung, die Sicherung derer Vorteile und Vermeidung derer Nachteile sichern soll.[9]
2.3 Differenzierung der Fixkosten
Maßgebend für die Aufstellung des Deckungsbeitrages bei einer mehrstufigen Kalkulation ist die Gliederung der Fixkosten.[10] Die Anzahl der zu berücksichtigenden Fixkostenschichten ist abhängig von der Unternehmung.[11] In der Praxis findet häufig die Gliederung in vier bis fünf Schichten statt:[12]
1. Fixkosten, die der einzelnen Erzeugnisart zugerechnet werden können
(z.B. FuE- oder Patentkosten oder Kosten einer Spezialmaschine für eine spezielle Erzeugnisart, Marketing für ein spezielles Produkt),
2. Fixkosten, die durch einzelne Erzeugnisgruppen entstehen
(z.B. Miete für ein Gebäude, in dem verschiedene Produktarten hergestellt werden, Abschreibungen und Kapitalzinsen für eine Maschine auf der mehrere Produktarten hergestellt werden),
3. Fixkosten, die mit einzelnen Kostenstellen im Zusammenhang stehen
(z.B. Gehalt des Leiters einer Kostenstelle, in der einzelne Produktarten bearbeitet werden),
4. Fixkosten einzelner Betriebsbereiche
(z.B. Gehalt des Bereichsleiters wie z.B. des Niederlassungsleiters, Fixkosten der Bereichsverwaltung)
5. Fixkosten der Gesamtunternehmung
(z.B. Gehalt des Buchhalters des Unternehmens, Fixkosten der zentralen EDV, Vorstandsgehälter, Kosten einer imagepflegenden Maßnahme des Unternehmens, Kosten der Betriebssicherung).[13]
Im Einzelfall kann die Anzahl der Schichten reduziert oder erweitert werden. Bei der Gliederung sollte geprüft werden, inwieweit eine detailliertere Datenerhebung notwendig ist, da eine weitere Differenzierung nicht immer möglich ist und mit steigenden Kosten einhergeht.
Die Bezeichnung der einzelnen Schichten ist von zweitrangiger Bedeutung. Die Gliederung nach Produkten und Produktgruppe ist gerade für Industrieunternehmen empfehlenswert, da gleiche oder ähnliche Produkte aus denselben Rohstoffen gefertigt und mit gleichen Fertigungsverfahren hergestellt werden. Eine Einteilung nach Kunden ist empfehlenswert, wenn für bestimmte Kunden und Kundengruppen spezielle Problemlösungen erbracht werden. Die Gliederung nach Verantwortungsbereichen empfiehlt sich, wenn eine regionale Einteilung des Vertriebsgebietes erfolgt.[14]
Diese Arbeit wird sich, zur Vereinfachung, im Folgenden auf die Betrachtung eines typischen Industrieunternehmens konzentrieren.
2.4 Von der einstufigen zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung
Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ist eine Erweiterung der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Die einstufige Deckungsbeitragsrechnung dient der kurzfristigen Programmoptimierung (monatlich/vierteljährlich), während die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung langfristigen (jährlichen/ zweijährlichen)[15] Charakter zeigt.[16] Kurz- und langfristige Programmoptimierung stehen nicht in einem Konkurrenzverhältnis, sie ergänzen einander in sinnvoller Weise.[17]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Darstellung 1: Mögliche Zerlegung des Fixkostenblocks
Quelle: In Anlehnung an Däumler, K./Grabe, J., Kostenrechnung, 2002, S. 150.
Bei der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung (auch direct costing) werden die gesamten anfallenden Fixkosten in einem Unternehmen ohne weitere Aufteilung betrachtet. Den erzielten Erlösen werden die angefallenen variablen Kosten gegenüber gestellt. Die Differenz bildet den Deckungsbeitrag.[18]
[...]
[1] Vgl. Kilger, W./Pampel, J./Vikas, K., Deckungsbeitragsrechnung, 2007, S. 77.
[2] Vgl. Weber, J., Controlling, 2002, S. 155.
[3] Vgl. Kilger, W./Pampel, J./Vikas, K., Deckungsbeitragsrechnung, 2007, S. 79.
[4] Vgl. Däumler, K./Grabe, J., Kostenrechnung, 2002, S. 6.
[5] Däumler, K., Kostenrechnung, 1999, S. 422, vgl. auch Deitermann, M./Schmolke, S./ Rückwart, W., Rechnungswesen, 2004, S. 453.
[6] Vgl. Weber, M., Deckungsbeitragsrechnung, 2007, S. 417.
[7] O.V., Deckungsbeitragsrechnung, 2009.
[8] Vgl. Deitermann, M./Schmolke, S./ Rückwart, W., Rechnungswesen, 2004, S. 452.
[9] Vgl. Olfert, K., Kostenrechnung, 2008, S. 296.
[10] Vgl. Däumler, K./Grabe, J., Kostenrechnung, 2002, S. 152f.
[11] Vgl. Däumler, K./Grabe, J., Kostenrechnung, 2002, S. 153f.
[12] Vgl. Witt, J., Deckungsbeitragsmanagement, S. 51. 1991.
[13] Vgl. o.V., Deckungsbeitragsrechnung, 2009. Vgl. auch Däumler, K./Grabe, J., Kostenrechnung, 2002, S. 154. Vgl. auch Däumler, K., Kostenrechnung, 1999, S. 426. Vgl. auch Coenenberg, A.\Fischer, T.\Günther, T., Kostenrechnung, S. 188.
[14] Vgl. Weber, M., Deckungsbeitragsrechnung, 2007, S. 429.
[15] Vgl. Däumler, K., Deckungsbeitragsrechnung, 1999, S. 427.
[16] Vgl. Däumler, K./Grabe, J., Kostenrechnung, 2002, S. 158.
[17] Vgl. Däumler, K./Grabe, J., Kostenrechnung, 2002, S. 159.
[18] Vgl. Däumler, K., Deckungsbeitragsrechnung, 1999, S. 424.
- Quote paper
- Georg Dyck (Author), 2009, Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140070