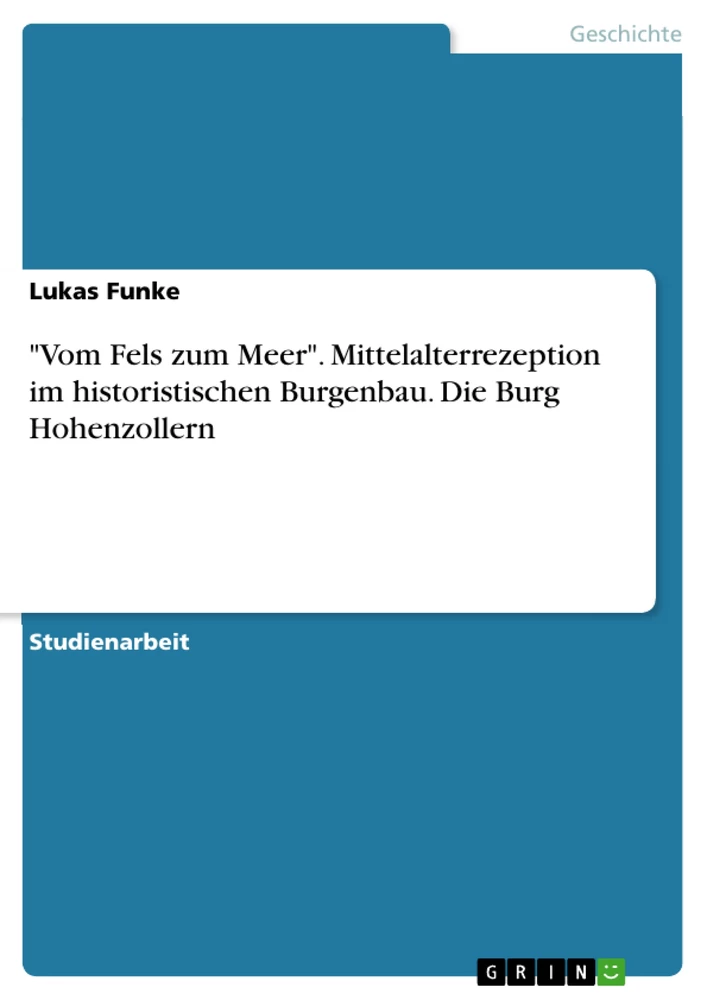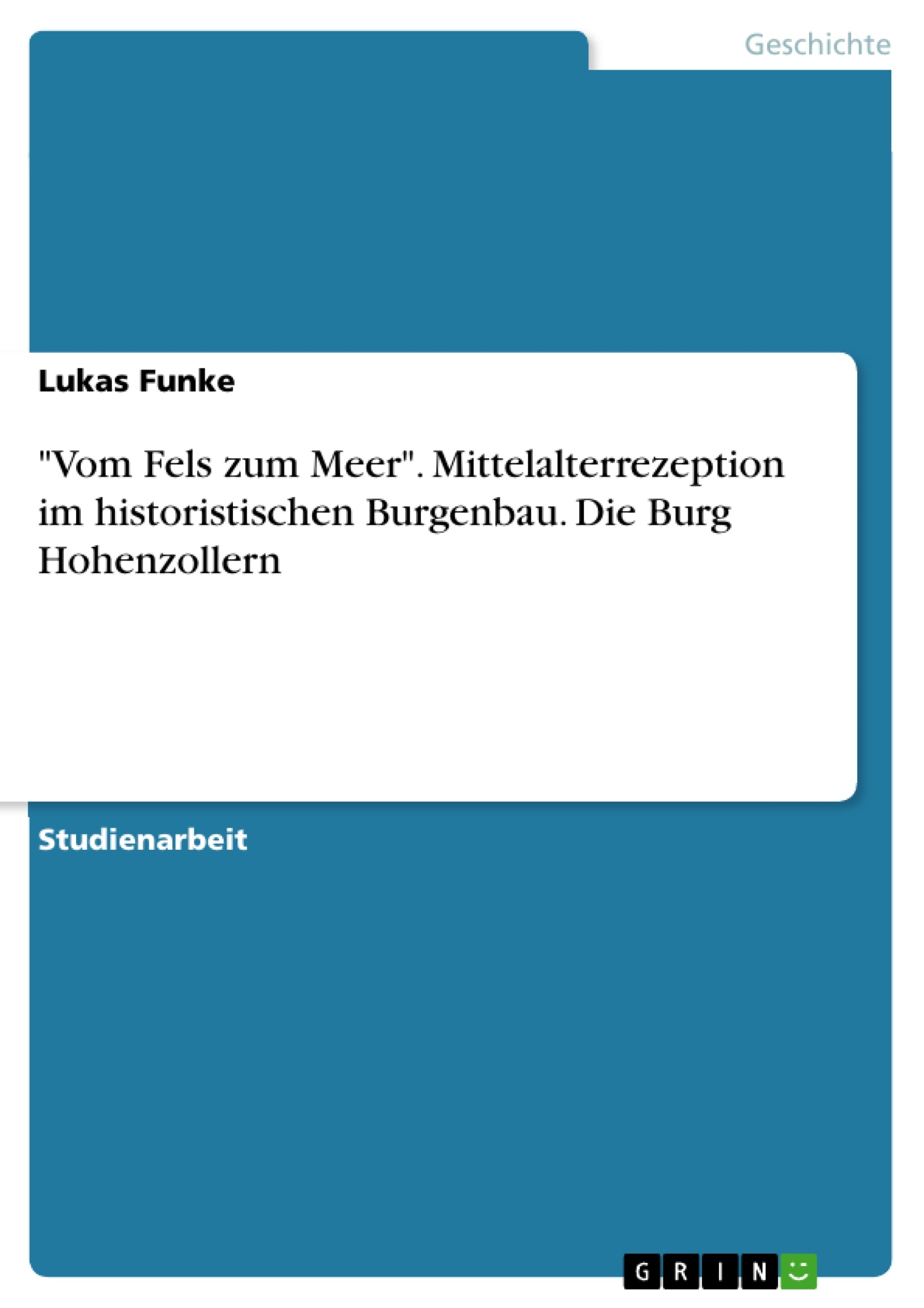Mächtige Burgen, die auf Bergspornen thronen, die Landschaft beherrschen und von Rittern und Adeligen bewohnt und umkämpft werden. Dieses Bild prägt bis heute die mehrheitsfähige Wahrnehmung der Epoche des Mittelalters. Dabei gewann das heutige Bild dieser Epoche erst in der Mittelalterrezeption des 19. Jahrhunderts seine bekannten Konturen und auch das Bauwerk der Burg erhielt nach Zeiten geringem Interesses in Wiedererrichtungen und historistischen Neubauten zunehmende Intensität.
Exemplarisch soll diese Entwicklung am Bauprojekt der preußischen Hohenzollern zur Wiedererrichtung ihrer Stammburg betrachtet werden. Einer Dynastie, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Nationalstaatsbildung und ihrer aktiven Anteilnahme an der Bildung von Nationalmythen eine Verdichtung dieser Phänomene ermöglichte. Welche Ambitionen verbanden die hohenzollerischen Erbauer vor diesem Hintergrund nun mit der Wiedererrichtung der Stammburg Hohenzollern und inwiefern lagen Vorstellungen über die Epoche des Mittelalters dieser Entwicklung eines historistischen Burgenbaus zugrunde?
Mit dieser rezeptionsgeschichtlichen Fragestellung können die kunstgeschichtlichen und literaturwissenschaftlichen Aspekte des Themengebietes nur peripher in den Blick der Ausarbeitung geraten. Die Quellengrundlage bildet vornehmlich die Veröffentlichung des hohenzollerischen Haushistorikers Rudolf Maria von Stillfried-Alcantara zur Geschichte und Einweihung der Burg, an deren symbolischer Formulierung er selbst einen wesentlichen Anteil hatte, sowie eine private Korrespondenz des Kronprinzen Friedrich Wilhelm mit dem Fürsten von Hohenzollern-Hechingen in einer frühen Phase der Idee zur Wiedererrichtung.
Den Beginn bildet dabei die Einordnung in Bezug auf die historischen Grundlagen und Formen der beginnenden facettenreichen Mittelalterrezeption. Sodann werden der historistische Burgenbau und seine allgemeine Symbolik im 19. Jahrhundert zur Einordnung des darauffolgenden Beispiels der Burg Hohenzollern skizziert. Diesen Kapiteln folgt die Betrachtung der Burg in ihrer Verbindung zu der territorial getrennten preußischen Dynastie, die Analyse von ersten Wiedererrichtungsansätzen, veränderten Ausgangsbedingungen seit der Mitte des Jahrhunderts und der letztendlichen öffentlichen Einweihung im Zentrum der Reichsgründungsepoche. In den abschließenden Bemerkungen werden zuletzt Entwicklungslinien in der Mittelalterrezeption aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Beginn des 19. Jahrhunderts und die Bedeutung für die Mittelalterrezeption
- 2.1. Voraussetzungen in Politik und Gesellschaft
- 2.2. Der Einfluss des Mittelalters im Geschichtsbewusstsein
- 3. Die Burg in der Mittelalterrezeption des 19. Jahrhunderts
- 4. Die Wiedererrichtung der Burg Hohenzollern
- 4.1. Preußen, Hohenzollern und die Burg - Ansätze der Annäherung
- 4.2. Symbolische Aufladung und Funktionalisierung der Burg
- 4.3. Die Einweihung der Burg 1867 und ihre Funktion
- 4.3.1. Das Bild der Feierlichkeiten in einem Reiseführer
- 4.3.2. Die symbolische Herrschaftsvermittlung am Hohenzollern
- 5. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wiedererrichtung der Burg Hohenzollern im 19. Jahrhundert als Beispiel für die Mittelalterrezeption dieser Epoche. Die Zielsetzung besteht darin, die Ambitionen der Hohenzollern bei diesem Bauprojekt zu analysieren und den Einfluss vorherrschender Vorstellungen über das Mittelalter auf den historistischen Burgenbau zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die Verbindung zwischen der politischen und gesellschaftlichen Situation des 19. Jahrhunderts und der Interpretation des Mittelalters gelegt.
- Mittelalterrezeption im 19. Jahrhundert
- Historischer Burgenbau und seine Symbolik
- Die Rolle der Hohenzollern im Prozess der Nationalstaatsbildung
- Verbindung zwischen Mittelalterbild und politischer Legitimation
- Öffentliche und private Kommunikation im Zusammenhang mit dem Bau der Burg Hohenzollern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Mittelalterrezeption im 19. Jahrhundert ein und stellt die Forschungsfrage nach den Ambitionen der Hohenzollern bei der Wiedererrichtung ihrer Stammburg und dem Einfluss der damaligen Mittelaltervorstellungen auf den historistischen Burgenbau. Die methodische Vorgehensweise wird skizziert, wobei die Quellenlage (u.a. Schriften von Rudolf Maria von Stillfried-Alcantara, Korrespondenz des Kronprinzen Friedrich Wilhelm) und die Relevanz bestehender Forschungsliteratur (Bothe, Feldhahn) hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der rezeptionsgeschichtlichen Fragestellung, wobei kunst- und literaturwissenschaftliche Aspekte nur peripher betrachtet werden.
2. Der Beginn des 19. Jahrhunderts und die Bedeutung für die Mittelalterrezeption: Dieses Kapitel analysiert die politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen der Mittelalterrezeption zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Epoche der Aufklärung mit ihrem rationalistischen Fortschrittsdenken wird als Ausgangspunkt dargestellt. Die Französische Revolution und die napoleonischen Kriege führten jedoch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Gegenwart und einer idealisierten Sicht auf die Vergangenheit. Diese Entwicklung wird im Kontext des Historismus betrachtet, der ein verändertes Verständnis von Staat, Herrschaft und individueller Entwicklung hervorbrachte. Die Teilung Preußens nach dem Frieden von Tilsit und die darauffolgenden Ereignisse werden als prägende Erfahrungen für das preußische Geschichtsbewusstsein beschrieben.
2.1. Voraussetzungen in Politik und Gesellschaft: Dieser Abschnitt beleuchtet die realpolitischen Ereignisse der Jahrhundertwende und ihren Einfluss auf das Verständnis der Vergangenheit. Die Aufklärung und ihr rationalistisches Fortschrittsdenken stehen im Kontrast zu den Erfahrungen der Französischen Revolution und der napoleonischen Kriege. Diese Ereignisse führten zu einer Aufwertung der Vergangenheit und einer kritischen Sicht auf die Gegenwart, was die Grundlage für ein Geschichtsdenken bildete, das in der Vergangenheit Identität und Ordnung suchte. Der Wandel vom aufklärerischen Vertragsdenken zu einem historisch begründeten Verständnis von Staat und Herrschaft wird diskutiert.
2.2. Der Einfluss des Mittelalters im Geschichtsbewusstsein: Hier werden die gegensätzlichen Sichtweisen auf das Mittelalter im 19. Jahrhundert dargestellt. Der Widerspruch zwischen dem Bild einer rechtlosen, barbarischen Epoche und einer durch transzendente Werte geordneten Zeit wird herausgearbeitet. Die Rolle des aufstrebenden Bürgertums bei der Formulierung eines positiven, nationalistisch aufgeladenen Mittelalterbildes wird betont. Beispiele aus der zeitgenössischen Literatur und Kunst werden angeführt, um die unterschiedlichen Interpretationen zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Mittelalterrezeption, Historismus, Burg Hohenzollern, Hohenzollern, Preußen, Nationalstaatsbildung, Nationalmythos, historischer Burgenbau, politische Symbolik, Geschichtsbewusstsein, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zur Mittelalterrezeption an der Burg Hohenzollern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wiedererrichtung der Burg Hohenzollern im 19. Jahrhundert als Fallbeispiel für die damalige Mittelalterrezeption. Sie analysiert die Intentionen der Hohenzollern bei diesem Bauprojekt und den Einfluss vorherrschender Mittelaltervorstellungen auf den historistischen Burgenbau. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen der politischen und gesellschaftlichen Situation des 19. Jahrhunderts und der Interpretation des Mittelalters.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Mittelalterrezeption im 19. Jahrhundert, den historischen Burgenbau und seine Symbolik, die Rolle der Hohenzollern in der Nationalstaatsbildung, die Verbindung zwischen Mittelalterbild und politischer Legitimation sowie die öffentliche und private Kommunikation im Zusammenhang mit dem Bau der Burg Hohenzollern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Beginn des 19. Jahrhunderts und seine Bedeutung für die Mittelalterrezeption (mit den Unterkapiteln Voraussetzungen in Politik und Gesellschaft und Der Einfluss des Mittelalters im Geschichtsbewusstsein), Die Burg in der Mittelalterrezeption des 19. Jahrhunderts, Die Wiedererrichtung der Burg Hohenzollern (mit Unterkapiteln zu Preußen, Hohenzollern und der Burg, der symbolischen Aufladung und Funktionalisierung sowie der Einweihung und ihrer Funktion, inklusive einer detaillierten Betrachtung des Bildes der Feierlichkeiten und der symbolischen Herrschaftsvermittlung), und Schlussbemerkungen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Schriften von Rudolf Maria von Stillfried-Alcantara, Korrespondenz des Kronprinzen Friedrich Wilhelm und relevante Forschungsliteratur von Bothe und Feldhahn. Der Fokus liegt auf rezeptionsgeschichtlichen Fragestellungen, wobei kunst- und literaturwissenschaftliche Aspekte nur peripher betrachtet werden.
Welche methodische Vorgehensweise wurde gewählt?
Die Arbeit verfolgt einen rezeptionsgeschichtlichen Ansatz, um die Ambitionen der Hohenzollern und den Einfluss der damaligen Mittelaltervorstellungen auf den Bau der Burg Hohenzollern zu analysieren. Die Quellenlage und die Relevanz bestehender Forschungsliteratur werden hervorgehoben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Text der Zusammenfassung der Kapitel enthalten und nicht explizit in diesem FAQ zusammengefasst. Eine vollständige Antwort würde den Inhalt der Arbeit wiedergeben.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Mittelalterrezeption, Historismus, Burg Hohenzollern, Hohenzollern, Preußen, Nationalstaatsbildung, Nationalmythos, historischer Burgenbau, politische Symbolik, Geschichtsbewusstsein, 19. Jahrhundert.
- Quote paper
- Lukas Funke (Author), 2023, "Vom Fels zum Meer". Mittelalterrezeption im historistischen Burgenbau. Die Burg Hohenzollern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1399357