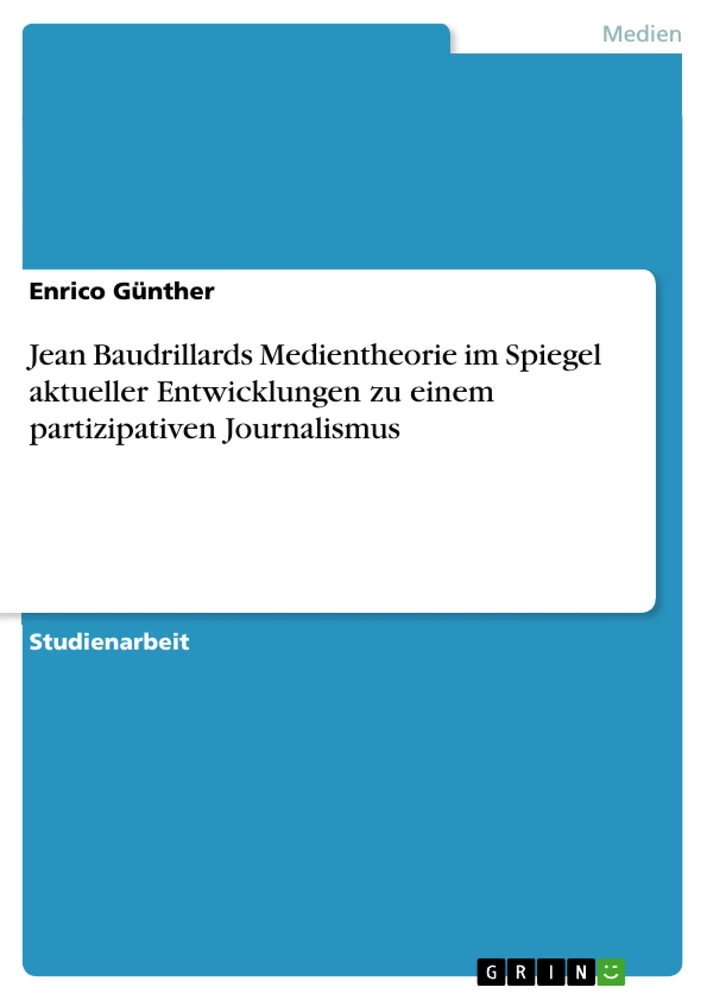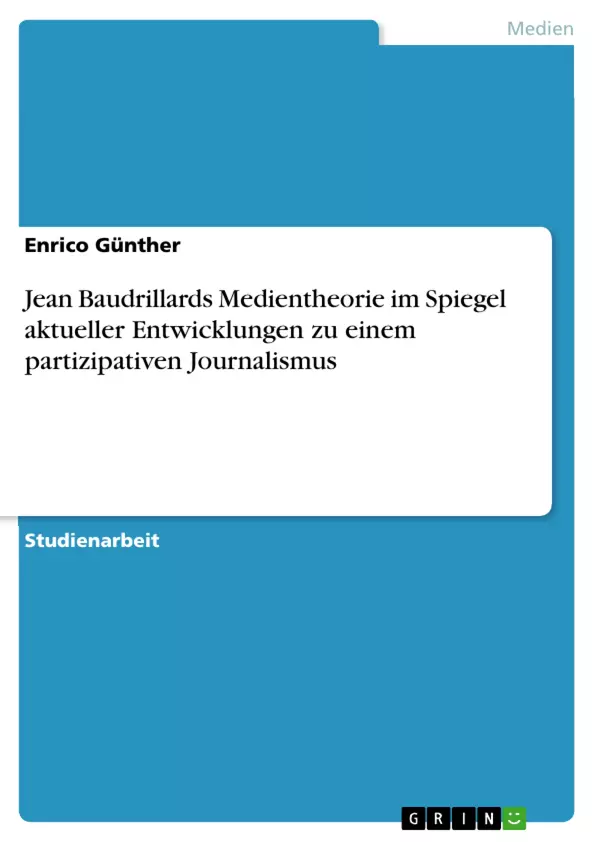„[...] die Medien sind dasjenige, welche die Antwort für immer untersagt, das, was jeden Tauschprozess verunmöglicht“
(Baudrillard 2004: 284)
Diese zentrale Aussage aus Jean Baudrillards Aufsatz „Requiem für die Medien“ deutet auf den finalen Ausweg hin, den der französische Soziologe für das Mediensystem vorsieht: Um eine Antwort auf medial vermittelte Aussagen wiederherzustellen, müssten früher oder später das Mediensystem und der Begriff „Medium“ verschwinden (vgl. Baudrillard 2004: 284/290).
Mittlerweile sind seit dem ersten Erscheinen dieses medienkritischen Aufsatzes fast 40 Jahre vergangen. In dieser Zeit kam es im Bereich der interpersonalen und der publizistischen Kommunikation durch die fortschreitende Entwicklung des Internets zu tiefgreifenden Veränderungen, die auch die Medienlandschaft verändert haben. Web 2.0 ist das Stichwort, das Plattformen zusammenfasst, die allesamt auf Interaktivität, Partizipation und mediale Selbstverwirklichung ihrer Nutzer ausgerichtet sind.
Dieser Trend hat auch im journalistischen Bereich zu Innovationen beigetragen, die man als Formen partizipativen Journalismus‘ bezeichnet. Dabei wird der redaktionelle Inhalt einiger publizistischer Medien nicht mehr durch professionelle Journalisten kreiert, sondern durch Laien, sogenannte „Bürger-Journalisten“ (vgl. z.B. Brauck/ Müller 2009: o.S.).
Diese Hausarbeit soll nun der Frage nachgehen, inwiefern man aktuelle Entwicklungen hin zu einem partizipativen Journalismus im Internet im Kontext Baudrillards Medientheorie reflektieren kann. Ermöglicht partizipativer Journalismus die von Baudrillard geforderte Reziprozität der Medien? Oder bleiben auch solche Medien Systeme, die den Austausch von Rede und Antwort verhindern? Im ersten Teil soll Baudrillards Medientheorie und damit seine Kritik am Mediensystem dargelegt werden. Es folgen im zweiten Abschnitt grundlegende Aspekte zum online-basierten partizipativen Journalismus, bevor im dritten Teil die beiden Elemente zusammengeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medientheorie von Jean Baudrillard
- Hintergrund: Simulationsmodell
- Medien als Effektoren von Ideologie
- Medien als System der Nicht-Kommunikation
- Perspektive: Destruktion der Medien
- Partizipativer Journalismus
- Grundlegendes Prinzip
- Arten partizipativer Journalismusformate
- Gatewatching
- Beispiel: „myheimat.de“
- Synopse: Baudrillard und partizipativer Journalismus
- Wiederherstellung der Antwort?
- Medien in Bürgerhand
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Relevanz der Medientheorie Jean Baudrillards im Kontext des modernen, internetbasierten partizipativen Journalismus. Die Arbeit fragt danach, inwieweit partizipative Journalismusformen Baudrillards Kritik am Mediensystem und dessen Verhinderung von reziproker Kommunikation aufgreifen und möglicherweise eine "Wiederherstellung der Antwort" ermöglichen.
- Baudrillards Simulationsmodell und Hyperrealität
- Medien als Effektoren von Ideologie und Machterhalt
- Medien als System der Nicht-Kommunikation
- Grundprinzipien und Formen des partizipativen Journalismus
- Konflikt und mögliche Synthese zwischen Baudrillards Theorie und partizipativem Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Vereinbarkeit aktueller Entwicklungen im partizipativen Journalismus mit Baudrillards Medienkritik. Sie präsentiert Baudrillards These der Unmöglichkeit von Antwort im Mediensystem und kontrastiert diese mit dem Aufkommen internetbasierter, partizipativer Plattformen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Frage, ob partizipativer Journalismus eine genuine Reziprozität ermöglicht oder ob er lediglich ein weiteres System der Nicht-Kommunikation darstellt. Die Arbeit skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
Medientheorie von Jean Baudrillard: Dieses Kapitel beschreibt Baudrillards Medientheorie im Kontext seines umfassenderen Simulationsmodells. Es erläutert die Konzepte der simulierten Realität, der Hyperrealität und die Rolle der Medien als Schöpfer, nicht als Abbild der Realität. Die Darstellung der Medien als Effektoren von Ideologie wird detailliert beschrieben, wobei Baudrillards Analyse der Ereignisse von Mai 1968 als Beispiel herangezogen wird. Schließlich wird Baudrillards Konzept der Nicht-Kommunikation als einseitige Informationsvermittlung ohne genuine Antwortmöglichkeit erklärt. Dieser Abschnitt legt das theoretische Fundament für den Vergleich mit dem partizipativen Journalismus.
Partizipativer Journalismus: Dieses Kapitel beleuchtet das Phänomen des partizipativen Journalismus. Es definiert das grundlegende Prinzip und beschreibt verschiedene Formen und Ausprägungen partizipativer Journalismusformate. Das Konzept des "Gatewatching" wird erklärt und das Beispiel von "myheimat.de" wird als konkrete Illustration partizipativer Praxis analysiert. Der Abschnitt liefert die empirischen Grundlagen für den Vergleich mit Baudrillards Theorie.
Synopse: Baudrillard und partizipativer Journalismus: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel zusammen und stellt eine Synthese zwischen Baudrillards Medientheorie und den Beobachtungen zum partizipativen Journalismus dar. Es analysiert, inwiefern partizipativer Journalismus die von Baudrillard postulierte "Wiederherstellung der Antwort" ermöglicht oder ob die partizipativen Plattformen selbst neue Formen der Nicht-Kommunikation schaffen. Die Frage nach der Medienkontrolle durch Bürger und die Auswirkungen auf das Mediensystem wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Jean Baudrillard, Medientheorie, Simulation, Hyperrealität, Nicht-Kommunikation, Partizipativer Journalismus, Bürgerjournalismus, Internet, Web 2.0, Medienkritik, Reziprozität, Ideologie, Macht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Baudrillard und Partizipativer Journalismus
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Relevanz der Medientheorie Jean Baudrillards im Kontext des modernen, internetbasierten partizipativen Journalismus. Die zentrale Frage ist, inwieweit partizipative Journalismusformen Baudrillards Kritik am Mediensystem und dessen Verhinderung von reziproker Kommunikation aufgreifen und möglicherweise eine "Wiederherstellung der Antwort" ermöglichen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Baudrillards Simulationsmodell und Hyperrealität, die Rolle der Medien als Effektoren von Ideologie und Machterhalt, Medien als System der Nicht-Kommunikation, die Grundprinzipien und Formen des partizipativen Journalismus sowie den Konflikt und die mögliche Synthese zwischen Baudrillards Theorie und partizipativem Journalismus.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Medientheorie Jean Baudrillards, ein Kapitel zum Partizipativen Journalismus, ein Kapitel zur Synopse von Baudrillards Theorie und Partizipativem Journalismus und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik und trägt zur Beantwortung der Forschungsfrage bei.
Was wird im Kapitel "Medientheorie von Jean Baudrillard" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt Baudrillards Medientheorie im Kontext seines Simulationsmodells, erläutert die Konzepte der simulierten Realität und Hyperrealität, die Rolle der Medien als Schöpfer von Realität, die Medien als Effektoren von Ideologie (am Beispiel Mai 1968) und das Konzept der Nicht-Kommunikation als einseitige Informationsvermittlung.
Was wird im Kapitel "Partizipativer Journalismus" behandelt?
Dieses Kapitel definiert das grundlegende Prinzip des partizipativen Journalismus, beschreibt verschiedene Formen und Ausprägungen, erläutert das Konzept des "Gatewatching" und analysiert "myheimat.de" als Beispiel für partizipative Praxis.
Wie werden Baudrillards Theorie und Partizipativer Journalismus in Beziehung gesetzt?
Das Kapitel "Synopse: Baudrillard und partizipativer Journalismus" synthetisiert die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel. Es analysiert, inwieweit partizipativer Journalismus die von Baudrillard postulierte "Wiederherstellung der Antwort" ermöglicht oder ob partizipative Plattformen neue Formen der Nicht-Kommunikation schaffen. Die Frage nach der Medienkontrolle durch Bürger wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Jean Baudrillard, Medientheorie, Simulation, Hyperrealität, Nicht-Kommunikation, Partizipativer Journalismus, Bürgerjournalismus, Internet, Web 2.0, Medienkritik, Reziprozität, Ideologie, Macht.
Welche zentrale Frage wird in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung stellt die Frage nach der Vereinbarkeit aktueller Entwicklungen im partizipativen Journalismus mit Baudrillards Medienkritik und untersucht, ob partizipativer Journalismus eine genuine Reziprozität ermöglicht oder nur ein weiteres System der Nicht-Kommunikation darstellt.
- Quote paper
- Enrico Günther (Author), 2009, Jean Baudrillards Medientheorie im Spiegel aktueller Entwicklungen zu einem partizipativen Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139928