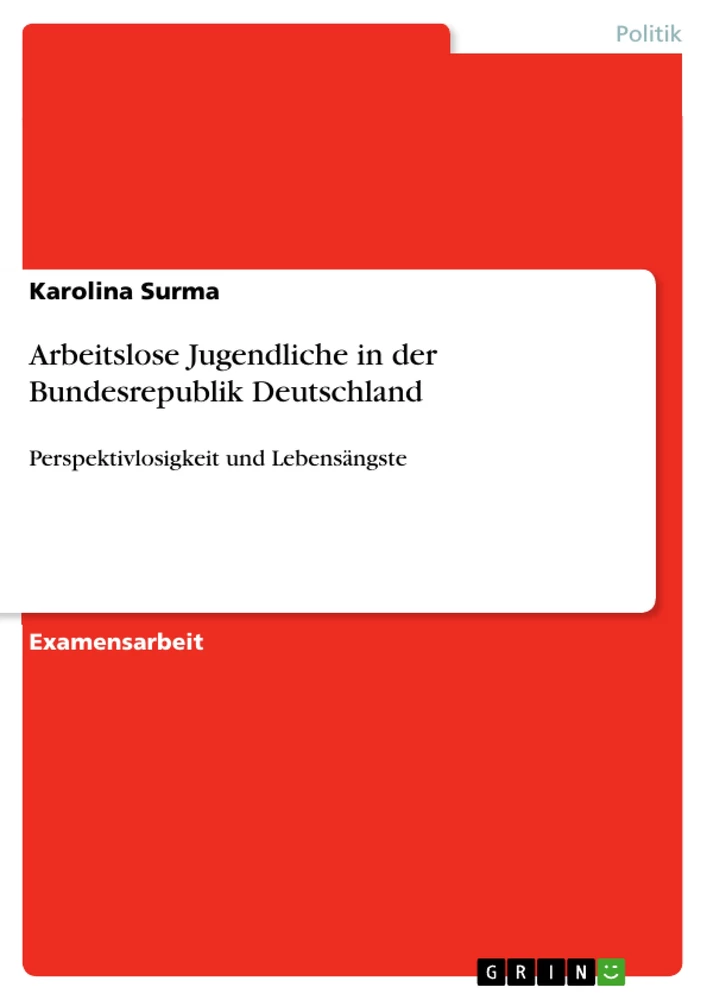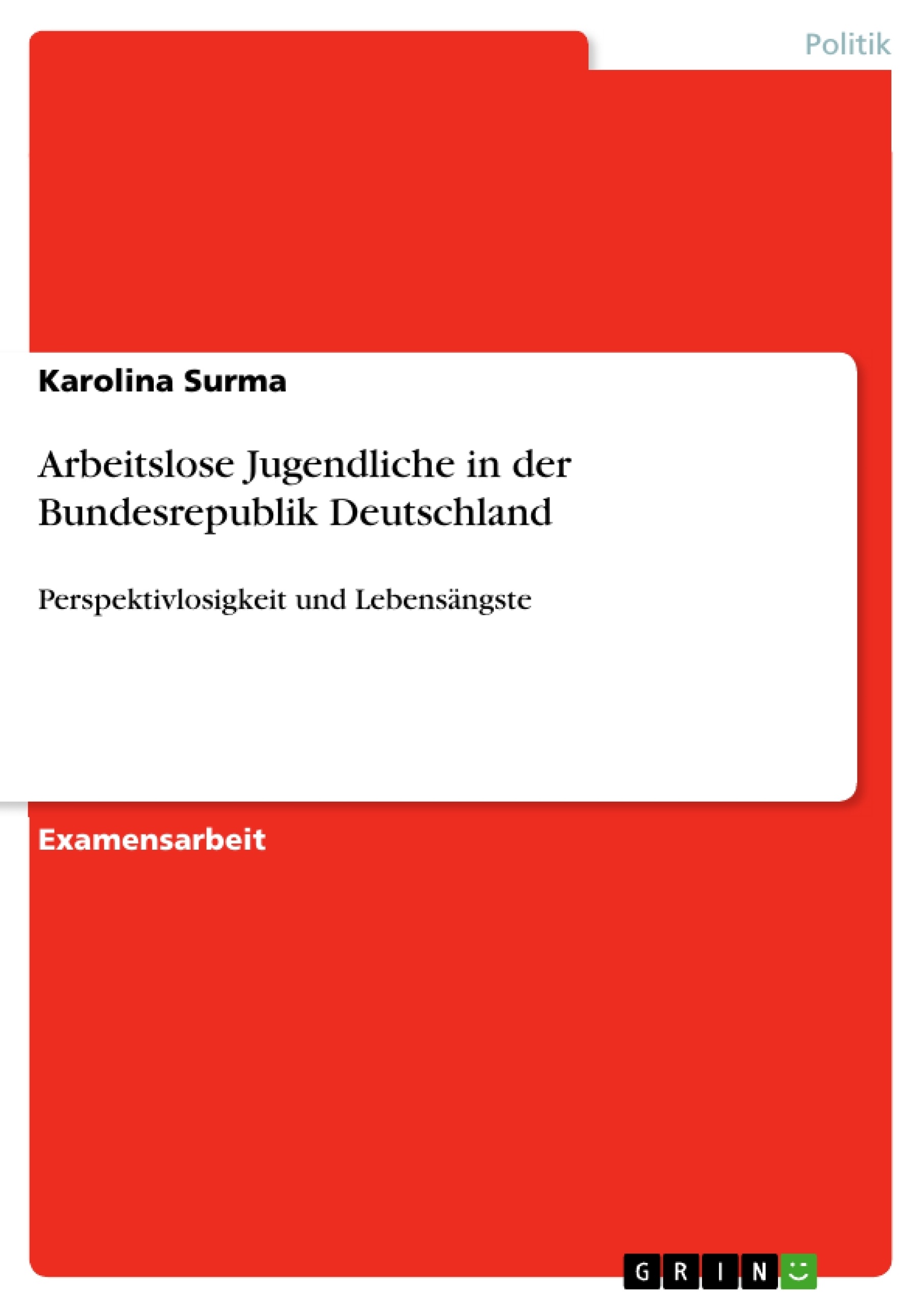Seit der Wirtschaftskrise 1973/74 begleitet uns das Problem der Arbeitslosigkeit in der Politik und Gesellschaft.
Die unterschiedlichen Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit wurden zum Abbau und zur Prävention wissenschaftlich aufgezeigt und analysiert. Besonders Anfang der achtziger Jahre entstand eine Vielzahl von Expertisen zur Begegnung und Verringerung von Arbeitslosigkeit. Obwohl das Problem bis heute nicht gelöst wurde, trat es in der Folgezeit im Rahmen der soziologischen und wissenschaftlichen Betrachtung in den Hintergrund. Dabei sind Lösungsansätze für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aktuell mehr denn je gefordert!
Gerade die Jugendarbeitslosigkeit ist in der Gesellschaft stark in den Fokus geraten. Perspektivlosigkeit und Lebensängste können aus ihr resultieren. Von der Politik wird ihre Absenkung, durch Ergreifung effektiver Maßnahmen, verlangt. So versprach Angela Merkel in der Neujahrsrede 2008 „…jedem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz oder eine Qualifizierungsmaßnahme anbieten zu können.“
Fraglich erscheint jedoch, wie dieses Versprechen eingehalten werden kann. Was passiert mit Jugendlichen, die nach der Schule in keinen Berufszweig eintreten? In welchen Lebensbereichen wirkt sich die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen aus? Welche Erfahrungen, Ängste und Ziele haben arbeitslose Jugendliche, in ihrem oftmals monotonen Tagesablauf?
Zur Lösung der Fragekomplexe muss untersucht werden, welche psychischen, psychosozialen und ökonomischen Folgen durch Jugendarbeitslosigkeit entstehen und welche Konsequenzen diese für die Identitätsbildung haben.
Hierzu bedarf es einer Definition und Abgrenzung von Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit. Die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland muss aufgezeigt und im internationalen Vergleich betrachtet werden. Bei der anschließenden Ursachenanalyse stehen die soziale Lage, sowie das Bildungsniveau im Vordergrund. Fraglich erscheint, in wieweit die Bildung und das soziale Milieu die Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen. Auch die Auswirkung auf soziale Kontakte ist Teil der ganzheitlichen Analyse des Problems.
Aus diesen Ergebnissen können im Nachgang politische, wie auch schulische Schritte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit abgeleitet und auf ihre Wirkungsweise untersucht werden, um geeignete Mittel gegen Perspektivlosigkeit und Lebensängste bei Jugendarbeitslosen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsabgrenzung Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit
2.1 Definition Arbeitslosigkeit
2.2. Definition Jugendarbeitslosigkeit
3 Entwicklung und Situation der Jugendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland
3.1 Aktueller Stand der arbeitslosen Jugendlichen in den neuen und alten Bundesländern
3.2 Jugendarbeitslosigkeit im internationalen Vergleich
4 Ursachen von Jugendarbeitslosigkeit vor dem Hintergrund der sozialen Milieus
4.1 Jugendliche und ihre Bildungschancen
4.1.1 Zum Begriff Schichten
4.1.2 Soziale Schichten - Ihre Bildung und Wertorientierung
4.2 Jugendarbeitslosigkeit beim Übergang von der Schule in den Ausbildungsplatz
4.3 Jugendarbeitslosigkeit beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf
4.4 Jugendliche ohne Berufsausbildung
5 Psychische, psychosoziale und ökonomische Belastungen von arbeitslosen Jugendlichen
5.1 Arbeit als wichtiger Schritt für die Identität und Persönlichkeit
5.1.1 Zum Begriff Identität
5.1.2 Die Bedeutung der Arbeit für die Persönlichkeit
5.2 Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf soziale Kontakte
5.2.1 Die Situation der Arbeitslosigkeit in der Familie
5.2.2 Rückzug aus dem Freundeskreis
5.3 Zerfall der Zeitstruktur
5.4 Die finanzielle Belastung arbeitsloser Jugendlicher
5.5 Arbeitslosigkeit - eine langsame Identitätskrise
5.5.1 Zum Selbstwertgefühl arbeitsloser Jugendlicher
5.5.2 Verlust jeglicher Zukunftsperspektiven
6 Strategien gegen Jugendarbeitslosigkeit
6.1 Staatliche Hilfsprogramme
6.1.1 JUMP – das Jugendsofortprogramm
6.1.2 JOBSTARTER- Unternehmen für Ausbildung gewinnen
6.1.3 Fazit zu staatlichen Hilfsprogrammen
6.2 Schulische Maßnahmen
7 Fazit
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Jüngere Arbeitslose in Deutschland nach Schwerpunkten (Anzahl)
Abbildung 2: Arbeitslosenquote im Januar 2009 in Prozent
Abbildung 3: Jüngere Arbeitlose in den alten und neuen Bundesländern nach Schwerpunkten (Anzahl)
Jugendarbeitslosigkeit ist jedoch nicht nur ein nationales Problem. Das Statistische Amt der EU (EUROSTAT) bietet hierfür mit seinen detaillierten Tabellen und Graphiken einen übersichtlichen internationalen Vergleich der Jugendarbeitslosigkeit in verschiedenen Ländern.
Abbildung 4: Arbeitslosenquote (2008) unter 25 Jahre, Werte in Prozent,
X: Daten tabellarisch nicht verfügbar
Abbildung 5: Soziale Schichtung der westdeutschen Bevölkerung 2000
1 Einleitung
Seit der Wirtschaftskrise 1973/74 begleitet uns das Problem der Arbeitslosigkeit in der Politik und Gesellschaft.
Die unterschiedlichen Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit wurden zum Abbau und zur Prävention wissenschaftlich aufgezeigt und analysiert. Besonders Anfang der achtziger Jahre entstand eine Vielzahl von Expertisen zur Begegnung und Verringerung von Arbeitslosigkeit. Obwohl das Problem bis heute nicht gelöst wurde, trat es in der Folgezeit im Rahmen der soziologischen und wissenschaftlichen Betrachtung in den Hintergrund. Dabei sind Lösungsansätze für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aktuell mehr denn je gefordert!
Gerade die Jugendarbeitslosigkeit ist in der Gesellschaft stark in den Fokus geraten. Perspektivlosigkeit und Lebensängste können aus ihr resultieren. Von der Politik wird ihre Absenkung, durch Ergreifung effektiver Maßnahmen, verlangt. So versprach Angela Merkel in der Neujahrsrede 2008 „…jedem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz oder eine Qualifizierungsmaßnahme anbieten zu können.“[1]
Fraglich erscheint jedoch, wie dieses Versprechen eingehalten werden kann. Was passiert mit Jugendlichen, die nach der Schule in keinen Berufszweig eintreten? In welchen Lebensbereichen wirkt sich die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen aus? Welche Erfahrungen, Ängste und Ziele haben arbeitslose Jugendliche, in ihrem oftmals monotonen Tagesablauf?
Zur Lösung der Fragekomplexe muss untersucht werden, welche psychischen, psychosozialen und ökonomischen Folgen durch Jugendarbeitslosigkeit entstehen und welche Konsequenzen diese für die Identitätsbildung haben.
Hierzu bedarf es einer Definition und Abgrenzung von Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit. Die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland muss aufgezeigt und im internationalen Vergleich betrachtet werden. Bei der anschließenden Ursachenanalyse stehen die soziale Lage, sowie das Bildungsniveau im Vordergrund. Fraglich erscheint, in wieweit die Bildung und das soziale Milieu die Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen. Auch die Auswirkung auf soziale Kontakte ist Teil der ganzheitlichen Analyse des Problems.
Aus diesen Ergebnissen können im Nachgang politische, wie auch schulische Schritte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit abgeleitet und auf ihre Wirkungsweise untersucht werden, um geeignete Mittel gegen Perspektivlosigkeit und Lebensängste bei Jugendarbeitslosen zu finden.
2 Begriffsabgrenzung Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit
2.1 Definition Arbeitslosigkeit
Der Begriff der Arbeitslosigkeit meint „…Personen, die wie beim Anspruch auf Arbeitslosengeld vorübergehend
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten,
…“.[2]
Schulabgänger oder Schüler, die eine Ausbildungsstelle suchen, gelten nicht als arbeitslos[3] und sind demnach nicht in Arbeitslosenstatistiken aufgelistet.
2.2. Definition Jugendarbeitslosigkeit
Eine klare Festlegung der Definition von Jugendarbeitslosigkeit fehlt bis heute. Zwar sind Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren als einzelner Personenkreis im Analytikerreport 2008 der Agentur für Arbeit erfasst, trotzdem sind wissenschaftliche Begrifferklärungen nicht aufgezeichnet. Der Begriff Jugendarbeitslosigkeit bezeichnet im Allgemeinen inhaltlich „…den Sachverhalt, dass Jugendliche und junge Erwachsene nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten einen Platz zur Ausbildung und zur Berufstätigkeit (Arbeit) finden.“[4] Somit spricht diese Begriffsbestimmung gegen die gesetzliche Definition von Arbeitslosigkeit, da auch Schüler, Studenten und Schulabgänger, die nur eine Ausbildungsstelle suchen, in die Betrachtung mit einbezogen werden. Dieser Umstand rechtfertigt die weitergehende Untersuchung, da die Symptome für Perspektivlosigkeit und Lebensängste gerade auch in diesem Personenkreis auftreten können. Infolgedessen muss die Jugendarbeitslosigkeit nicht nur als ein Zustand bezogen auf den Beschäftigungsstatus angesehen werden, sondern vielmehr als ein Phänomen im gesellschaftlichen Kontext.
Das vollendete 24. Lebensjahr bildet allgemein die Obergrenze für die Betrachtung der Jugendarbeitslosigkeit. Dies deckt sich mit der Definition des Statistischen Bundesamtes Deutschland, wonach als Jugendlicher bezeichnet wird, wer mindestens 15 und höchstens 24 Jahre alt ist.[5]
Für die Folgebetrachtung der Jugendarbeitslosigkeit wird somit der Personenkreis untersucht, in dem junge Erwachsene zwischen dem vollendeten 14. und 24. Lebensjahr nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten einen Platz zur Ausbildung und zur Berufstätigkeit finden.
3 Entwicklung und Situation der Jugendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland
Wie hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit wirklich? Beim Statistischen Bundesamt Deutschland ist die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen seit 1990 registriert. Die Auswertung differenziert das Geschlecht und unterscheidet das Alter der Jugendlichen in unter 20 Jahren bzw. unter 25 Jahren.
1990 gab es 196.129 männliche und 186.061 weibliche arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren. Bis Dezember 2004 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit zu verzeichnen. So waren 2004 512.819 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos, davon 314.024 männliche und 198.795 weibliche. Das ist ein Anstieg von 130.629 Jugendlichen.[6]
Ab Januar 2005 sind die Daten über registrierte Arbeitslose der Bundesagentur für Arbeit auf Grund der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfen mit früheren Daten nicht mehr vergleichbar.
Seit diesem Zeitpunkt verringert sich die Jugendarbeitslosigkeit in beiden Altersgruppen (unter 20 Jahren bzw. unter 25 Jahren). Aktuell sind im Januar 2009 insgesamt 360.142 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos. Im Vorjahr (Monat Dezember) waren es noch 306.150. Das ist ein Anstieg von 17,6%.[7]
Diese Veränderung ist durch jahreszeitliche Einflüsse zu erklären, da saisonbedingte Entlassungen[8] in diesen Monaten üblich sind.[9] Dennoch ist eine Entspannung der Jugendarbeitslosigkeit zu erkennen, da die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen seit 1990 zurückgegangen ist.
Abbildung 1: Jüngere Arbeitslose in Deutschland nach Schwerpunkten (Anzahl)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: modifiziert übernommen aus: Statistisches Bundesamt Deutschland: Arbeitslosigkeit nach Schwerpunkten (02.06.2009), Online im WWW unter: https://www-genesis.destatis.de [02.06.2009].
Des Weiteren ist in der Abbildung 1 und 2 zu sehen, dass die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren insgesamt wesentlich niedriger ausfällt, als bei den Jugendlichen unter 25 Jahren. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass Personen, die eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, ein Übergangsproblem zwischen Ausbildung und Beruf haben.
Die 15- bis 20-jährigen Jugendlichen können nach einer erfolgslosen Ausbildungsplatzsuche in das schulische Bildungssystem ausweichen und verursachen somit eine niedrige Quote in der Statistik.
Abbildung 2: Arbeitslosenquote im Januar 2009 in Prozent
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: modifiziert übernommen aus: Bundesagentur für Arbeit Statistik: Analyse des Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktes für unter 25-Jährige (Januar 2009), S. 20, Online im WWW unter: http://www.pub.arbeitsagentur.de [15.02.2009].
Trotz allem sind die Auswertungen der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit kritisch zu betrachten, weil sie keine Differenzierung zwischen Jugendlichen machen, die nach der Schule einen Ausbildungsplatz suchen und solchen Jugendlichen, die nach ihrer Ausbildung in die Berufswelt eintreten.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt wohl trotz der sinkenden Zahlen angespannt.
Durch Medien wird immer wieder suggeriert, dass betriebliche Berufausbildungen äußerst sensibel auf Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren. Die seit 2008 anhaltende Weltwirtschaftkrise beeinflusst demnach den Markt enorm und würde sinkende Ausbildungsangebote für Deutschland verursachen. Dies führe zu einer großen Anzahl von Jugendlichen, die keine betriebliche Ausbildung ausüben könnten und zunächst unterschiedliche berufliche Bildungsmaßnahmen ergreifen würden. Folglich würde sich die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen, die zwar alternative Maßnahmen ergreifen, während dessen aber einen Ausbildungsplatz suchen, erhöhen.
Das geringe Angebot an Ausbildungsplätzen würde das Einstiegsalter erhöhen und folglich Lebensängste entstehen lassen.
3.1 Aktueller Stand der arbeitslosen Jugendlichen in den neuen und alten Bundesländern
Die aktuelle Vermittlungsbilanz des Statistischen Bundesamtes Deutschland erfasst den Zeitraum der Jugendarbeitslosigkeit in den neuen und alten Bundesländern seit 2002 bis heute.
Die Abbildung Nr. 3 zeigt einen erheblichen Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in den alten, wie auch in den neuen Bundesländern.
In den alten Bundesländern waren im Jahre 2002 insgesamt 307.516 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos. Hingegen waren im Jahre 2008 nur noch 120.093 männliche und 96.713 weibliche Jugendliche ohne Beruf.[10] In den neuen Bundesländern erfasste die Statistik 2002 insgesamt 189.850 arbeitslose Personen unter 25 Jahren. Im Jahre 2008 waren es stattdessen 69.310 männliche und 53.693 weibliche Jugendliche.[11]
Abbildung 3: Jüngere Arbeitlose in den alten und neuen Bundesländern nach Schwerpunkten (Anzahl)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: modifiziert übernommen aus: Statistisches Bundesamt Deutschland: Arbeitslosigkeit nach Schwerpunkten (02.06.2009), Online im WWW unter: https://www-genesis.destatis.de [02.06.2009].
Prozentual liegt die Arbeitslosenquote der Jugendlichen in den alten Bundesländern insgesamt bei 6,2% (Stand Januar 2009). Davon sind 3,5% der arbeitslosen Jugendlichen zwischen 15 bis unter 20 Jahre und 7,5% zwischen 20 bis unter 25 Jahre alt.
Die Arbeitslosenquote beträgt in den neuen Bundesländern laut Statistik insgesamt 12,6%, davon sind 6,4% der Jugendlichen zwischen 15 bis 20 Jahren und 15,1% zwischen 20 bis 25 Jahren.[12]
Zum einen ist zu erkennen, dass Jugendliche in den neuen Bundesländern stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, als in den alten Bundesländern. Der Grund liegt in der stärkeren Wirtschaftstruktur des Westens, die auch Jugendliche aus dem Osten dazu bewegt in die alten Bundesländer zu ziehen, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Zum anderen wird festgestellt, dass insbesondere Jugendliche zwischen 20 bis 25 Jahren schneller arbeitslos werden. Dieses Phänomen ist in der ganzen Bundesrepublik Deutschland zu finden und korrespondiert mit den Daten aus Kapitel 3.
3.2 Jugendarbeitslosigkeit im internationalen Vergleich
Jugendarbeitslosigkeit ist jedoch nicht nur ein nationales Problem. Das Statistische Amt der EU (EUROSTAT) bietet hierfür mit seinen detaillierten Tabellen und Graphiken einen übersichtlichen internationalen Vergleich der Jugendarbeitslosigkeit in verschiedenen Ländern.
In der Europäischen Union (27 Länder) waren im Jahre 2008 15,4% der Jugendlichen unter 25 Jahren arbeitslos.
Dabei sind im ost-, wie auch südeuropäischen Raum Jugendliche wesentlich stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen. Vor allem Spanien, mit seinen 24,6%, ist das Land mit der höchsten Arbeitslosenquote. Auch Kroatien, Rumänien und Ungarn weisen eine Jugendarbeitslosenquote über 20% auf. Ebenso sind Polen mit 17,3% und Schweden mit 20% betroffen.[13]
Abbildung 4: Arbeitslosenquote (2008) unter 25 Jahre, Werte in Prozent,
X: Daten tabellarisch nicht verfügbar
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Europäische Kommission: Arbeitslosenquote nach Altersgruppe (24.04.2009), Online im WWW unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [08.06.2009].
Deutschland ist mit seiner Arbeitslosenquote von 9,8% geringer mit Jugendarbeitslosigkeit belastet. Die Quoten von Österreich (8,0%), Norwegen (7,2%) und Dänemark (7,6%) sowie der Niederlande (5,3%) unterbieten jedoch diesen Wert.
Die Niederlande haben es geschafft die Arbeitslosenquote von 8,2% (2005) auf 5,3% (2008) zu senken. Aber auch andere Länder, wie Deutschland, Österreich, Norwegen und Dänemark weisen eine Depression auf.[14]
Der Grund für die niedrige Arbeitslosenquote dieser Länder ist in ihrem Berufsbildungssystem mit betrieblicher und schulischer Ausbildung zu finden, das in den ost- und südeuropäischen Raum - zum Leidwesen der Jugendlichen - fehlt. Durch das duale System in Deutschland haben Jugendliche die Chance sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse zu erlangen. Betriebliche Projekte ermöglichen ein schnelles Verständnis von Zusammenhängen. Dadurch erhöht sich die Aussicht auf eine Übernahme nach der Ausbildung, weil die Jugendlichen die gleiche Produktivität aufzeigen können, wie erfahrene Beschäftigte. Das ist in den anderen Ländern, die eine hohe Arbeitslosenquote aufweisen, nicht der Fall. Dort werden die Jugendlichen in getrennten Berufsausbildungseinrichtungen angelernt. Daraus ergibt sich ein hoher Kosten- und Zeitaufwand für die Betriebe, die ihre Lehrlinge erst in allen Funktionen unterweisen müssen. Folglich ziehen diese Firmen Personen vor, die schon über interne Arbeitserfahrungen verfügen.[15]
4 Ursachen von Jugendarbeitslosigkeit vor dem Hintergrund der sozialen Milieus
Worin liegen also die Gründe für den immer noch hohen Stand der Jugendarbeitslosigkeit?
Stehen mit ihr das soziale Milieu sowie das Bildungsniveau im direkten Zusammenhang? Fraglich erscheint, in wieweit die Bildung und das soziale Milieu die Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen.
Für Jugendliche ist es generell sehr schwer, die Übergänge zwischen Schule, Ausbildung und Beruf lückenlos zu bestreiten. Jugendliche ohne jegliche Berufsausbildung droht in diesem Zusammenhang oftmals die Langzeitarbeitslosigkeit. Dieser Kerngruppe ist es fast unmöglich eine dauerhafte, existenzsichere Grundlage für ihr Leben aufzubauen. Daraus können schwerwiegende soziale Probleme resultieren, die zur völligen Isolation führen können.
Die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt korrespondieren mit der Qualität des Schulabschlusses. Das schulische Ausbildungsniveau hängt dabei oftmals mit der sozialen Herkunft zusammen.[16] Gute Ausbildung oder das Risiko arbeitslos zu werden, ist für gewisse Schichten typisch. In Folge dessen fällt das Risiko, arbeitslos zu werden, für bestimmte Gruppe von Jugendlichen erheblich höher aus.[17]
Um Rückschlüsse auf die Jugendarbeitslosigkeit ziehen zu können, müssen daher zunächst die Bildungschancen für Jugendliche in Abgrenzung zum sozialen Milieu betrachtet werden. Darauf basierend können die Ursachen von Jugendarbeitslosigkeit beim Übergang von der Schule in den Ausbildungsplatz, beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf, und bei fehlender Berufsausbildung analysiert werden.
4.1 Jugendliche und ihre Bildungschancen
Die Qualität der schulischen Bildung hat in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Bildung ist für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig und unverzichtbar. Persönlichkeit wiederum ist bedeutend für die Wahrnehmung von Chancen in verschieden Bereichen des Lebens.
Bildung gilt als Eintrittskarte in höher qualifizierte Berufe. Empirische Daten bestätigen (siehe Kapitel 4.2.1), dass Jugendliche aus höheren Schichten das Gymnasium oder die Realschule besuchen und Berufskarrieren einschlagen.
Jugendliche aus der unteren Schicht sind in der höheren Bildung kaum vertreten.[18]
Diese Aussage vertritt auch Bosch:
„Insgesamt haben sich infolge der hohen Arbeitslosigkeit und der sozialen Polarisierung der letzten Jahre zunehmend […] bildungsferne soziale Milieus entwickelt, die die Integration vieler Jugendlicher in den Arbeitsmarkt erschweren.“[19]
Zwar können Kinder aus bildungsfernen Familien studieren, trotzdem sind die Chancen, durch ein Studium in einen höheren Dienst zu gelangen, bei Kindern aus einer Oberschicht viermal so hoch.[20]
Somit stehen die Bildungschancen mit der Schichtzugehörigkeit direkt im Kontext.
4.1.1 Zum Begriff Schichten
Die Sozialstruktur untersucht die Struktur der Gesellschaft. Sie zergliedert die Gesellschaft in ihre Teilbereiche und untersucht die Wechselwirkungen, die zwischen verschiedenen Elementen auftauchen. Die Sozialstruktur umfasst somit die Wirkungszusammenhänge nach sozialen Merkmalen. Unter sozialen Merkmalen sind unter anderem die Bildung und der Beruf zu verstehen. Sie beeinflussen das soziale Denken und Handeln, welche Einfluss auf die Position in gesellschaftlichen Teilbereichen (Schichtstruktur) haben.[21]
Die Analyse der Schichten wurde in den 30er Jahren von Theodor Geiger, in Auseinandersetzung mit der Marx`schen Klassentheorie, entwickelt. Er präzisierte den Begriff der Klassen und Schichten. Geiger gliederte die Bevölkerung in Schichten und stellte fest, dass Personen unter ähnlichen Bedingungen auch ähnliche Erfahrungen machten. Zum einen beeinflusst die soziale Schicht das Denken und Handeln. Zum anderen repräsentieren die Personen schichttypische Vorstellungen, Werte und Ideologien. Geiger bezeichnete die schichtspezifischen Einstellungsmuster als Schichtmentalität.[22]
Es darf nicht behauptet werden, dass alle Personen aus typischen Schichten schichttypische Mentalitäten aufweisen, trotzdem ist das schichttypische Charakterfundament wahrscheinlicher, als ein anderes.[23]
Es gibt verschieden soziale Schichten in der deutschen Gesellschaft. Zahlreiche Schicht- und Klassenmodelle versuchen die komplexe Wirklichkeit rationalisiert darzustellen. Trotzdem sind sie nur Hilfsmittel, die einzelne Strukturen erkennen lassen können. Ralf Dahrendorf hat 1965 ein Haus-Modell konstruiert, das die Bevölkerung in sieben Schichten (Eliten, Arbeitereliten, Dienstklasse, Falscher Mittelstand, Mittelstand, Arbeiter- und Unterschicht) unterteilt. Die Abgrenzungen beruhen auf verschiedene Funktionen der Gruppen im Herrschafts- und Wirtschaftssystem und auf soziokulturelle Mentalitäten.[24]
Die unten angeführte Grafik ist eine modernisierte Fassung des Dahrendorf Hauses. Geißler entwickelte dieses komplexe Modell in Anlehnung an das Dahrendorf-Modell, wobei Umschichtungen, die seit 1965 aufgetreten sind, in diesem Modell berücksichtigt wurden. Dieses Modell repräsentiert Westdeutschland im Jahre 2000. Die Einteilung der Schichten hängt größtenteils mit dem Beruf zusammen, denn die Stellung des Berufs beeinflusst das Gehalt, das Prestige und zum Schluss den Einfluss auf die wirtschaftlichen-gesellschaftlichen Bereiche. Die Decken und Wände des Modells sind durchlässiger, als beim Dahrendorf-Modell, da scharfe Abstufungen in modernen Gesellschaften nicht mehr existieren:[25] „…sie [Schichten, d. Verf.] gehen vielmehr ineinander über und überlappen sich…“.[26]
Heute ist es möglich zwischen den Schichten zu wechseln. Die Mobilitätsbarrieren sind durch bessere Lebensbedingungen und angeblicher Chancengleichheit durchlässiger geworden. Durch auf- und absteigende Prozesse sind keine klaren Grenzen einer Schicht zu entdecken. Es kommt zu einer einheitlichen Gesellschaftsschicht (Nivellierung).[27]
Abbildung 5: Soziale Schichtung der westdeutschen Bevölkerung 2000
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle modifiziert übernommen aus: Geißler, Rainer: Facetten der modernen Sozialstruktur (2004), Online im WWW unter: http://www.bpb.de [25.03.2009].
Paradox ist, dass „dennoch die Menschen weiterhin genötigt oder gewollt [sind], sich vornehmlich in bestimmten Wohnbereichen aufzuhalten“[28] und somit die Chance auf ein besseres Leben versäumen.
Vor allem ist die Bildung ein signifikantes Mittel schichtspezifische Unterschiede zu erkennen.
[...]
[1] Reuters: Merkel misst Erfolg an Abbau der Arbeitslosigkeit (31.12.2007), Online im WWW unter: http://www.focus.de/politik/deutschland/neujahrsansprache_aid_231084.html [15.02.2009].
[2] Bundesagentur für Arbeit: Begriff der Arbeitslosigkeit in der Statistik unter SGB II und SGB III (November 2004), S. 2, Online im WWW unter: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000200/html/sgb2/arbeitslosenbegriff_unter_sgb_2_und_sgb_3.pdf [15.02.2009].
[3] Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Begriff der Arbeitslosigkeit in der Statistik unter SGB II und SGB III (November 2004), S. 3, Online im WWW unter: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000200/html/sgb2/arbeitslosenbegriff_unter_sgb_2_und_sgb_3.pdf [15.02.2009].
[4] Universität Hamburg: Fachgebärdenlexikon Sozialarbeit/Sozialpädagogik (15.04.2009), Online im WWW unter: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/slex/seitendvd/konzepte/l52/l5221.htm [15.02.2009].
[5] Vgl. Rengers: 15% der jungen Menschen in Deutschland sind erwerbslos (10.08.2006), Online im WWW unter: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2006/08/PD06__323__133.psml [15.02.2009].
[6] Zahlen unter Statistisches Bundesamt Deutschland (2009): Arbeitslosigkeit nach Schwerpunkten, Online im WWW unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/online;jsessionid=95B81E255D07C8E120DEB8783EA233CB.tcggen1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1243934362142&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&werteabruf=Werteabruf [15.02.2009].
[7] Zahlen unter Bundesagentur für Arbeit Statistik: Analyse des Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktes für unter 25 Jährige (Januar 2009), S. 13, Online im WWW unter: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000200/html/analytik/u25-analytikreport_2009-01.pdf [15.02.2009].
[8] Saisonbereinigungsverfahren: Im Winter und Sommer gibt es einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, der sich im Frühjahr und Herbst wieder abbaut. Das Saisonbereinigungsverfahren rechnet diese Einflüsse heraus und erlaubt die Beurteilung der grundlegenden Entwicklung der Arbeitslosigkeit am aktuellen Rand.
[9] Vgl. Bundesagentur für Arbeit Statistik: Analyse des Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktes für unter 25 Jährige (Januar 2009), S. 14, Online im WWW unter: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000200/html/analytik/u25-analytikreport_2009-01.pdf [15.02.2009].
[10] Diese Daten dürfen nicht miteinander summiert werden, da seit September 2005 das Merkmal „Geschlecht“ nicht vollständig erfasst worden ist. Dies gilt für alle Bundesländer.
[11] Zahlen unter Statistisches Bundesamt Deutschland: Arbeitslosigkeit nach Schwerpunkten (2009), Online im WWW unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/online;jsessionid=8F194A078D6CDA047FAA450B76B23FF0.tcggen1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1236162884861&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&werteabruf=Werteabruf [03.03.2009].
[12] Zahlen unter Bundesagentur für Arbeit Statistik: Analyse des Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktes für unter 25 Jährige (Januar 2009), S. 21, Online im WWW unter: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000200/html/analytik/u25-analytikreport_2009-01.pdf [03.03.2009].
[13] Zahlen unter Europäische Kommission: Arbeitslosenquote nach Altersgruppen (24.04.2009), Online im WWW unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tsdec460&plugin=1 [08.06.2009].
[14] Zahlen unter Europäische Kommission: Arbeitslosenquote nach Altersgruppen (24.04.2009), Online im WWW unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tsdec460&plugin=1 [08.06.2009].
[15] Vgl. Bosch, 2001, S. 22; S. 28
[16] Vgl. Gerlach, 1983, S. 106f.
[17] Vgl. Geißler, 2008, S. 116
[18] Vgl. Vester, 2004, S. 13
[19] Bosch, 2001, S. 35
[20] Vgl. Vester, 2006, S. 36
[21] Vgl. Geißler, 2008, S. 17ff.
[22] Vgl. Geißler, 2008, S. 93
[23] Vgl. Geißler, 2008, S. 94
[24] Vgl. Geißler, 2008, S. 98f.
[25] Vgl: Geißler, 2008, S. 100f.
[26] Geißler, 2008, S. 101
[27] Vgl. Geißler, 2008, S. 100f.
[28] Geißler, 2008, S. 102
- Quote paper
- Karolina Surma (Author), 2009, Arbeitslose Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139901