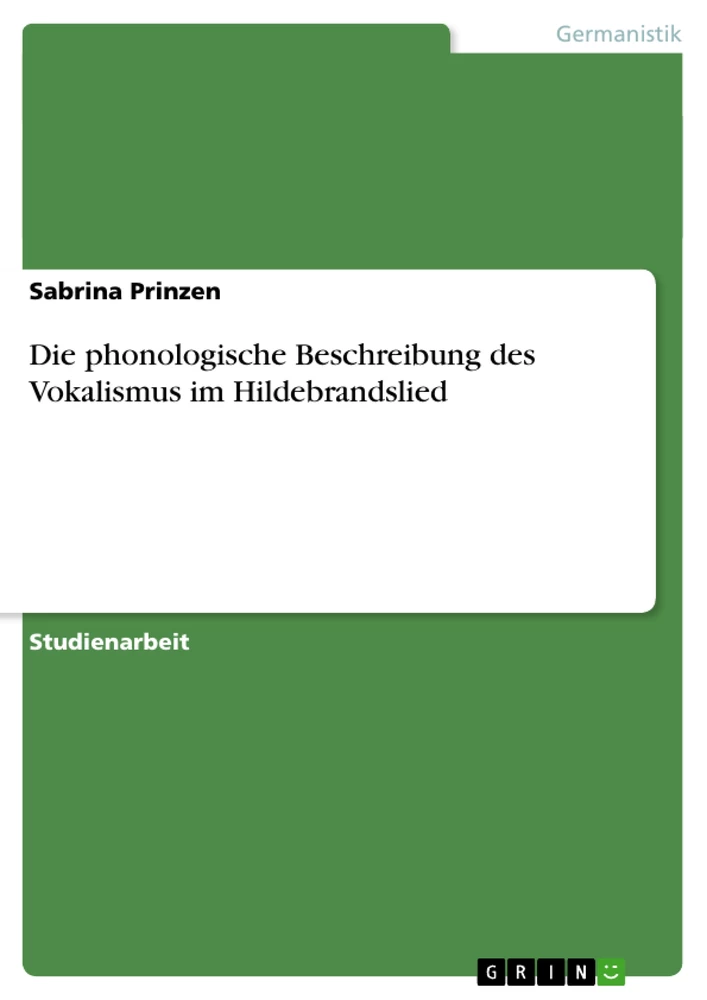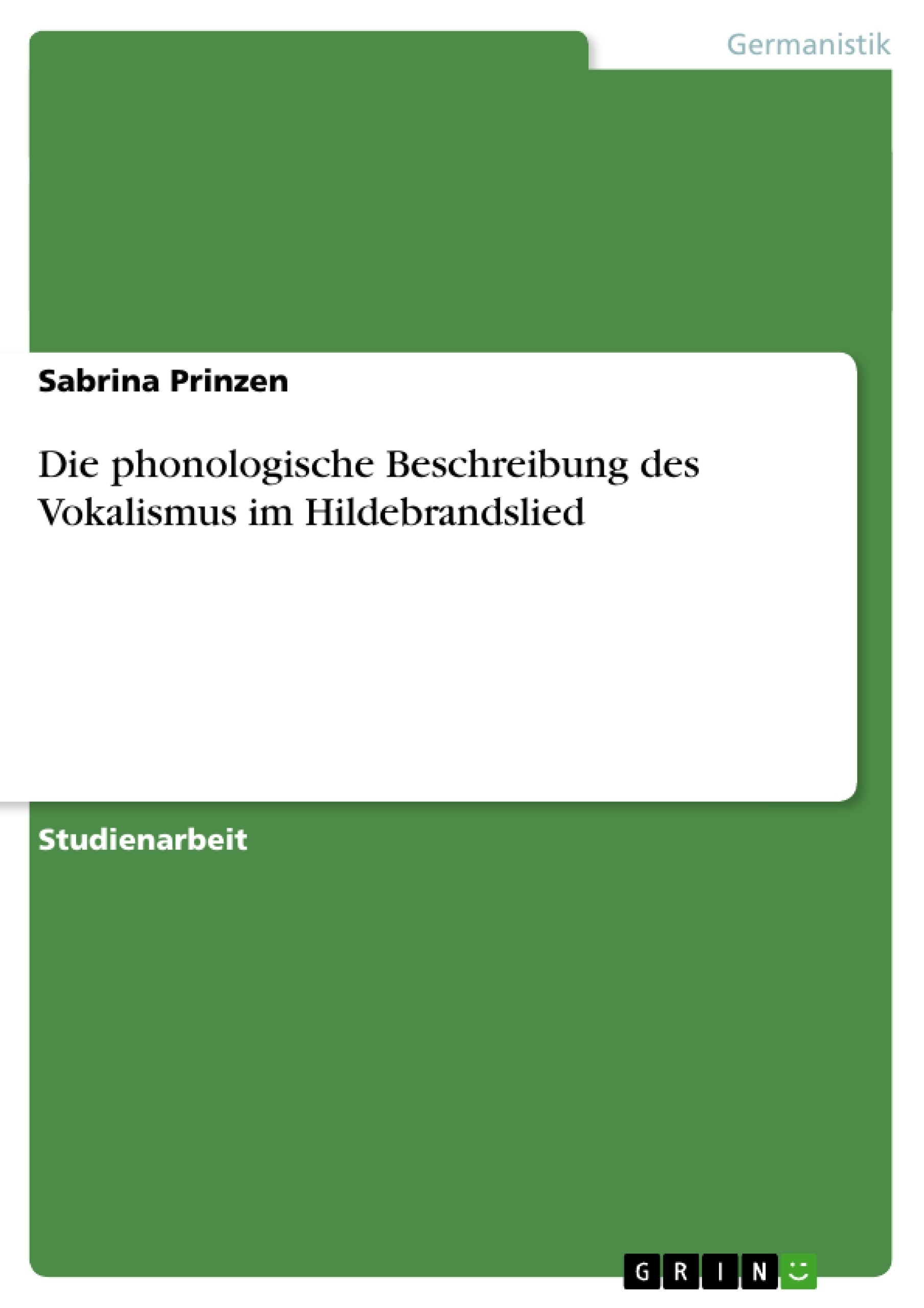Die sprachliche und lautliche Untersuchung hinsichtlich des Vokalismus im Hildebrandslied,
des einzigen überlieferten deutschen Heldenliedes, stellt sich als sehr interessant
und abwechslungsreich dar. Abwechslungsreich insofern, als dass man eine
Variation der ahd. und as. Mundarten in Form einer Mischsprache antrifft.
Eine Mischung der Sprachdialekte findet man vor, da dem ursprünglich hd. Text im
Nachhinein eine unvollkommene und nicht konsequent durchgeführte Umsetzung
ins Nd. zugeführt wird.
Das Hildebrandslied ist in seinem Kern oberdeutsch, bairisch, mit einigen frk. Anteilen
durchsetzt sowie mit starken Einfüssen nd. Formen durchwachsen, die erst
später eingefügt bzw. umgesetzt werden. Meist findet man künstlich konstruierte
Formen vor, die vom Hd. ins Nd. sprachlich auf künstliche Art und Weise umgesetzt
werden, aber tatsächlich im Nd. so meist nicht existierten. Es handelt sich dabei
um nd. Scheinformen. 1
Diese nd. Formen sind von einem hd. Schreiber nachgebildet worden und weisen
eine orthographisch falsche Darstellung auf.
Es sind nicht nur Mischformen innerhalb des Wortschatzes, sondern auch innerhalb
einzelner Wörter vorzufinden.2
Des weiteren gibt es daneben Wörter im Text, die ansonsten nirgends in einer anderen
älteren Quelle auftauchen, wie beispielsweise das Kompositum staimbort Vers 65 des Textes in Verform . Auch erscheinen Wörter, die man weder als hd. noch als nd. Formen
bestimmen kann.3 [...]
1 Vgl. heittu 17= diese Form stammt von germ. * heitan ab. Im Ahd. müsste dieses Wort heizzan lauten,
im As. hetan. Man kann dieses Wort weder als hd. noch als nd. Wort einstufen, was wiederum die Künstlichkeit
hinsichtlich der Umsetzung vom Hd. ins Nd. verdeutlicht, vor allem, wenn man sich veranschaulicht,
dass die zweite Lautverschiebung auf künstliche Art und Weise rückgängig gemacht wird. Dieses
Merkmal vollzieht sich im Übrigen im gesamten Text. Es ist kein z vorzufinden.
2 Vgl. usere 15= das Pronomen ist ndd.. Wenn es sich um eine hd. Form handeln würde, müsste es uns
lauten. Die Endung hingegen ist hd. Hier liegt also eine Mischform des ndd. und hd. Sprachdialektes
innerhalb eines Wortes vor.
3 Vgl. heittu 17
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der historische Hintergrund
- 2.1. Der Inhalt
- 2.2. Die Entstehungsgeschichte
- 3. Der Begriff Vokalismus
- 4. Die kurzen Vokale des Ahd.
- 4.1. Die Entwicklung des germ. a zu ahd./ as. e
- 4.2. Die Brechung des germ. e zu ahd./ as. i
- 4.3. Der Erhalt des germ. i ins Ahd. und As.
- 4.4. Die Brechung des germ. u zu ahd./ as. o
- 5. Die langen Vokale des Ahd.
- 5.1. Der Zusammenfall der verschiedenen a zu einem Vokal
- 5.1.1. Der Erhalt des germ. a
- 5.1.2. Die Entwicklung des germ. æ (e 1) zu ahd./ as. a
- 5.2. Die Entwicklung des germ. e (e 2) zu ahd./ as. e (æ, ae, e) und die ahd. Diphthongierung zu –i -ie-
- 5.3. Der Erhalt des germ. o ins Ahd. und As. und die Diphthongierung zu uo
- 5.4. Der Erhalt des germ. i ins Ahd./ As.
- 5.5. Der Erhalt des germ. u ins Ahd. und As.
- 5.1. Der Zusammenfall der verschiedenen a zu einem Vokal
- 6. Die ahd. Monophthongierung
- 6.1. Die Monophthongierung des germ. ai zu ahd. ai/ ei, e und as. e
- 6.2. Die Monophthongierung des germ. au zu ahd. -au-, -ou-, -o- und as. -o-
- 6.3. Die Monophthongierung des germ. eu zu ahd. -eu-, -eo-, -io-, -e- und as. -e-
- 7. Die Vokale der Nebensilben
- 7.1. Die Vokale der Präfixe
- 7.2. Die Vokale der Endsilben
- 7.3. Die Vokale der Mittelsilben
- 7.3.1. Synkope
- 8. Fazit
- 9. Schematische Übersicht
- 9.1. Die kurzen Vokale
- 9.1.1. Germ. a
- 9.1.2. Germ. e
- 9.1.3. Germ. i
- 9.1.4. Germ. u
- 9.2. Die langen Vokale
- 9.2.1. Germ. a
- 9.2.2. Germ. æ (e 1)
- 9.2.3. Germ. e (e 2)
- 9.2.4. Germ. i
- 9.2.5. Germ. o
- 9.2.6. Germ. u
- 9.3. Die Diphthonge
- 9.3.1. Germ. au
- 9.3.2. Germ. eu
- 9.3.3. Germ. ai
- 9.1. Die kurzen Vokale
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt auf eine phonologische Beschreibung des Vokalismus im Hildebrandslied ab. Sie untersucht die sprachlichen Besonderheiten des Textes, der sich durch eine Mischung aus althochdeutschen und altniederdeutschen Elementen auszeichnet. Die Analyse konzentriert sich auf die Klärung der lautlichen Entwicklungen und deren Ursachen.
- Untersuchung des Vokalismus im Hildebrandslied
- Analyse der Mischsprache aus althochdeutschen und altniederdeutschen Elementen
- Erklärung der lautlichen Entwicklungen im Text
- Identifizierung von künstlich konstruierten Formen
- Dialektunterschiede im Hildebrandslied
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Hildebrandslied als einziges überliefertes deutsches Heldenlied vor und hebt die interessante und abwechslungsreiche sprachliche und lautliche Untersuchung des Vokalismus hervor. Es wird die Besonderheit der Mischsprache aus althochdeutschen (ahd.) und altniederdeutschen (and.) Elementen betont, die durch eine nicht konsequent durchgeführte Umsetzung des ursprünglich oberdeutschen Textes ins Niederdeutsche entstanden ist. Der Text weist künstlich konstruierte Formen auf, die als nd. Scheinformen interpretiert werden und orthographisch fehlerhaft sind. Die Einleitung kündigt die detaillierte Untersuchung des Vokalismus an, welche die langen und kurzen Vokale des Ahd., die ahd. Monophthongierung und die Vokale der Nebensilben umfasst.
2. Der historische Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Hildebrandsliedes. Es werden sowohl der Inhalt des Liedes selbst als auch die Entstehungsgeschichte und die damit verbundenen sprachlichen Entwicklungen behandelt. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der historischen Einordnung der sprachlichen Besonderheiten des Textes, um die nachfolgende phonologische Analyse zu kontextualisieren. Die genaue Beschreibung des Inhalts und der Entstehungsgeschichte liefert die Grundlage für das Verständnis der komplexen sprachlichen Situation des Textes.
3. Der Begriff Vokalismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Vokalismus" im Kontext der linguistischen Analyse des Hildebrandsliedes. Es legt die theoretischen Grundlagen für die folgende detaillierte Untersuchung der Vokale im Text fest. Die Definition wird wahrscheinlich wichtige Aspekte wie die Klassifizierung von Vokalen, ihre phonetischen Eigenschaften und ihre Rolle in der Phonologie umfassen.
4. Die kurzen Vokale des Ahd.: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der kurzen Vokale im Althochdeutschen, basierend auf germanischen Ursprüngen. Es wird die Entwicklung des germanischen a zu ahd./as. e, die Brechung des germanischen e zu ahd./as. i, der Erhalt des germanischen i und die Brechung des germanischen u zu ahd./as. o detailliert untersucht. Beispiele aus dem Hildebrandslied veranschaulichen diese Entwicklungen und zeigen die Mischung aus ahd. und and. Elementen.
5. Die langen Vokale des Ahd.: Ähnlich wie Kapitel 4 konzentriert sich dieses Kapitel auf die Entwicklung der langen Vokale im Althochdeutschen, ausgehend von den germanischen Ursprüngen. Es untersucht den Zusammenfall verschiedener a zu einem Vokal, die Entwicklung des germanischen e zu ahd./as. e und die ahd. Diphthongierung, den Erhalt des germanischen o und i sowie des germanischen u. Die Analyse wird wiederum durch Beispiele aus dem Hildebrandslied illustriert, die die spezifischen sprachlichen Merkmale des Textes aufzeigen.
6. Die ahd. Monophthongierung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Monophthongierung der germanischen Diphthonge ai, au und eu im Althochdeutschen. Es analysiert die verschiedenen Entwicklungen dieser Diphthonge in ahd. und as. und untersucht, wie sich diese Prozesse im Hildebrandslied manifestieren. Hier wird detailliert untersucht, wie die Monophthongierung die Mischung aus ahd. und and. Merkmalen im Text beeinflusst.
7. Die Vokale der Nebensilben: Dieses Kapitel untersucht die Vokale in den Nebensilben des Hildebrandsliedes, unterteilt in Präfixe, Endsilben und Mittelsilben. Die Analyse wird sich wahrscheinlich auf die verschiedenen phonologischen Prozesse konzentrieren, die in diesen Silben auftreten, wie z.B. Synkope (Ausfall von Vokalen). Die Unterschiede zwischen ahd. und and. Merkmalen werden im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Hildebrandslied, Vokalismus, Althochdeutsch, Altniederdeutsch, Mischsprache, Phonologie, Lautwandel, Monophthongierung, Diphthongierung, Nebensilben, Dialekte, Germanistik.
Hildebrandslied: Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vokalismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit einer phonologischen Analyse des Vokalismus im Hildebrandslied. Sie untersucht die sprachlichen Besonderheiten des Textes, der eine Mischung aus althochdeutschen und altniederdeutschen Elementen aufweist.
Was sind die Hauptthemen der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die Klärung der lautlichen Entwicklungen im Hildebrandslied und deren Ursachen. Es werden die kurzen und langen Vokale des Althochdeutschen, die althochdeutsche Monophthongierung, die Vokale der Nebensilben sowie die Mischung aus althochdeutschen und altniederdeutschen Elementen untersucht. Die Arbeit beleuchtet auch die historischen Hintergründe des Textes und die Herausforderungen bei der Interpretation seiner sprachlichen Merkmale.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Historischer Hintergrund, Der Begriff Vokalismus, Die kurzen Vokale des Ahd., Die langen Vokale des Ahd., Die ahd. Monophthongierung, Die Vokale der Nebensilben, Fazit und eine schematische Übersicht. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Vokalismus im Hildebrandslied.
Wie wird der Vokalismus im Hildebrandslied untersucht?
Die Untersuchung des Vokalismus erfolgt durch die Analyse der Entwicklung germanischer Vokale im Althochdeutschen und deren Reflexe im Hildebrandslied. Dabei werden die verschiedenen phonologischen Prozesse wie Brechung, Diphthongierung und Monophthongierung berücksichtigt. Die Analyse umfasst sowohl die Vokale der betonten als auch der unbetonten Silben.
Welche sprachlichen Besonderheiten des Hildebrandsliedes werden betrachtet?
Das Hildebrandslied zeichnet sich durch eine Mischung aus althochdeutschen und altniederdeutschen Elementen aus. Die Arbeit untersucht diese Mischsprache und analysiert die Ursachen für die sprachliche Vielfalt im Text. Dabei werden auch künstlich konstruierte Formen und orthographische Fehler berücksichtigt.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext für die Analyse?
Der historische Kontext, der den Inhalt und die Entstehungsgeschichte des Hildebrandsliedes umfasst, spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der sprachlichen Besonderheiten des Textes. Die historische Einordnung der sprachlichen Merkmale ermöglicht eine fundierte phonologische Analyse.
Was ist unter "ahd. Monophthongierung" zu verstehen?
Die "ahd. Monophthongierung" beschreibt den Prozess der Vereinfachung germanischer Diphthonge (z.B. ai, au, eu) zu einfachen Vokalen im Althochdeutschen. Die Arbeit untersucht, wie dieser Prozess im Hildebrandslied stattgefunden hat und welche Auswirkungen er auf die sprachliche Struktur des Textes hatte.
Welche Rolle spielen die Vokale der Nebensilben?
Die Vokale der Nebensilben (Präfixe, Endsilben, Mittelsilben) werden ebenfalls analysiert, wobei phonologische Prozesse wie Synkope (Ausfall von Vokalen) berücksichtigt werden. Auch hier werden die Unterschiede zwischen althochdeutschen und altniederdeutschen Merkmalen untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hildebrandslied, Vokalismus, Althochdeutsch, Altniederdeutsch, Mischsprache, Phonologie, Lautwandel, Monophthongierung, Diphthongierung, Nebensilben, Dialekte, Germanistik.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Germanisten, Linguisten und alle, die sich für die sprachliche Entwicklung des Althochdeutschen und die Analyse mittelalterlicher Texte interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke.
- Quote paper
- Sabrina Prinzen (Author), 2003, Die phonologische Beschreibung des Vokalismus im Hildebrandslied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13989