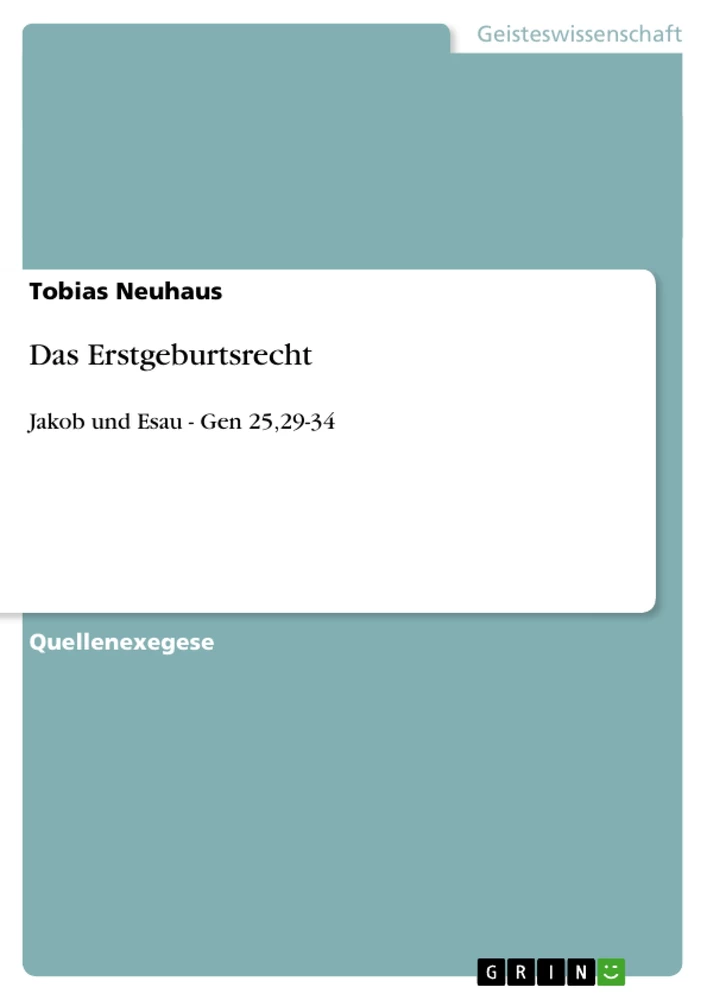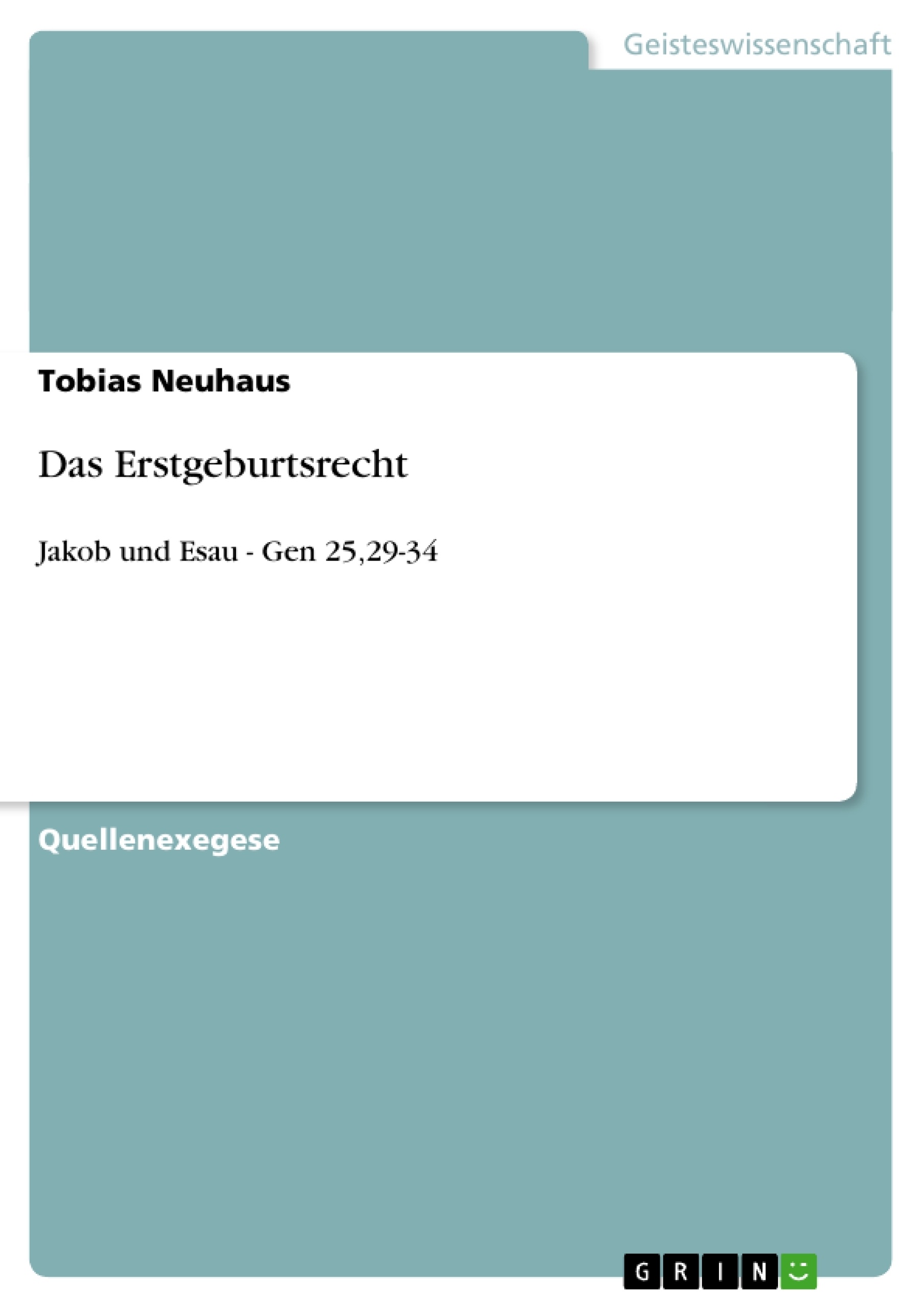In Gen 25,29-34 ist auf den ersten Blick keine auffällige Dynamik zu erkennen, da der gesamte Handlungsstrang an einem Ort stattfindet und dieser größtenteils aus einem Dialog besteht. Vor allem die ersten beiden Verse (29f) wirken auf den Leser starr und träge, was auf die Emotionen von Esau zurückzuführen ist, der erschöpft vom Feld kommt und dies seinem Bruder Jakob mitteilt, was die Trägheit erneut unterstreicht.
Jakobs Antwort auf die Frage Esaus nach etwas zu Essen treibt die Dynamik schließlich voran, da die Worte „jetzt sofort“ (v31) eine Unruhe innerhalb der Erzählung entfacht. Auch der Kontrast zwischen Esaus Gelassenheit und der hastigen Antwort Jakobs trägt zur Dynamik bei, da an dieser Stelle die enormen Gegensätzlichkeiten der Brüder aufeinander treffen. Es hat den Anschein, dass die entstandene Dynamik im Text durch die darauf folgende Antwort von Esau (v32) gehemmt wird. [...] In Gen 27,36 erwähnt Esau, dass er schon zweimal von seinem Bruder betrogen und ihm sein Erstgeburtsrecht von ihm entwendet wurde. Außerdem betont er, dass sein Bruder Jakob ihm nun auch den Segen nehmen will. Nachdem Jakob Esau den Segen genommen hat, wird er in Gen 27,41 der Feind von Jakob und will ihn rächen und töten (Gen 27,42). Somit ist der Konflikt, der aus dem Erstgeburtsrecht entstanden ist, noch nicht gesänftigt und spitzt sich durch die neue „Segenproblematik“ im Laufe von Gen 27 weiter zu.
In Gen 32,4 sendet Jakob seinem Bruder Esau Boten, indem er sich als Knecht Esaus bezeichnet und er sein Wohlwollen möchte. Jakob ist voller Angst, dass Esau ihn, seine Frau und Kinder tötet (Gen 32,12). So kommt es dazu, dass Jakob Esau ein Geschenk machen möchte (Gen 32,19). Esau verzeiht Jakob und der Streit ist somit geschlichtet (Gen 33,12).
Im Neuen Testament wird der Konflikt nur einmal erwähnt. In Hebr 12,16 wird Esau als unzüchtig und gottlos bezeichnet, da er für ein Mahl sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Er fungiert als „das warnende Beispiel eines Menschen, der sich selbst um den Segen brachte, der ihm zugedacht war.“ (DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT, 2004, 436f.) Durch den Tausch des Erstgeburtsrechts, also dem ewigen Heil, gegen ein vergängliches irdisches Erzeugnis (=Linsengericht) fungiert Esau als Abbild der Christen, die sich ihrer himmlischen Berufung abwenden und folglich Gottes Gnade verschmähen. (vgl. DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT, 2004, 436f.)
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung
1. Erster Leseeindruck
2. Synchrone Zugangsweise
2.1 Abgrenzung
2.2 Kontext
2.3 Aufbau
2.5 Bewegung
2.6 Intertextualität
3. Diachrone Beobachtung
3.1 Entstehungsgeschichte
4. Drei Forschungsthesen zum Sachverhalt
1. Jäger und Hirte
2. Das auserwählte Volk
3. Konkurrenz um die Verheißungslinie
Worterklärungen:
Schlagworte:
Literaturverzeichnis:
Kurzbeschreibung
Die Arbeit beginnt mit dem ersten Leseeindruck von Gen 25,29-34. Im Anschluss folgt die Synchrone Zugangsweise, in der die Texteinheit abgegrenzt, in den größeren Kontext eingeordnet, der Aufbau, die Bewegung und die Intertextualität der Verse analysiert werden. Daraufhin folgt die diachrone Beobachtung, die lediglich die Entstehungsgeschichte der Texteinheit thematisiert. Zuletzt folgen drei konträre Forschungsthesen zum Sachverhalt.
1. Erster Leseeindruck
Aufgrund der Hinterlistigkeit Jakobs, der den Hunger seines Bruders ausnutzt, um ihm sein Erstgeburtsrecht zu entwenden, hat Gen 25,29-34 bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Verhalten Jakobs erweckt bei mir den Anschein, dass Jakob rücksichtslos ist und sein eigener Bruder keinen Stellenwert in seinem Leben einnimmt.
2. Synchrone Zugangsweise
2.1 Abgrenzung
Westermann sieht ebenso wie Gunkel die Verse 29-34 als selbstständige Texteinheit an (vgl. Westermann, 1998, 264, 266f.; Gunkel, 1964, 297.). Dies ist plausibel, da Gen 25,27f. neben der Berufswahl von Jakob und Esau die Sympathien der Eltern gegenüber eines ihrer Kinder schildert. Im Anschluss an diese vollendete Texteinheit erfolgt in Gen 25,29 ein Handlungs- und Zeitwechsel, wobei letzteres auf den Terminus „Einst“ zurückzuführen ist. In dem Vers 29 werden zwar keine neuen Handlungsträger vorgestellt, allerdings wird hier der Fokus ausschließlich auf die Brüder Jakob und Esau gerichtet. Daraufhin findet zwischen den beiden Brüdern ein Dialog statt, indem Esau Jakob um etwas „von dem Roten“ (Gen 25,30) bittet und Jakob als Gegenleistung sein Erstgeburtsrecht fordert (v30f). Das Gespräch zwischen den Brüdern wird fortgesetzt und Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht an Jakob, da dieser seinem Bruder Brot und Linsengemüse reicht (v33f). Nach dem Speisen geht Esau hinfort und es folgt der Zusatz, dass er vom Erstgeburtsrecht nicht viel hält. Somit besteht die ganze Geschichte, bis auf wenige Zusätze, aus dem Dialog zwischen Jakob und Esau, was zu einer inneren Kohärenz führt. Der letzte Vers, der die Erzählung beendet, greift noch einmal das Erstgeburtsrecht auf, so dass von einem redundanten Ende gesprochen werden kann.
Nach Gen 25,34 folgt ein Handlungswechsel, da der Blick nun auf eine Hungersnot, die im Land ausbricht und auf Isaak gerichtet ist, der sich auf den Weg von Gerar zum Abimelech, dem König der Philister, begibt.
2.2 Kontext
Der Konflikt zwischen Jakob und Esau um das Erstgeburtsrecht in Gen 25,29-34 steht im Kontext der „Väter“- bzw. der so genannten „Patriarchen“- Erzählungen, die von Gen 12-50 reichen und somit zwischen der Urgeschichte und dem Buch Exodus vorzufinden sind. In der neueren Literatur werden diese Erzählungen auch als „Erzelternerzählungen“ (= EEE) bezeichnet, da die „Väter“ Israels als Eltern Israels zu verstehen sind. Die beiden älteren Bezeichnungen entsprechen „[…] zwar nicht dem Textbefund der Genesis, wohl aber den Vorstellungen jener, die die Bibel androzentrisch engführen und durch ihre Sprachwahl Leseleitlinien in die Texte eintragen, welche Frauen unsichtbar machen.“ (Fischer, 1998, 12.)
Die Einheitsübersetzung (EÜ) untergliedert allerdings die „Erzelternerzählung“ in die Kapitel „Die Erzväter“ (Gen 11,10-36,43) und „Die Söhne Jakobs“ (Gen 37,1-50,26), so dass, wenn von der „EEE“ die Rede ist, oft nur der Textbereich Gen 12-36 geltend gemacht wird.
2.3 Aufbau
Die Texteinheit Gen 25,29-34 lässt sich in drei Textabschnitte gliedern. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die innere Kohärenz, die in den einzelnen Abschnitten herrscht, und auf eine wiederholte Verwendung von Wörtern.
1. Teil: Vers 29f.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.5 Bewegung
In Gen 25,29-34 ist auf den ersten Blick keine auffällige Dynamik zu erkennen, da der gesamte Handlungsstrang an einem Ort stattfindet und dieser größtenteils aus einem Dialog besteht. Vor allem die ersten beiden Verse (29f) wirken auf den Leser starr und träge, was auf die Emotionen von Esau zurückzuführen ist, der erschöpft vom Feld kommt und dies seinem Bruder Jakob mitteilt, was die Trägheit erneut unterstreicht.
Jakobs Antwort auf die Frage Esaus nach etwas zu Essen treibt die Dynamik schließlich voran, da die Worte „jetzt sofort“ (v31) eine Unruhe innerhalb der Erzählung entfacht. Auch der Kontrast zwischen Esaus Gelassenheit und der hastigen Antwort Jakobs trägt zur Dynamik bei, da an dieser Stelle die enormen Gegensätzlichkeiten der Brüder aufeinander treffen. Es hat den Anschein, dass die entstandene Dynamik im Text durch die darauf folgende Antwort von Esau (v32) gehemmt wird. Allerdings ist dies nicht der Fall, da die impulsiven Worte „Schwör mir jetzt sofort“ (v33) von Jakob die gegensätzlichen Charakterzüge der Brüder erneut untermauern, sodass sich die Erzählung weiter zuspitzt und eine unterschwellige Spannung zwischen Jakob und Esau wahrzunehmen ist. Allerdings endet an diesem Punkt der Dialog und somit auch gewissermaßen die Dynamik in der Texteinheit. Das Ende der Erzählung wird eingeleitet und durch „Esaus Essen, Aufstehen, und Weggehen, als ob nichts gewesen wäre“ (Fischer, 2004, 55.) wird die Spannung endgültig genommen.
Festzuhalten ist also, dass die Dynamik im zweitem Textteil, welche zuvor (vgl. 2.3 Aufbau.) fundiert wurde, ihren Höhepunkt erlangt und sich mit der Reduzierung der Spannung zwischen den beiden Brüdern am Ende der Erzählung auflöst.
[...]
- Quote paper
- Tobias Neuhaus (Author), 2009, Das Erstgeburtsrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139708