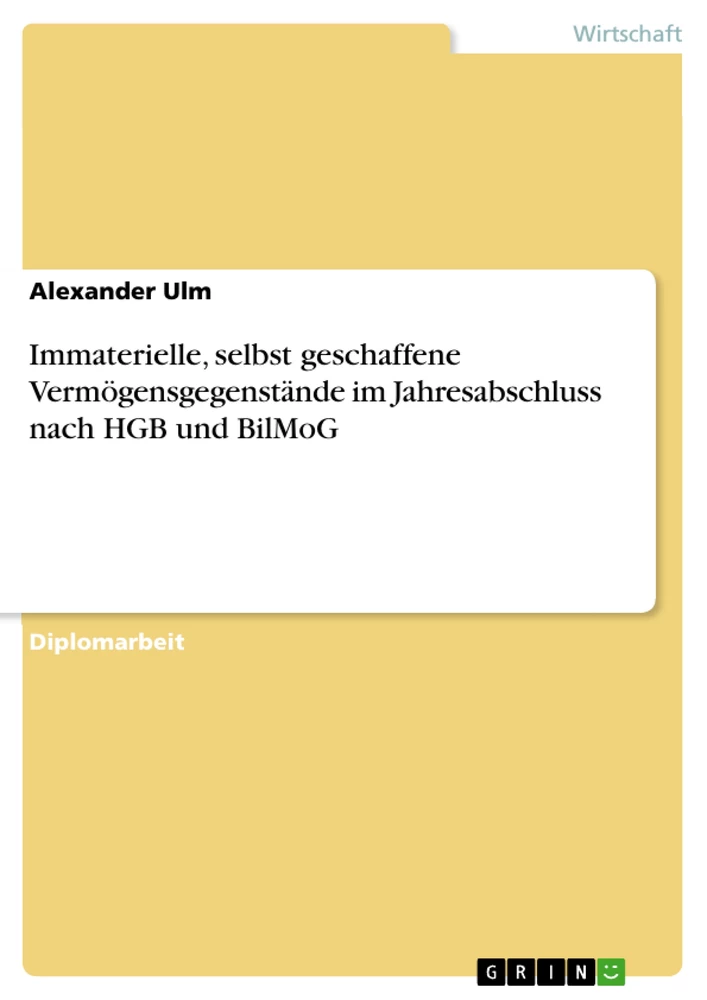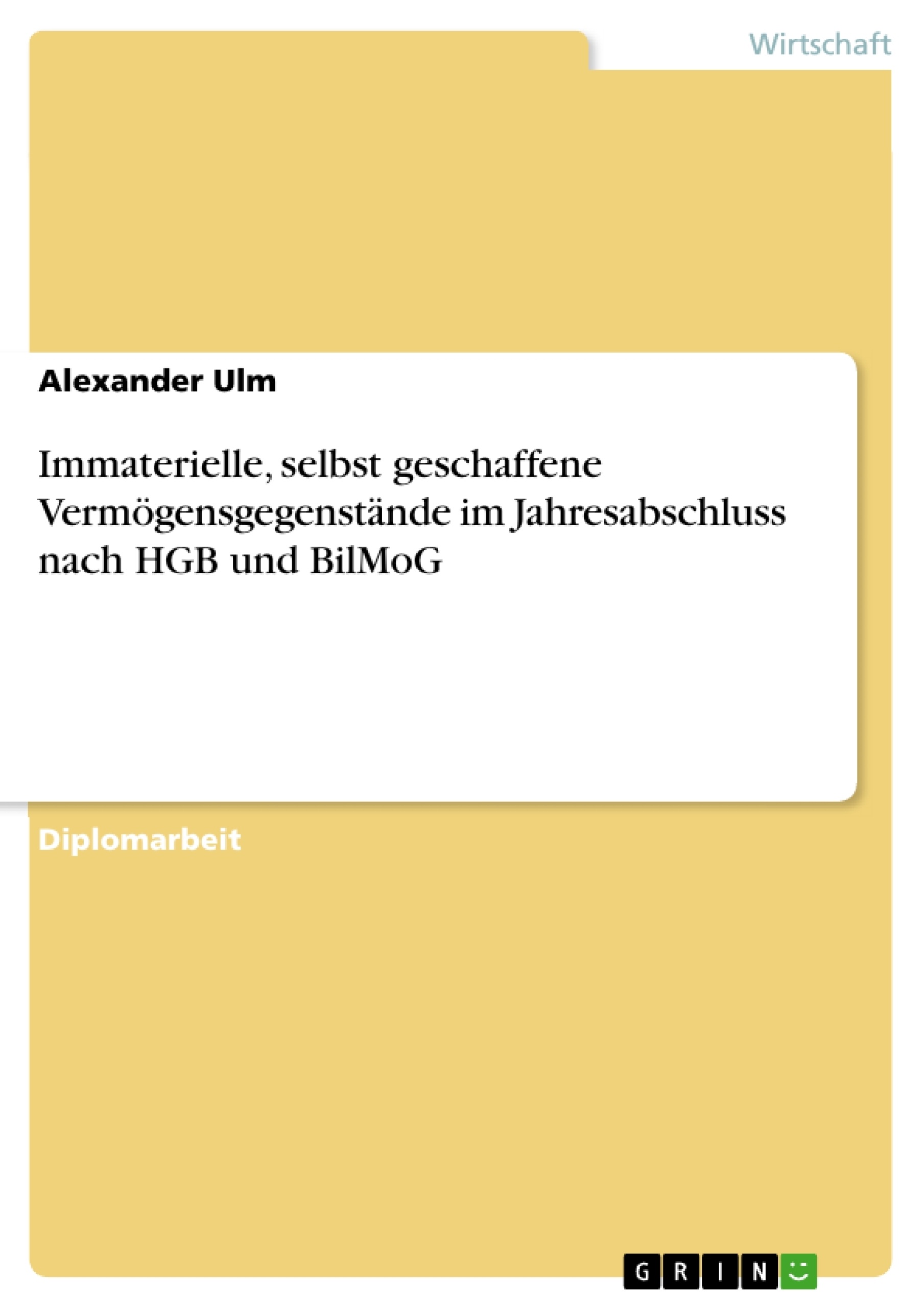Diese Diplomarbeit verfolgt mehrere Ziele. Zum einen soll sie als Leitfaden zur Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach dem neuen HGB dienen. Dabei werden die neuen Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften und die entsprechenden Gesetzesbegründungen sowie deren Auslegung in der Literatur kritisch dargestellt. Zum anderen wird untersucht, ob der Gesetzgeber die mit dem BilMoG verfolgten Ziele (Schaffung einer Alternative zu den IFRS, Anhebung des Informationsniveaus und Aufrechterhaltung eines hinreichenden Gläubigerschutzes) erreicht hat und das Gesetzesvorhaben dahingehend zweckmäßig umgesetzt wurde. Daneben werden offene Fragen und Ungereimtheiten aufgegriffen und unter Umständen Lösungs- bzw. Verbesserungsvorschläge angeboten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundsätze und Vorschriften zur Bilanzierung dem Grunde nach
- 2.1 Überblick
- 2.2 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit
- 2.2.1 Handelsrechtliche Aktivierungskonzeption
- 2.2.2 Steuerrechtliche Aktivierungskonzeption
- 2.3 Konkrete Aktivierungsfähigkeit
- 2.3.1 Zuordnung zum Betriebsvermögen
- 2.3.1.1 Personelle Zuordnung
- 2.3.1.2 Sachliche Zuordnung
- 2.3.1.3 Zeitliche Zuordnung
- 2.3.2 Aktivierungsverbot nach § 248 Abs. 2 HGB a. F.
- 2.3.3 Aktivierungswahlrecht und -verbot nach § 248 Abs. 2 HGB n. F.
- 2.3.1 Zuordnung zum Betriebsvermögen
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Grundsätze und Vorschriften zur Bilanzierung der Höhe nach
- 3.1 Zugangsbewertung
- 3.1.1 Umfang der zu aktivierenden Entwicklungskosten
- 3.1.2 Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten
- 3.2 Folgebewertung
- 3.2.1 Planmäßige Abschreibung
- 3.2.2 Außerplanmäßige Abschreibung
- 3.1 Zugangsbewertung
- 4. Ausschüttungssperre
- 5. Grundsätze und Vorschriften zur Bilanzierung dem Ausweis nach
- 5.1 Ausweis in der Bilanz und Anlagegitter
- 5.2 Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung
- 5.3 Angaben im Anhang und Lagebericht
- 6. Wesentliche Erkenntnisse und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bilanzielle Behandlung immaterieller, selbst geschaffener Vermögensgegenstände nach HGB und BilMoG. Ziel ist es, die komplexen Grundsätze und Vorschriften der Bilanzierung sowohl hinsichtlich des Grundes, der Höhe als auch des Ausweises zu beleuchten.
- Aktivierungsfähigkeit immaterieller Vermögensgegenstände
- Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände
- Ausweis immaterieller Vermögensgegenstände in der Bilanz
- Einfluss des BilMoG auf die Bilanzierung
- Kritische Würdigung der bestehenden Regelungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der bilanzrechtlichen Behandlung immaterieller, selbst geschaffener Vermögensgegenstände ein und umreißt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Relevanz des Themas im Kontext des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG).
2. Grundsätze und Vorschriften zur Bilanzierung dem Grunde nach: Dieses Kapitel analysiert die grundlegenden Prinzipien der Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände. Es differenziert zwischen abstrakter und konkreter Aktivierungsfähigkeit, wobei die handels- und steuerrechtlichen Konzeptionen verglichen werden. Die Zuordnung zum Betriebsvermögen (personell, sachlich, zeitlich) wird detailliert untersucht, ebenso wie Aktivierungsverbote und -wahlrechte gemäß § 248 Abs. 2 HGB (alt und neu). Die Kapitelteile beleuchten die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen und deren praktische Anwendung.
3. Grundsätze und Vorschriften zur Bilanzierung der Höhe nach: Das Kapitel befasst sich mit der Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände. Es beschreibt die Zugangsbewertung, insbesondere den Umfang der zu aktivierenden Entwicklungskosten und die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten. Die Folgebewertung wird mit ihren Aspekten der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibung eingehend untersucht, wobei die jeweiligen Methoden und deren Auswirkungen auf die Bilanz erläutert werden.
4. Ausschüttungssperre: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Regelungen bezüglich der Ausschüttungssperre im Zusammenhang mit der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände. Es analysiert die Voraussetzungen und die Konsequenzen der Sperre, sowie ihre Bedeutung für die Kapitalverwendung und -verfügbarkeit des Unternehmens.
5. Grundsätze und Vorschriften zur Bilanzierung dem Ausweis nach: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung immaterieller Vermögensgegenstände im Jahresabschluss. Es untersucht den Ausweis in der Bilanz und im Anlageverzeichnis, in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die notwendigen Angaben im Anhang und Lagebericht. Die korrekte und transparente Darstellung gemäß den gesetzlichen Vorgaben steht im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, Selbstgeschaffene Vermögensgegenstände, Bilanzierung, HGB, BilMoG, Aktivierung, Bewertung, Abschreibung, Ausweis, Jahresabschluss, Entwicklungskosten, § 248 HGB, Ausschüttungssperre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bilanzierung immaterieller, selbstgeschaffener Vermögensgegenstände nach HGB und BilMoG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die bilanzielle Behandlung immaterieller, selbstgeschaffener Vermögensgegenstände nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG). Sie beleuchtet die komplexen Grundsätze und Vorschriften der Bilanzierung hinsichtlich des Grundes, der Höhe und des Ausweises.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Aktivierungsfähigkeit immaterieller Vermögensgegenstände, ihre Bewertung, den Ausweis in der Bilanz, den Einfluss des BilMoG und eine kritische Würdigung der bestehenden Regelungen. Spezifische Aspekte umfassen die Zugangs- und Folgebewertung (inkl. Abschreibungen), die Ausschüttungssperre und die Darstellung im Jahresabschluss (Bilanz, Anlageverzeichnis, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Bilanzierung dem Grunde nach (abstrakte und konkrete Aktivierungsfähigkeit, Zuordnung zum Betriebsvermögen, Aktivierungsverbote und -wahlrechte nach § 248 Abs. 2 HGB), ein Kapitel zur Bilanzierung der Höhe nach (Zugangs- und Folgebewertung), ein Kapitel zur Ausschüttungssperre, ein Kapitel zur Bilanzierung dem Ausweis nach (Darstellung im Jahresabschluss) und abschließend ein Kapitel mit wesentlichen Erkenntnissen und einer kritischen Würdigung.
Was versteht man unter „abstrakter“ und „konkreter“ Aktivierungsfähigkeit?
Die Arbeit differenziert zwischen der abstrakten Aktivierungsfähigkeit (handels- und steuerrechtliche Konzeptionen) und der konkreten Aktivierungsfähigkeit (Zuordnung zum Betriebsvermögen: personell, sachlich, zeitlich). Die Unterscheidung klärt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein immaterieller Vermögensgegenstand überhaupt aktiviert werden darf.
Welche Rolle spielt § 248 Abs. 2 HGB?
§ 248 Abs. 2 HGB (in alter und neuer Fassung) regelt Aktivierungsverbote und -wahlrechte für immaterielle Vermögensgegenstände. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Regelungen und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung.
Wie wird die Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände behandelt?
Die Bewertung umfasst die Zugangsbewertung (insbesondere der Umfang aktivierbarer Entwicklungskosten und die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten) und die Folgebewertung (planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen). Die Arbeit beschreibt die jeweiligen Methoden und deren Auswirkungen auf die Bilanz.
Welche Bedeutung hat die Ausschüttungssperre?
Das Kapitel zur Ausschüttungssperre analysiert die rechtlichen Regelungen, Voraussetzungen und Konsequenzen dieser Sperre im Zusammenhang mit der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände und deren Bedeutung für die Kapitalverwendung und -verfügbarkeit des Unternehmens.
Wie werden immaterielle Vermögensgegenstände im Jahresabschluss ausgewiesen?
Die Arbeit untersucht den Ausweis immaterieller Vermögensgegenstände in der Bilanz und im Anlageverzeichnis, in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die notwendigen Angaben im Anhang und Lagebericht, um eine korrekte und transparente Darstellung gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Immaterielle Vermögensgegenstände, Selbstgeschaffene Vermögensgegenstände, Bilanzierung, HGB, BilMoG, Aktivierung, Bewertung, Abschreibung, Ausweis, Jahresabschluss, Entwicklungskosten, § 248 HGB, Ausschüttungssperre.
- Quote paper
- Diplom-Kaufmann (FH) Alexander Ulm (Author), 2009, Immaterielle, selbst geschaffene Vermögensgegenstände im Jahresabschluss nach HGB und BilMoG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139454