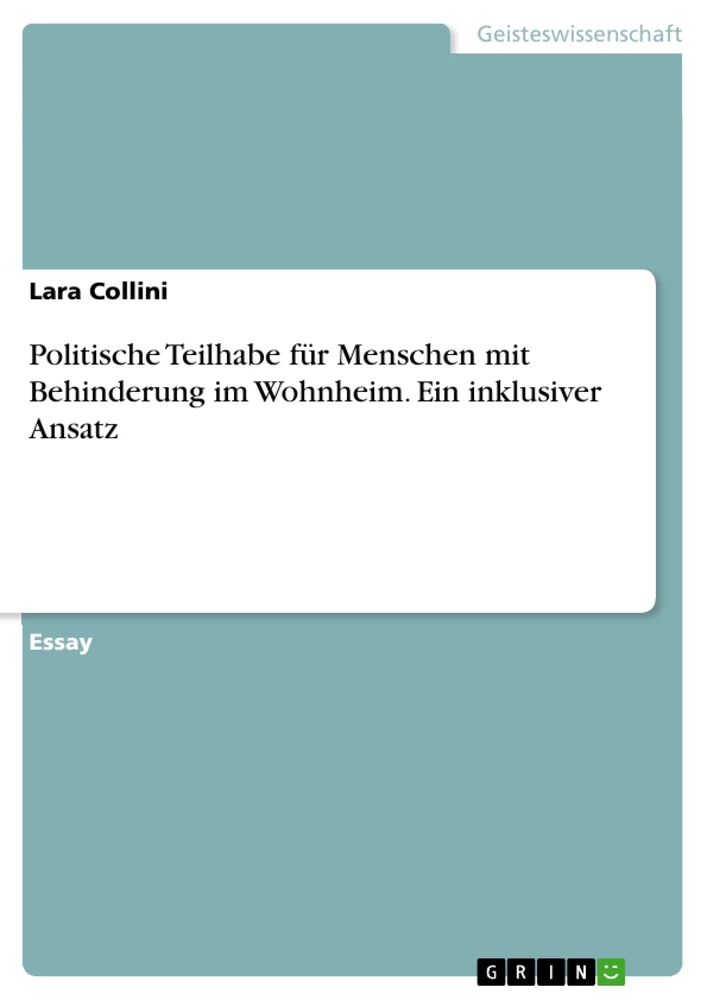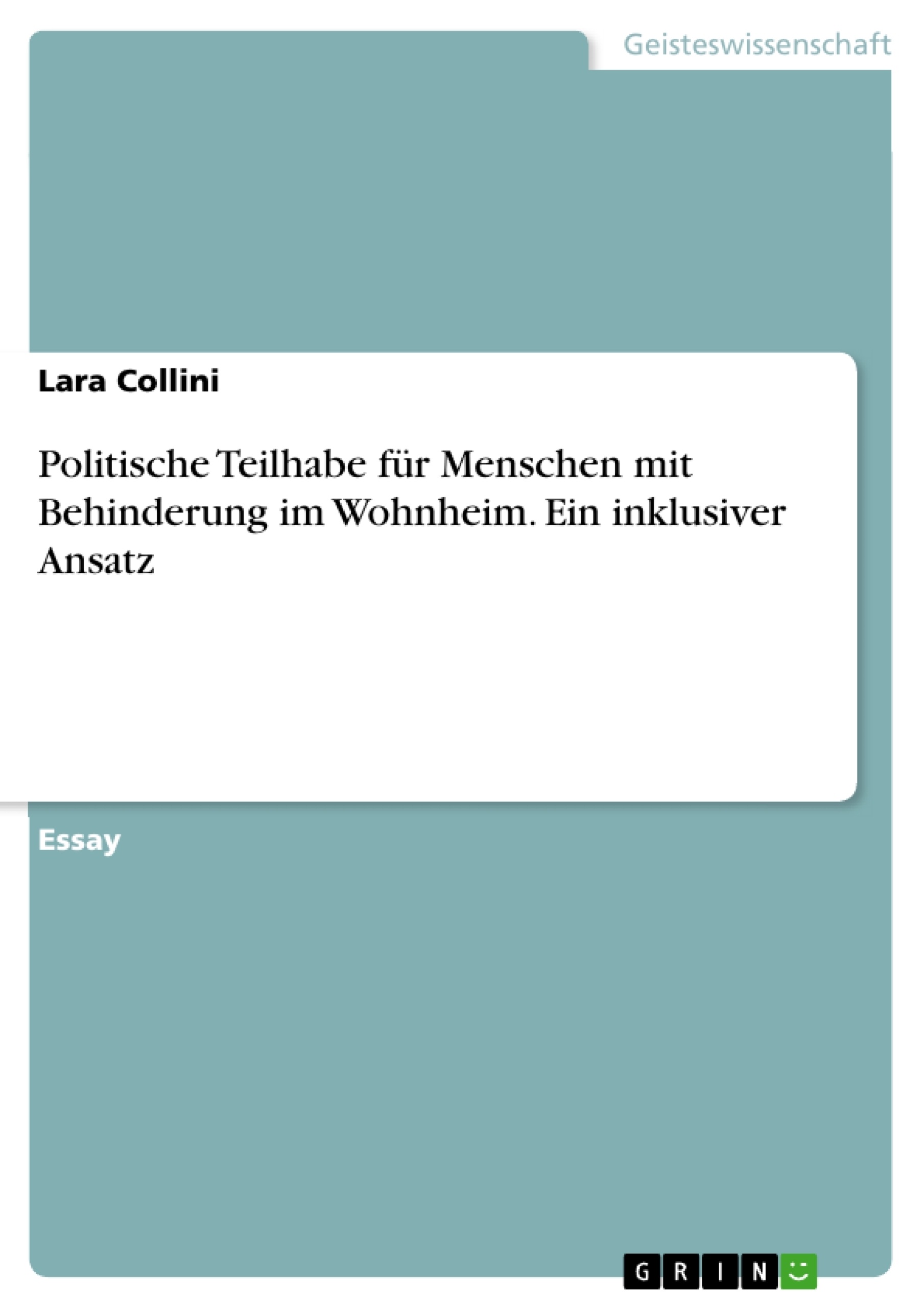In einem fiktiven, jedoch sehr realitätsbezogenen Szenario sollen Ansätze dargestellt werden, die Inklusion im Rahmen politischer Teilhabe für Menschen mit Behinderung möglich machen. Dabei wird Diskussionspotenzial sichtbar, jedoch auch positive Ausblicke für eine praktische Umsetzung. Kann eine Demokratie ohne Inklusion überhaupt eine echte Demokratie sein?
Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung erklärt im Laufe des Gesprächs, dass soziale Gerechtigkeit, als Grundwert unserer Gesellschaft, geltend gemacht wird, indem jeder Bürger Rechte nutzen, ausleben und einfordern kann – und manchmal auch muss, da Demokratie nicht selbstverständlich sei. Inklusion geschieht nicht rein aus Fürsorgeprinzipien, sondern weil alle Menschen in einer demokratischen Gesellschaft leben wollen, in der jedem dieselben Rechte und Chancen zustehen. Die Theorie erscheint einleuchtend, doch in welchem Maß exkludiert unsere Gesellschaft noch diejenigen, die von der allgemeinen Norm abweichen? Blicken wir auf unsere gesetzgebende Staatsgewalt, den Bundestag, erkennt man die Misslage: Rund 9,3 Prozent der deutschen Bevölkerung haben eine Behinderung, im Bundestag sitzen nur 3,3 Prozent solcher Menschen. Damit stellt die Süddeutsche Zeitung bei Ihrer Datenerhebung fest, dass 43 Abgeordnete fehlen, um die erforderliche Repräsentativität dieser Gesellschaftsmitglieder zu erreichen. Wenn wir uns von staatlicher Ebene wegbewegen, bleibt die Frage, wie wir Demokratie im kleineren Rahmen trotzdem fördern können. Dies soll Grundlage für folgende Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine Einordnung des Begriffs „Inklusion“
- Allgemeine Begriffserklärung
- Rechtliche Einordnung
- Die Erarbeitung eines Konzepts
- Situationsbeschreibung der Ausgangslage
- Zielsetzung der Einrichtung
- Sozialethische Theorien als Anspruchsgrundlage
- Zielsetzung der Einrichtung auf Grundlage der Anerkennungstheorie
- Beispiele der Umsetzung
- Rekapitulation und Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen im Kontext der Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung. Sie analysiert den Begriff der Inklusion im Kontext der deutschen Rechtsordnung und entwickelt ein Konzept, das auf sozialethischen Theorien basiert und auf die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Einschränkungen eingeht. Das Konzept wird an einem fiktiven Szenario einer Wohneinrichtung für Menschen mit starken kognitiven Einschränkungen illustriert.
- Definition und Einordnung des Begriffs „Inklusion“ im deutschen Rechtssystem
- Analyse der sozialenthischen Grundlagen der Inklusion
- Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen
- Anwendung des Konzepts auf ein konkretes Szenario
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen der Inklusion in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Thematik der Inklusion ein und stellt die Frage, wie Demokratie ohne Inklusion funktionieren kann. Es beleuchtet den Missstand, dass Menschen mit Behinderung im deutschen Bundestag unterrepräsentiert sind und setzt sich mit dem Begriff der Inklusion als Gegenpol zur Exklusion auseinander.
- Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Einordnung des Begriffs „Inklusion“. Zunächst wird eine allgemeine Begriffserklärung geliefert, die sich auf den Ursprung des Begriffs in der Bildungspädagogik und die UN-Behindertenrechtskonvention bezieht. Anschließend wird der rechtliche Status des Themas in Deutschland behandelt, wobei das Grundgesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz als wesentliche Rechtsgrundlagen für Inklusion vorgestellt werden.
- Das dritte Kapitel widmet sich der Erarbeitung eines Konzepts für die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen im Rahmen der Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung. Zunächst wird die Situation in einer Wohneinrichtung für Menschen mit starken kognitiven Einschränkungen beschrieben. Im Anschluss wird die Zielsetzung der Einrichtung vorgestellt und die sozialenthischen Theorien als Grundlage des Konzepts beleuchtet. Die Autonomie des Einzelnen, das Prinzip der Fürsorge und die soziale Wertschätzung werden als zentrale ethische Motive dargestellt.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behinderung, UN-Behindertenrechtskonvention, sozialethische Theorien, Autonomie, Fürsorge, soziale Wertschätzung, Menschenrechte, Teilhabe, Gleichstellung, Selbstbestimmung, Wohneinrichtung, Betreuung, Pflege, Konzept, Umsetzung, Herausforderungen, Chancen, Praxis.
- Quote paper
- Lara Collini (Author), 2022, Politische Teilhabe für Menschen mit Behinderung im Wohnheim. Ein inklusiver Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1393901