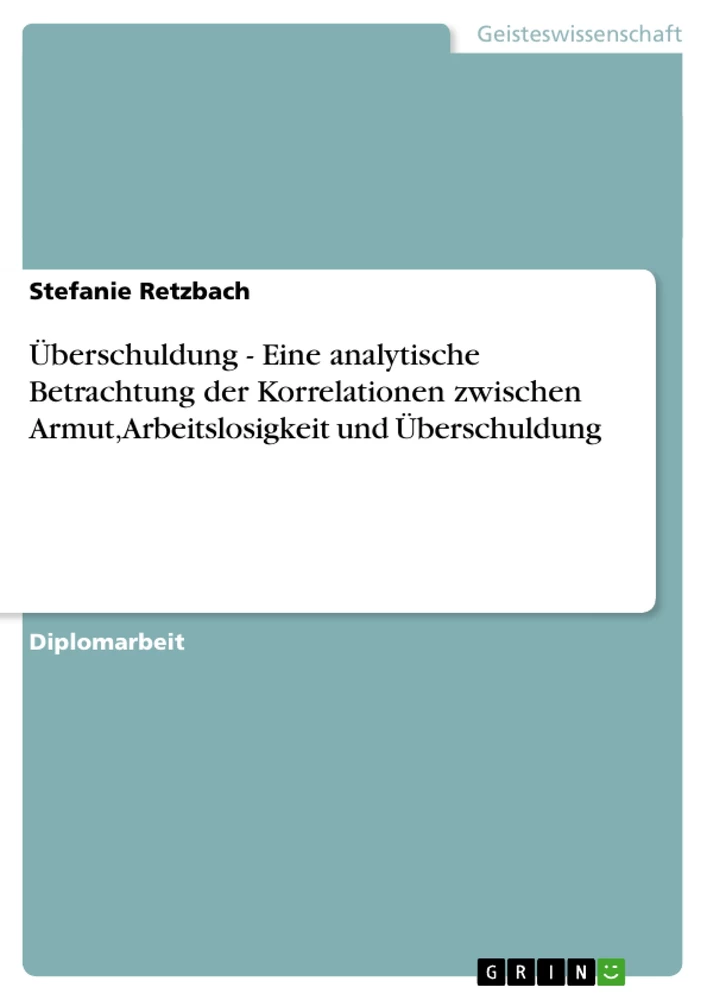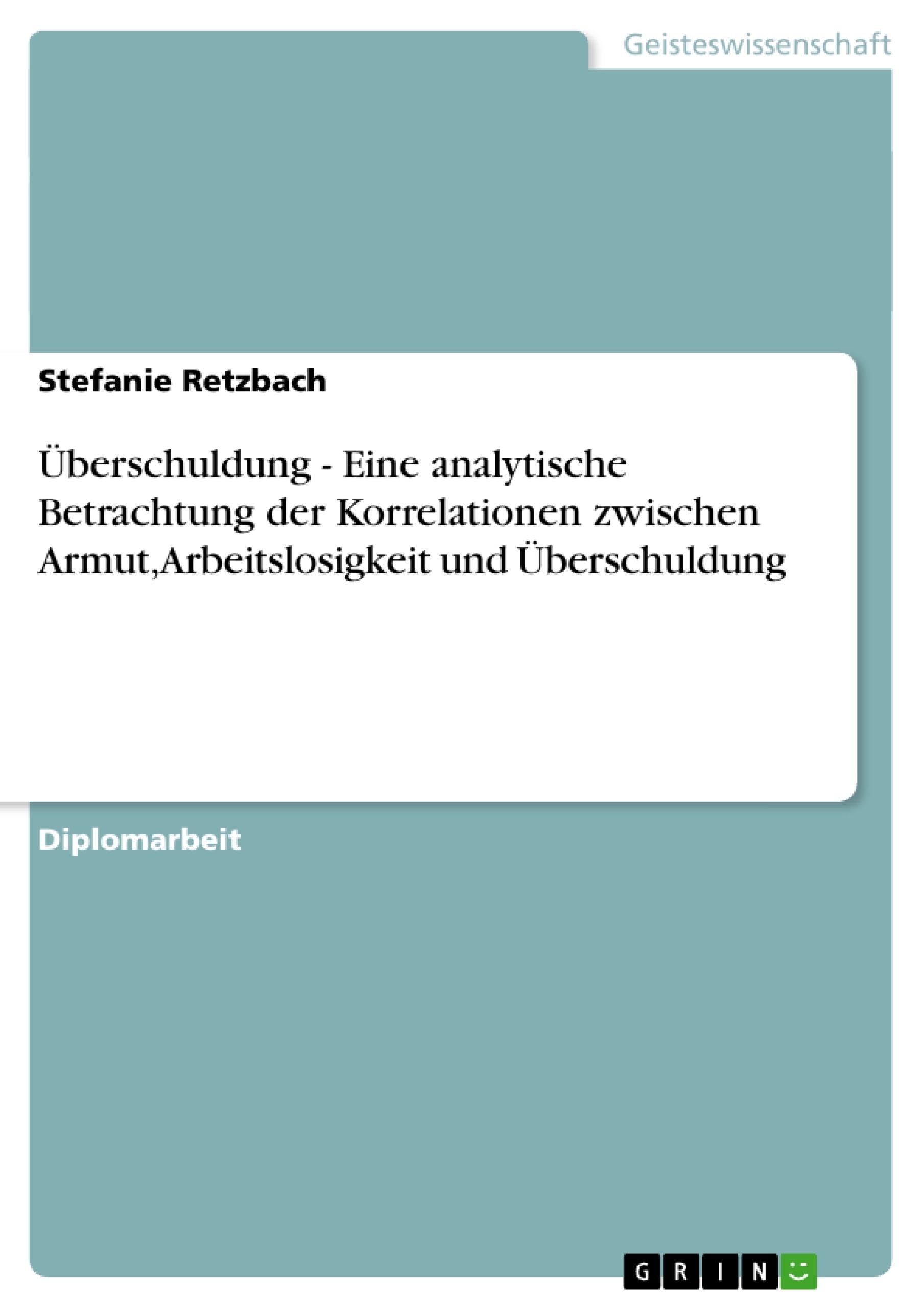„Schulden, ist das einzige, was man ohne Geld machen kann.“
Karl Pisa (*1924), österreichischer Politiker
Geld hat einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Dies wird deutlich wenn man sieht, welche Ausgrenzungen Menschen erfahren, die keines haben. Diese leben nicht nur in Armut, sondern können auch relativ schnell in eine Überschuldung geraten. Erwerbsarbeit als Quelle zur Erlangung monetärer Mittel spielt somit eine herausragende Rolle. Nicht nur die Sicherung des Lebensunterhalts ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, sondern ebenso die Bedeutung der beruflichen Stellung für den einzelnen sowie seine gesellschaftliche Position.
Es wird eine Übersicht über die Überschuldungssituation in Deutschland erstellt sowie auf deren Ursachen eingegangen. Ursachen können zum einen unverschuldete Ereignisse wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit sein. Zum anderen können diese aber auch selbstverschuldet oder dem gesellschaftlichen Wandel zuzurechnen sein.
Armut spielt eine nicht minderwichtige Rolle, wenn es um die Überschuldung geht. Die derzeitige Armutslage wird anhand aktueller Zahlen zusammen mit deren Entwicklung dargestellt. Gerade finanziell schlechter gestellte Menschen sind besonders gefährdet in die Überschuldung abzurutschen.
Vor allem Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind maßgebliche Faktoren, welche ein gesichertes Einkommen gefährden. Somit können diese unmittelbare Auslöser einer Überschuldung sein. Aktuelle Daten zur Arbeitslosigkeit sowie prekär Beschäftigter werden anhand von Tabellen ebenso dargestellt wie auch Strukturveränderungen im Arbeitsmarkt.
Armut und Arbeitslosigkeit haben großen Einfluss auf eine mögliche Überschuldung. Allerdings ist dieser Bezug nicht nur einseitig. Die drei Faktoren korrelieren in hohem Maße. Dies wird in dieser Arbeit detailliert herausgearbeitet.
Auch wird auf die aktuelle wirtschaftliche Lage eingegangen um auf Veränderungen sowie steigende Bedarfe im Bereich der Hilfe für Verschuldete aufmerksam zu machen.
Die steigende Eigenverantwortung, welche der Staat den Bürgern immer mehr einräumt (z. B. in der Renten- und Krankenversicherung), führt in manchen Bevölkerungsgruppen zu einer Überforderung. Gerade hier ist es wichtig, durch präventive Angebote die Beurteilungs- und Entscheidungsfähigkeit, in Bezug auf die eigenen Finanzen, zu stärken. Es wird eine Übersicht über bisherige Präventionsangebote gegeben und auf unseriöse Kreditgeber und Schuldenregulierer hingewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinitionen
- 2.1 Schuldnerberatung
- 2.2 Ver- und Überschuldung
- 2.3 Armut
- 2.4 Verbraucherinsolvenz
- 3 Entwicklung und sozioökonomische Strukturen von Überschuldung
- 3.1 Entwicklung der Überschuldung in Deutschland
- 3.1.1 Relative Daten zur Überschuldung anhand von Indikatoren
- 3.1.2 Absolute Daten zur Überschuldung auf Basis der Insolvenzstatistik
- 3.2 Sozioökonomische Strukturen überschuldeter Personen
- 3.2.1 Schulden nach dem Haushaltstyp
- 3.2.2 Schulden nach der Einkommensquelle
- 3.3 Auswirkungen der Überschuldung
- 3.1 Entwicklung der Überschuldung in Deutschland
- 4 Ursachen von Verschuldung
- 4.1 Unverschuldete Ereignisse
- 4.2 Fehler im Verhalten der Verschuldeten
- 4.3 Gesellschaftlicher Wandel
- 5 Armut und deren Entwicklung
- 5.1 Einkommensungleichheit in Deutschland
- 5.2 Armut und Niedrigeinkommen
- 5.3 Betroffene Bevölkerungsgruppen
- 5.4 Transferleistungen
- 5.5 Auswirkungen von Armut
- 6 Arbeitslosigkeit als Hauptursache und Risikomerkmal von Überschuldung
- 6.1 Empirische Daten zur Arbeitslosigkeit
- 6.2 Arbeitslosigkeit und prekär Beschäftigte
- 6.3 Strukturveränderungen im Arbeitsmarkt
- 6.4 Auswirkungen von Arbeitslosigkeit
- 7 Korrelationen von Überschuldung, Arbeitslosigkeit und Armut
- 7.1 Ausgestaltung der Korrelationen
- 7.2 Universelle Risikogruppen
- 7.3 Auswirkungen der Korrelations-Faktoren
- 7.3.1 Gesundheitliche Folgen
- 7.3.2 Einschränkungen der gesellschaftlichen Teilhabe
- 7.4 Kausalität der Überschuldung im Kontext mit Armut und Arbeitslosigkeit
- 7.5 Die Wirtschaftskrise und deren Auswirkung auf Armut und Überschuldung
- 8 Überschuldungsprävention
- 8.1 Anbieter von Prävention
- 8.1.1 Schuldnerberatungsstellen
- 8.1.2 Verbraucherzentralen
- 8.2 Finanzielle Allgemeinbildung
- 8.2.1 Bildung generell
- 8.2.2 Finanzielle Bildung im speziellen
- 8.2.2.1 Warum ist finanzielle Bildung wichtig?
- 8.2.2.2 Bildungsansätze und deren Inhalte
- 8.3 Geschäfte mit der Armut
- 8.4 Prävention bei Arbeitslosigkeit
- 8.1 Anbieter von Prävention
- 9 Fazit / Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die komplexen Zusammenhänge zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung. Ziel ist es, die Korrelationen zwischen diesen drei sozioökonomischen Faktoren zu analysieren und aufzuzeigen, welche Risikogruppen besonders betroffen sind. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Ursachen der Überschuldung als auch deren Auswirkungen auf die betroffenen Individuen und die Gesellschaft.
- Definition und Entwicklung von Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung
- Analyse der sozioökonomischen Strukturen überschuldeter Personen
- Untersuchung der Ursachen von Überschuldung (unverschuldete Ereignisse, Verhaltensfehler, gesellschaftlicher Wandel)
- Analyse der Korrelationen zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung
- Möglichkeiten der Überschuldungsprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Überschuldung ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung. Sie skizziert den Aufbau und die Methodik der Arbeit.
2 Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Schuldnerberatung, Ver- und Überschuldung, Armut und Verbraucherinsolvenz. Es legt die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie und klärt mögliche Mehrdeutigkeiten.
3 Entwicklung und sozioökonomische Strukturen von Überschuldung: Hier wird die Entwicklung der Überschuldung in Deutschland anhand von relativen und absoluten Daten untersucht. Der Fokus liegt auf der Analyse sozioökonomischer Strukturen überschuldeter Personen, wobei Haushaltstypen und Einkommensquellen berücksichtigt werden. Die Auswirkungen der Überschuldung auf betroffene Personen werden ebenfalls beleuchtet.
4 Ursachen von Verschuldung: Dieses Kapitel differenziert die Ursachen von Verschuldung in unverschuldete Ereignisse, Fehler im Verhalten der Verschuldeten und gesellschaftlichen Wandel. Es analysiert die individuellen und strukturellen Faktoren, die zu Überschuldung beitragen. Die Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Ursachen werden eingehend erläutert.
5 Armut und deren Entwicklung: Das Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Armut in Deutschland, untersucht die Einkommensungleichheit und beleuchtet betroffene Bevölkerungsgruppen. Die Rolle von Transferleistungen sowie die Auswirkungen von Armut werden detailliert analysiert, um ein umfassendes Bild der Armutssituation zu zeichnen.
6 Arbeitslosigkeit als Hauptursache und Risikomerkmal von Überschuldung: Dieses Kapitel untersucht empirische Daten zur Arbeitslosigkeit und deren Zusammenhang mit Überschuldung. Es betrachtet prekär Beschäftigte und Strukturveränderungen am Arbeitsmarkt sowie die direkten Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die finanzielle Situation der Betroffenen.
7 Korrelationen von Überschuldung, Arbeitslosigkeit und Armut: Hier werden die komplexen Korrelationen zwischen den drei zentralen Themenfeldern – Überschuldung, Arbeitslosigkeit und Armut – analysiert. Es werden universelle Risikogruppen identifiziert und die gesundheitlichen sowie gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Korrelationen diskutiert. Der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität wird hervorgehoben.
8 Überschuldungsprävention: Das Kapitel widmet sich der Prävention von Überschuldung. Es stellt verschiedene Anbieter von Präventionsmaßnahmen vor, wie Schuldnerberatungsstellen und Verbraucherzentralen, und analysiert die Bedeutung finanzieller Allgemeinbildung. Es werden verschiedene Präventionsansätze und deren Inhalte kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Armut, Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Korrelation, Risikofaktoren, Sozioökonomie, Schuldnerberatung, Prävention, Einkommensungleichheit, Verbraucherinsolvenz, Gesellschaftlicher Wandel, Transferleistungen, Empirische Daten, Wirtschaftskrise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die komplexen Zusammenhänge zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung in Deutschland. Sie analysiert die Korrelationen zwischen diesen drei sozioökonomischen Faktoren und identifiziert besonders betroffene Risikogruppen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Ursachen der Überschuldung als auch deren Auswirkungen auf Individuen und Gesellschaft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenbereiche: Definition und Entwicklung von Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung; Analyse der sozioökonomischen Strukturen überschuldeter Personen; Untersuchung der Ursachen von Überschuldung (unverschuldete Ereignisse, Verhaltensfehler, gesellschaftlicher Wandel); Analyse der Korrelationen zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung; und Möglichkeiten der Überschuldungsprävention.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert. Sie beginnt mit einer Einleitung und Begriffsdefinitionen. Es folgen Kapitel zur Entwicklung und sozioökonomischen Strukturen der Überschuldung, den Ursachen von Verschuldung, der Entwicklung von Armut, Arbeitslosigkeit als Hauptursache und Risikomerkmal für Überschuldung, sowie die Analyse der Korrelationen zwischen diesen drei Faktoren. Das letzte Kapitel befasst sich mit der Überschuldungsprävention und endet mit einem Fazit.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl relative als auch absolute Daten zur Überschuldung in Deutschland, basierend auf Indikatoren und Insolvenzstatistiken. Empirische Daten zur Arbeitslosigkeit werden ebenfalls analysiert. Die Arbeit stützt sich auf statistische Daten und analysiert sozioökonomische Strukturen überschuldeter Personen anhand von Haushaltstypen und Einkommensquellen.
Welche Ursachen für Überschuldung werden untersucht?
Die Arbeit differenziert die Ursachen von Überschuldung in drei Kategorien: unverschuldete Ereignisse (z.B. Krankheit, Arbeitslosigkeit), Fehler im Verhalten der Verschuldeten (z.B. Konsumverhalten, mangelnde Finanzplanung) und gesellschaftlicher Wandel (z.B. zunehmende Einkommensungleichheit, Veränderungen im Arbeitsmarkt).
Welche Risikogruppen werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert universelle Risikogruppen, die besonders von den Korrelationen zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung betroffen sind. Diese Gruppen werden anhand der analysierten Daten und ihrer sozioökonomischen Strukturen bestimmt.
Welche Möglichkeiten der Überschuldungsprävention werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Möglichkeiten der Überschuldungsprävention, darunter die Rolle von Schuldnerberatungsstellen und Verbraucherzentralen, die Bedeutung finanzieller Allgemeinbildung und Präventionsansätze bei Arbeitslosigkeit. Die Wirksamkeit verschiedener Ansätze wird kritisch diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen im Bereich der Überschuldungsprävention und der Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Armut, Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Korrelation, Risikofaktoren, Sozioökonomie, Schuldnerberatung, Prävention, Einkommensungleichheit, Verbraucherinsolvenz, Gesellschaftlicher Wandel, Transferleistungen, Empirische Daten, Wirtschaftskrise.
- Quote paper
- Stefanie Retzbach (Author), 2009, Überschuldung - Eine analytische Betrachtung der Korrelationen zwischen Armut, Arbeitslosigkeit und Überschuldung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139336