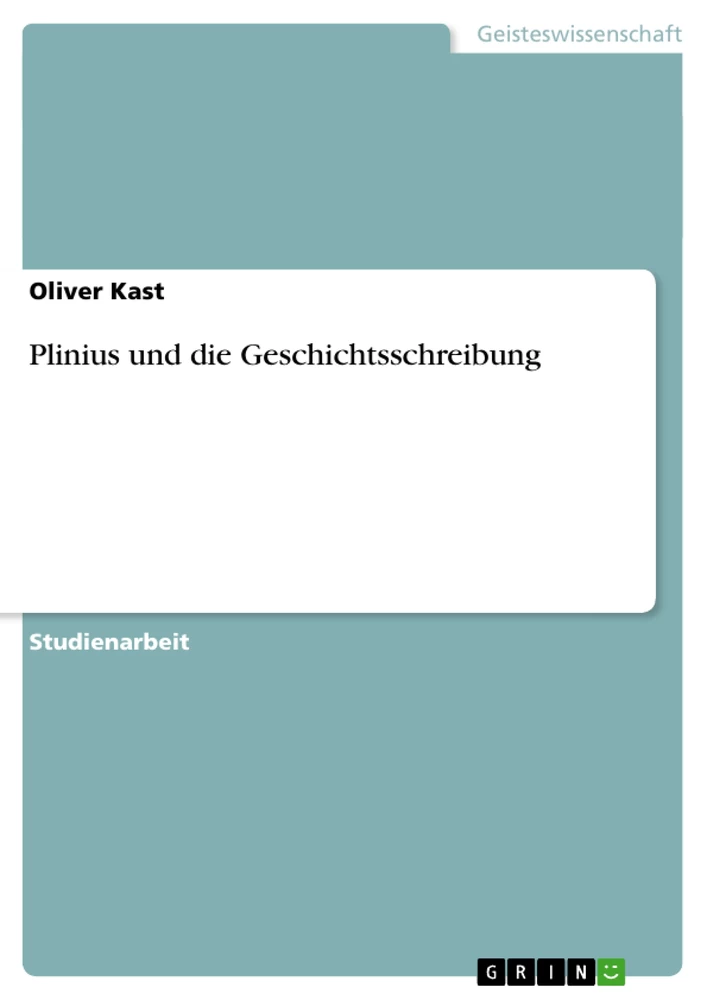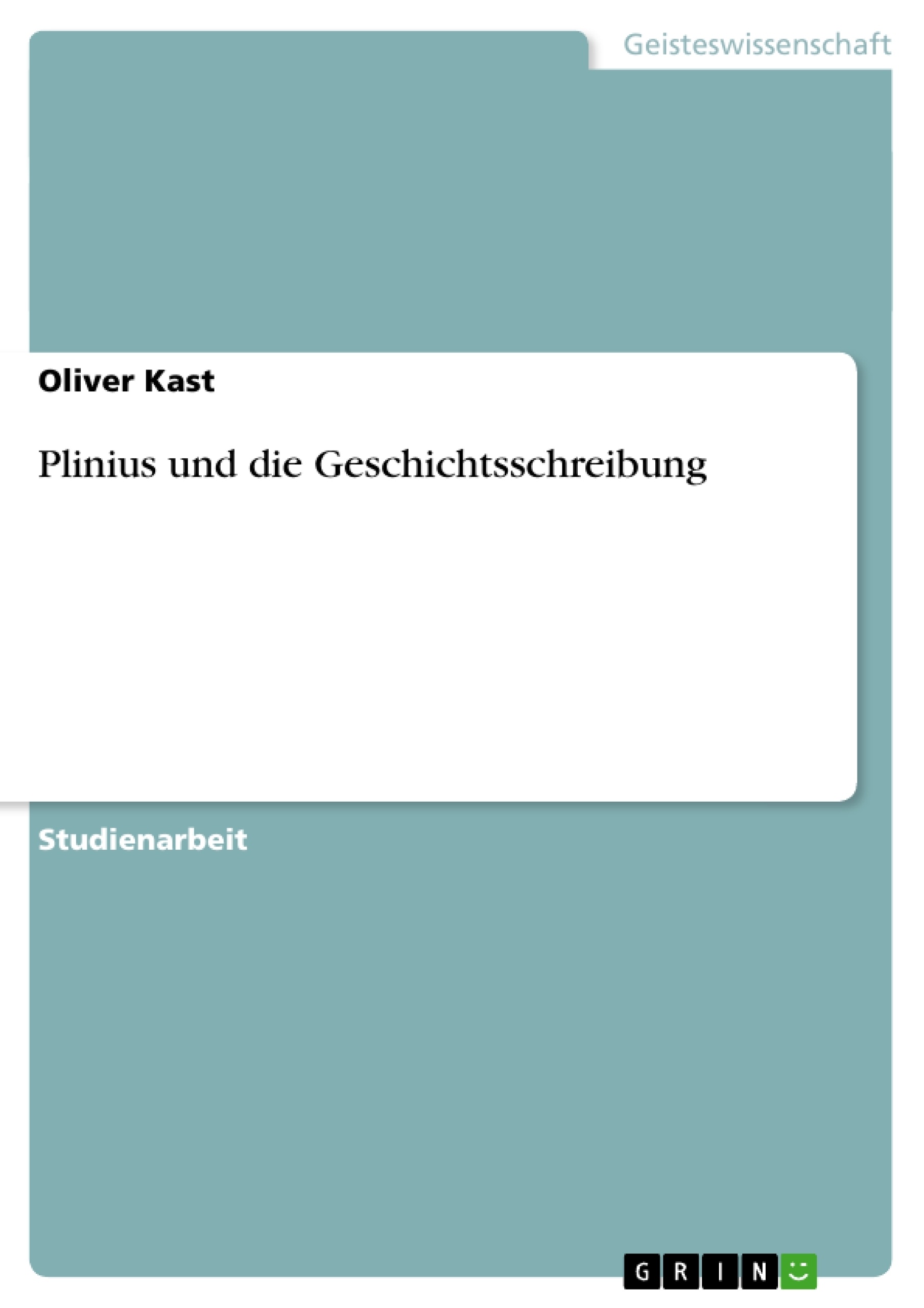Gaius Plinius Caecilius Secundus könnte man heutzutage sicherlich salopp als ein antikes Multitalent bezeichnen, da er sich in der frühen Kaiserzeit sowohl als Politiker, als auch als Anwalt, als Redner und auch als Schriftsteller praktisch in allen Belangen des damaligen öffentlichen Lebens hervortat. Er war eben ein vielseitiger Mann. So ist es denn auch kaum verwunderlich, daß er sich als Literat nicht ausschließlich auf die schriftliche Überarbeitung seiner Reden und auf seine Briefe beschränkte, sondern daß er daneben auch einen Panegyricus auf Kaiser Trajan, unter dem er als Beamter mit häufig wechselndem Ressort Ruhm und Ansehen erlangte, verfaßte, und sogar begann, Gedichte zu schreiben. Für kurze Zeit trug er sich überdies mit dem Gedanken, als Geschichtsschreiber tätig zu werden, was er aber scheinbar doch recht schnell wieder verwarf. Dieses Vorhaben hätte er wohl auch weniger aus literarischem Interesse für das Genre, als vielmehr aus dem alten menschlichen Verlangen heraus, sich mit seinem Werk verewigen zu wollen und so Unsterblichkeit und Ruhm bei der Nachwelt zu erlangen, in Angriff genommen. So sagt Plinius z. B. in III, 7,14: „Wenn es uns schon nicht vergönnt ist, länger zu leben, so wollen wir doch etwas hinterlassen, das später einmal unsere Existenz bezeugt“. Angesichts dieser Furcht vor dem Nichts, das den Menschen nach dem Tod zu verschlucken droht, und aufgrund des Glaubens, daß nur das Vollendete eine Chance besitze zu überleben, ist solche existenzielle Angst der Hintergrund von „amor immortalitatis“ (III, 7,15), die er durch literarischen Ruhm zu erreichen strebt. Er sieht sich quasi einem Wettlauf mit dem Tod ausgesetzt, dem er durch die gloria zu entrinnen sucht.
Ziel dieser Arbeit wird nun sein, anhand der Briefe V, 8; VI, 16; IV, 11 sowie VII, 33 Plinius‘ Einstellung zur Geschichtsschreibung darzustellen und aufzuzeigen, inwiefern er trotz seines Entschlusses, keine Geschichte schreiben zu wollen, dies dann letztendlich doch tut. Hierbei werde ich in detaillierter Analyse auf den für das Thema zentralen Brief V, 8 eingehen (wobei ich diesen nach mir sinnvoll erscheinenden Abschnitten, denen jeweils ein Übersetzungs-vorschlag vorangestellt wird, gliedern werde) und die drei übrigen Briefe VI, 16; IV, 11 und VII, 33 als Beispiele für Plinius‘ Darstellung von Geschichte heranziehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung in die Thematik: Plinius' Ringen um Unsterblichkeit
- II. Plinius Einstellung zur Geschichtsschreibung
- 1) Detaillierte Analyse des Briefes V, 8
- 2) Analyse des Briefes VII, 33
- III. Plinius Art der Geschichtsschreibung in Briefform
- 1) Plinius Darstellung des Vesuvausbruches i. J. 79 als Geschichtsschreibung (Ep. VI, 16)
- 2) Plinius Darstellung der Hinrichtung einer Vestalin auf Befehl Domitians (Ep. IV, 11)
- IV. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Einstellung des römischen Schriftstellers Plinius der Jüngere zur Geschichtsschreibung anhand von ausgewählten Briefen. Die Analyse fokussiert darauf, Plinius‘ ambivalenten Umgang mit dem Schreiben von Geschichte aufzuzeigen, obwohl er sich zunächst gegen ein solches Vorhaben sträubte. Die Arbeit untersucht die Gründe für diese Ambivalenz und beleuchtet, wie Plinius letztendlich durch seine Briefe doch Geschichte schreibt.
- Plinius' Ringen um Unsterblichkeit und Ruhm durch literarische Werke
- Plinius' ambivalente Haltung zur Geschichtsschreibung
- Analyse ausgewählter Briefe, um Plinius' Art der Geschichtsschreibung in Briefform zu beleuchten
- Das Spannungsfeld zwischen persönlicher Erfahrung und historischer Bedeutung in Plinius' Briefen
- Die Rolle der Briefe als Quelle für die Rekonstruktion historischer Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet Plinius' Motivation, sich mit literarischen Werken zu verewigen. Es wird auf seine existenzielle Angst vor dem Tod und seinen Wunsch nach Unsterblichkeit durch Ruhm eingegangen. Im zweiten Kapitel wird Plinius' Einstellung zur Geschichtsschreibung anhand des Briefes V, 8 detailliert analysiert. Dieses Kapitel untersucht Plinius' anfängliche Abneigung gegen das Schreiben einer Geschichte, sowie die Argumente, die ihn letztlich doch dazu bewogen, Geschichte in Briefform zu schreiben. Das dritte Kapitel beleuchtet Plinius' Darstellung von Geschichte in Briefform anhand der Briefe VI, 16 und IV, 11. Es geht darum, wie Plinius in seinen Briefen historische Ereignisse wie den Vesuvausbruch und die Hinrichtung einer Vestalin schildert.
Schlüsselwörter
Plinius der Jüngere, Geschichtsschreibung, Briefe, Unsterblichkeit, Ruhm, Vesuvausbruch, Vestalin, Domitian, historische Ereignisse, Literatur, antike Geschichte, Briefform.
- Citation du texte
- Oliver Kast (Auteur), 2000, Plinius und die Geschichtsschreibung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13922