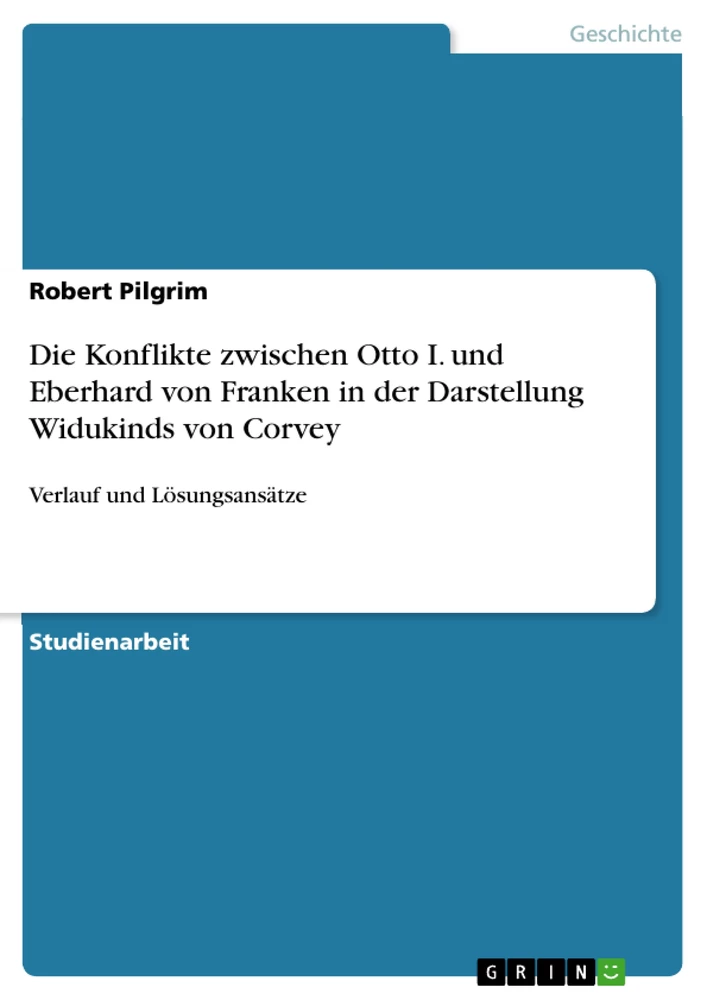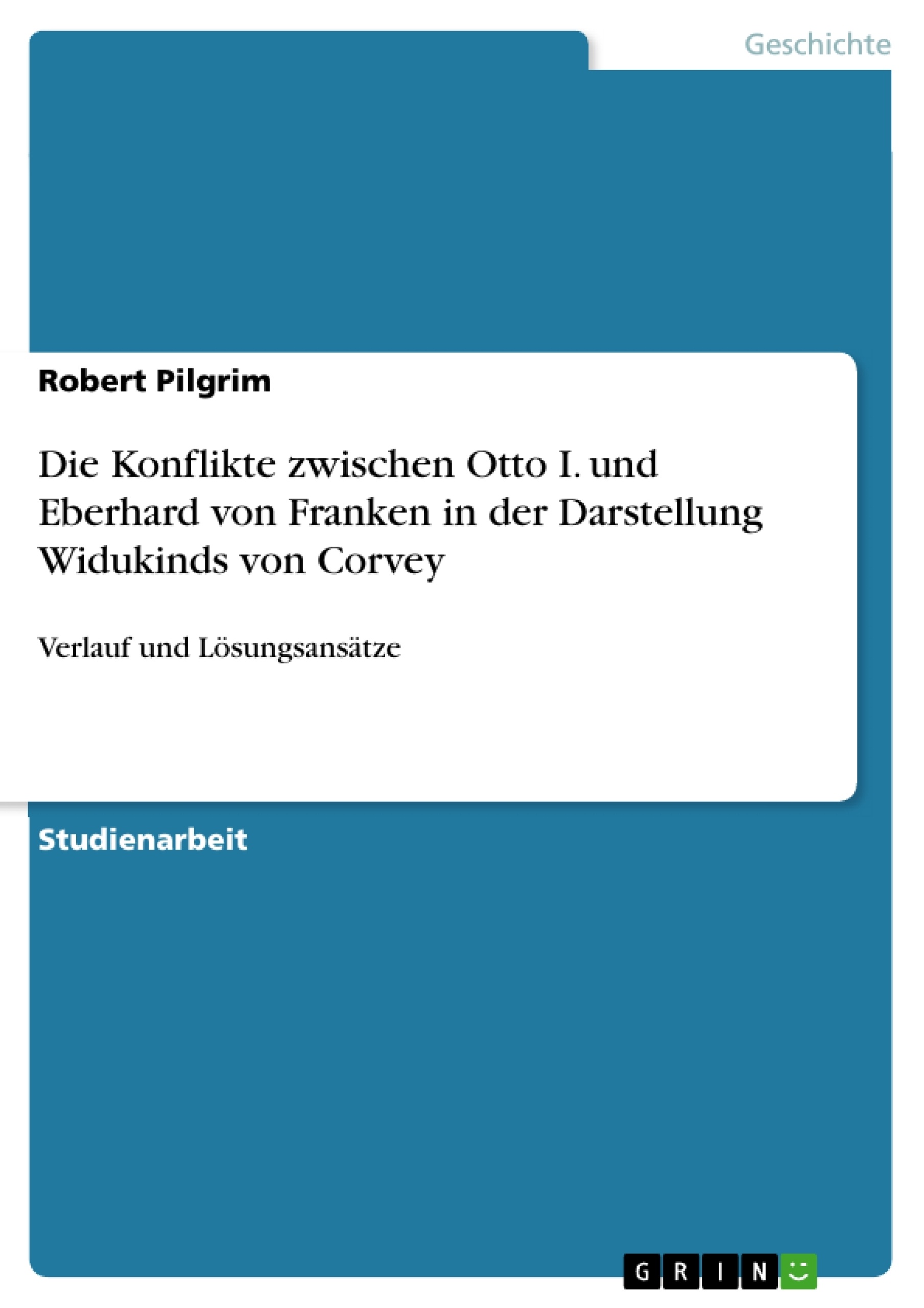In der vorliegenden Untersuchung sollen zunächst die beiden Hauptakteure der Konflikte – Otto I. und Eberhard von Franken – charakterisiert und auf ihre Absichten und Verwandtschaftsverhältnisse, sowie auf ihn eigenes konfliktträchtiges Potential hin analysiert werden. Dabei wird nur auf die für diese Untersuchung relevanten Gegebenheiten eingegangen. Ebenso soll der Historiograph Widukind von Corvey, Verfasser der Res gestae Saxonicae, in der die Konflikte zwischen den oben genannten dargestellt werden, charakterisiert und seine Intentionen herausgestellt werden.
Der nächste Abschnitt geht dann zunächst konkret auf Widukinds Darstellung des Verlaufs der Konflikte ein und untersucht dann Charakteristika von Konflikten im Frühmittelalter generell und vergleicht diese mit den Konflikten zwischen Otto und Eberhard und zeigt dabei deren Lösungsansätze auf.
Ein Fazit soll dann die Besonderheiten von Widukinds Darstellung herausstellen, sie bewerten und die Konflikte nochmals zusammenfassen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2.1 Otto I.
2.2 Eberhard von Franken
2.3 Widukind von Corvey
3. Konflikte in Widukinds Darstellung
3.2 Konflikte im Frühmittelalter
4. Fazit
5. Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen:
Literatur:
1. Einleitung
In der vorliegenden Untersuchung sollen zunächst die beiden Hauptakteure der Konflikte – Otto I. und Eberhard von Franken – charakterisiert und auf ihre Absichten und Verwandtschaftsverhältnisse, sowie auf ihn eigenes konfliktträchtiges Potential hin analysiert werden. Dabei wird nur auf die für diese Untersuchung relevanten Gegebenheiten eingegangen. Ebenso soll der Historiograph Widukind von Corvey, Verfasser der Res gestae Saxonicae, in der die Konflikte zwischen den oben genannten dargestellt werden, charakterisiert und seine Intentionen herausgestellt werden.
Der nächste Abschnitt geht dann zunächst konkret auf Widukinds Darstellung des Verlaufs der Konflikte ein und untersucht dann Charakteristika von Konflikten im Frühmittelalter generell und vergleicht diese mit den Konflikten zwischen Otto und Eberhard und zeigt dabei deren Lösungsansätze auf.
Ein Fazit soll dann die Besonderheiten von Widukinds Darstellung herausstellen, sie bewerten und die Konflikte nochmals zusammenfassen.
2.1 Otto I.
Otto wurde etwa 912 als erstes gemeinsames Kind von – zu dem Zeitpunkt noch nicht König – Heinrich I. und Mathilde, entfernte Verwandte des einstigen Sachsenführers Widukind, geboren.[1] Durch seine Vermählung mit der angelsächsischen Edgith erhielt er ferner eine herausgehobene Stellung im Vergleich zu den übrigen Mitgliedern der Königssippe.[2] 929 wurde er dann von seinem Vater zum Nachfolger für den Thron auserkoren, während sein älterer Halbbruder Thangmar und sein jüngerer und als Königssohn geborener Bruder Heinrich übergangen wurden und später versuchen sollten, ihren Anspruch auf die Krone geltend zu machen.[3]
936 starb Heinrich I. und Otto ließ sich in Aachen – um an die fränkische Tradition anzuknüpfen – von den „Großen des Reiches“[4] in fränkischer Tracht zum König wählen und vom Mainzer Erzbischof Hildebert mit den königlichen Insignien bekleiden und auf den Thron Karls des Großen setzen.[5] Beim darauffolgenden Königsmahl übernahmen die Herzöge Giselbert von Lothringen, Eberhard von Franken, Hermann von Schwaben und Arnulf von Bayern die wichtigsten Hofämter, um auf diese Weise die „Verbundenheit der Stämme mit dem neuen König zum Ausdruck“[6] zu bringen.
Wenngleich Otto also an fränkische Tradition anknüpfte und auf dem Thron des größten karolingischen Herrschers Platz nahm, so bedeutete seine herausragende Vorherrschaft im ostfränkisch-deutschen Reich einen klaren Bruch mit der „fränkisch-karolingischen Praxis der Herrschaftsteilung“[7].
So kam es immer wieder zu Spannungen zwischen dem neuen König und dem Hochadel, so dass Otto etwa die Hälfte seiner Regierungszeit mit Versuchen verbringen musste, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu klären und die von der Herrschaft ausgeschlossenen Mitglieder der Königssippe durch Verleihungen von Herzogtümern und durch Vermählungen zu besänftigen.[8]
2.2 Eberhard von Franken
Eberhard wurde ca. 885 geboren und war Sohn Konrads des Älteren und Bruder des Königs Konrad I., welchen er bei dessen Königserhebung 911 unterstützte.[9] 915 unterlag er im Kampf um die Macht in Thüringen eine schwere Niederlage gegen Herzog Heinrich von Sachsen, den Vater Ottos I.[10], woraufhin jedoch bald Frieden zwischen Heinrich und den Konradinern geschlossen wurde.[11] So verzichtete Eberhard 919 auf eigene Königsambitionen, was durch eine enge fränkisch-sächsische Kooperation (so war Eberhard ab 925 Beauftragter des Königs mit richterlichen Gewalten in Lothringen) kompensiert werden sollte.[12] 936 unterstützte er auch die Erhebung Ottos I. zum König, geriet jedoch ab 937 mit diesem in Konflikt, da Otto
die königliche Autorität und Zentralgewalt gegenüber den Herzögen – entgegen der Praxis Heinrichs I. – verstärken wollte.[13] In der Folge stellte sich Eberhard immer wieder gegen König Otto I. und verbündete sich mit oppositionellen Verwandten Ottos, um diesen zu stürzen. 939 wurde er jedoch bei einem militärischen Konflikt mit königlichen Truppen bei Andernach getötet.[14]
2.3 Widukind von Corvey
Der Mönch, Hagiograph und Historiograph Widukind von Corvey trat zwischen 941 und 942 ins Kloster Corvey ein.[15] „Während W.s sächsische Herkunft gesichtert ist […], kann seine Abstammung aus dem Geschlecht des Sachsenführers Widukind nur vermutet werden.“[16]
Kaum ein historisches Werk des Mittelalters hat soviel Aufmerksamkeit erhalten wie Widukinds Sachsengeschichte, doch auch kaum eines wird kontroverser diskutiert.[17]
So ist bis heute unklar, ob die Sachsengeschichte „phantasievoll mit Inhalten gefüllt worden ist, die wenig oder gar nichts mit der Realität zu tun haben oder ob eine wohlbedachtete Gesamtkonzeption vorliegt, die vergangene Ereignisse durch Deutung oder Umdeutung in einen Argumentationszusammenhang einbringt“.[18] Besonders die Vorreden in den Büchern der Sachsengeschichte, die der jungen Äbtissin Mathilde, Tochter Ottos I., gewidmet sind, lassen eine panegyrische Absicht Widukinds vermuten.[19] So muss man von einer sehr pro-sächsischen Einstellung Widukinds und somit von keiner objektiven und wissenschaftlich-historischen Darstellung der Ereignisse ausgehen. „So beweist er zugleich das Gottesgnadentum der Ottonen und erfüllt damit herrschaftslegitimatorische Funktionen“[20] und verschweigt beispielsweise Probleme bei Ottos Thronfolge 936 um willen der Darstellung eines „harmonischen Übergangs der Herrschaft mit der universalis electio.“[21]
[...]
[1] Angermann, Norbert (Hg.): Lexikon des Mittelalters. Lukasbilder bis Plantagenêt, Bd. VI, 2003 München, S. 1563-1566.
[2] Ebd.
[3] Ebd., 1564.
[4] Ebd.
[5] Ebd.
[6] Ebd.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Angermann, Norbert (Hg.): Lexikon des Mittelalters. Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen, Bd. III, 2002 München, S. 1512-1513.
[10] Ebd., S. 1512.
[11] Vgl. ebd.
[12] Ebd.
[13] Ebd.
[14] Ebd.
[15] Angermann, Norbert (Hg.): Lexikon des Mittelalters. Werla bis Zypresse, Bd. IX, 2003 München, S. 76-77.
[16] Wachinger, Burghart (Hg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 10, 1999 Berlin, S. 1001.
[17] Angermann, Norbert (Hg.): Lexikon des Mittelalters. Werla bis Zypresse, Bd. IX, 2003 München, S. 76-77.
[18] Ebd., S. 77.
[19] Wachinger, Burghart (Hg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 10, 1999 Berlin, S. 1004.
[20] Angermann, Norbert (Hg.): Lexikon des Mittelalters. Werla bis Zypresse, Bd. IX, 2003 München, S. 77.
[21] Ebd.
- Quote paper
- Robert Pilgrim (Author), 2009, Die Konflikte zwischen Otto I. und Eberhard von Franken in der Darstellung Widukinds von Corvey, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139211