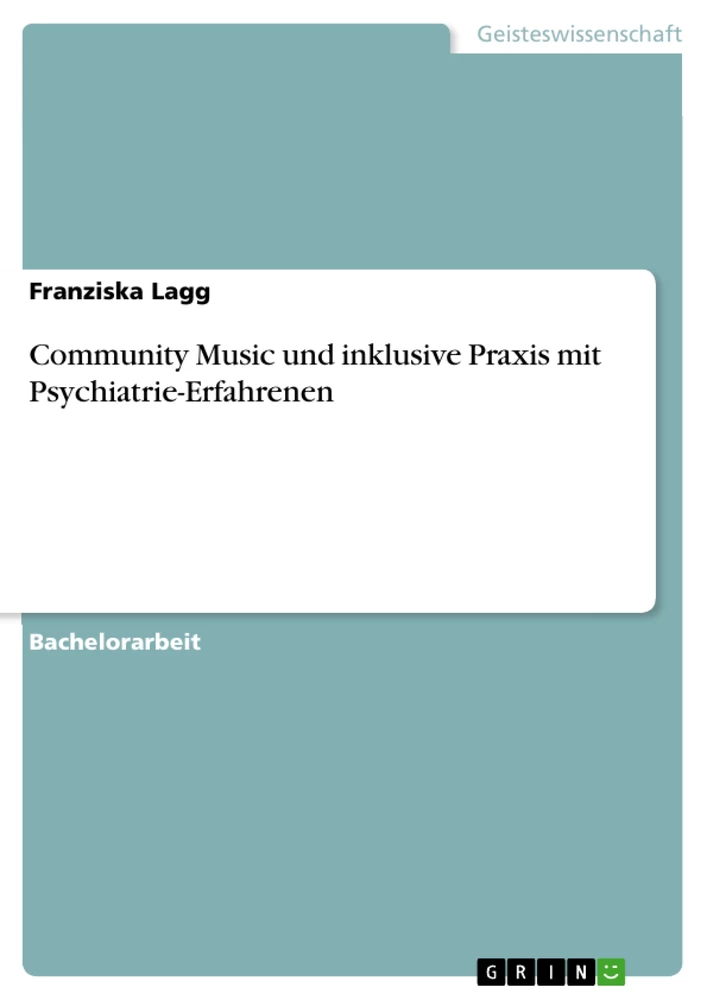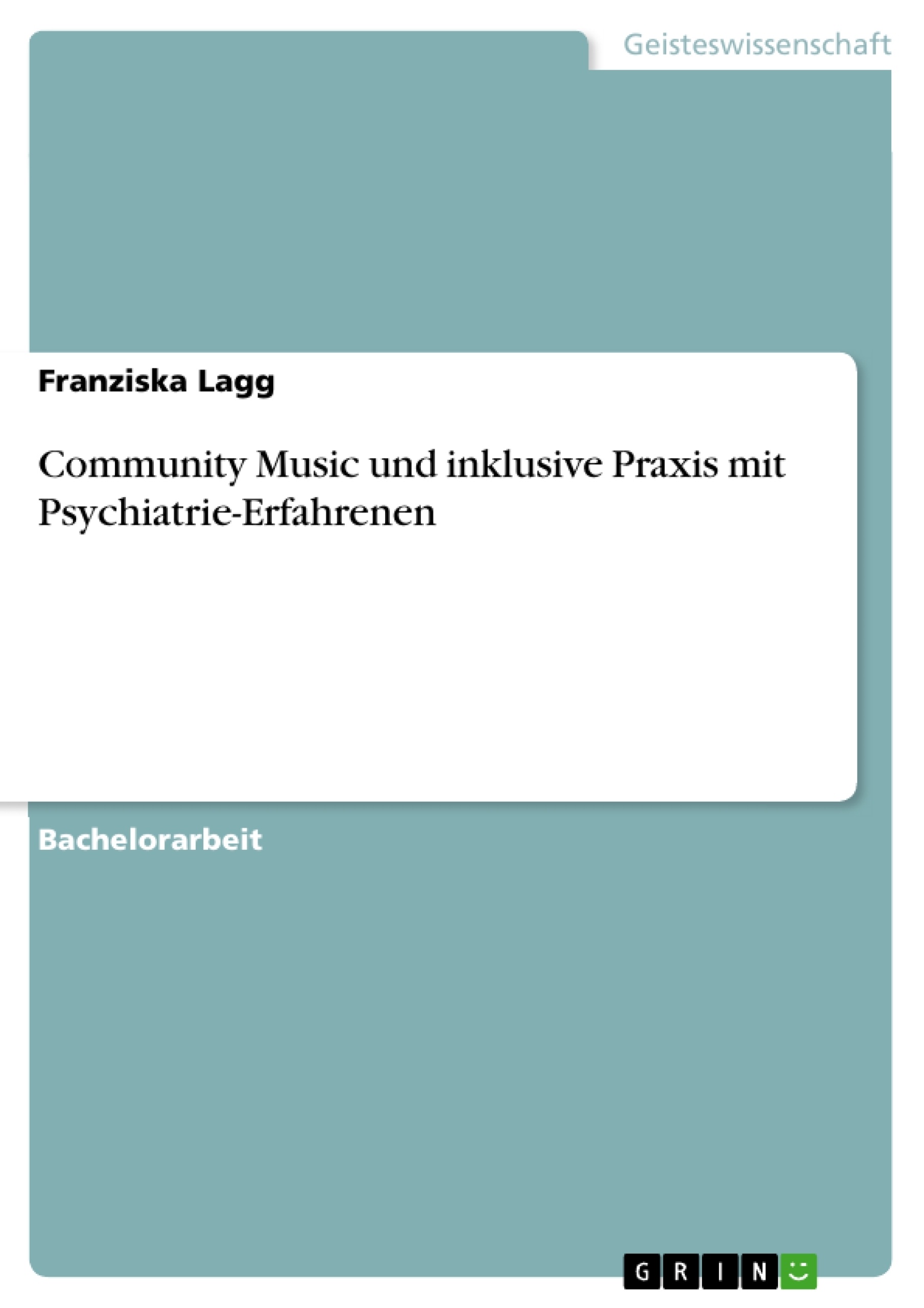In dieser Bachelorarbeit wird das Community Music Projekt „Musik in ...“ vorgestellt.
In diesem konnten Menschen, die Freude an Musik haben, in einem offenen, unbefangenen Rahmen zusammenfinden, um gemeinsam zu musizieren. Den Bewohner*innen der Wohnstätte sollte hierbei, genau wie allen anderen, die Möglichkeit zur Teilhabe gegeben werden.
Zunächst wird eine Projektbeschreibung inklusive der Darstellung der Ausgangssituation, Zielsetzung sowie Planung und Durchführung erfolgen. Über qualitative Leitfadeninterviews mit Teilnehmenden werden im Folgenden Aussagen über denen Projektwahrnehmung erarbeitet. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Auswertung dieses Projektes. Wurden die Kriterien für Community Music erfüllt und wie wurden diese wahrgenommen? Hat eine inklusive Praxis stattgefunden und wie wurde dies erlebt?
Anmerkung des Lektorats:
Die Namen der Wohnstätte und des Dorfes in welcher sie sich befindet, wurden mit “X” aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert.
1. Einleitung
Jeder Mensch hat das Recht auf Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben in der Gesellschaft sowie auf Einbindung in die Gemeinschaft (Art.19, 30 UN-BRK). Das bedeutet, dass jeder Mensch die gleichen Chancen haben sollte, kulturelle und soziale Räume in der Gesellschaft zu nutzen und gegebenenfalls die nötige Unterstützung hierfür erhalten muss. In der Realität wird vielen Menschen dieses Rechte auf Teilhabe verwehrt. Besonders Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung sind in dieser Hinsicht mit zahlreichen Barrieren konfrontiert, die ihre Teilhabemöglichkeiten stark einschränken. Im Rahmen meiner Arbeit in der Fliedners „Wohnstätte X“ für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen konnte ich die Schwierigkeiten, die hier bestehen, unmittelbar miterleben. Im Diskurs zu Inklusion werden die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oft nicht mitgedacht. Wie ist die Teilhabesituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen? Wo liegen die konkreten Barrieren, die Inklusion bei ihnen verhindern? Welche Strukturen müssten aufgebaut werden, um diese Barrieren abzubauen? Das erste Kapitel dieser Arbeit widmet sich diesen Problemfragen und stützt sich dabei hauptsächlich auf zwei aktuelle Studien zum Thema Teilhabe und Inklusion bei Menschen mit psychischen Erkrankungen von Kahl (2016) und Speck und Steinhart (2018) sowie den Beschreibungen von Ratzke, Bayer und Bunt (Hg.) (2020) zu einem inklusiven Modellprojekt.
„Community Music“ verfolgt den Ansatz, allen Menschen unabhängig von jeglichen individuellen Voraussetzungen einen Zugang sowohl zu Musik als auch zu Gemeinschaft zu verschaffen. Die hinter diesem Begriff stehenden Prinzipien, Grundgedanken und Leitideen sollen im darauffolgenden Kapitel genauer erläutert werden. Hierbei wird sich hauptsächlich auf Veröffentlichungen von Lee Higgins (2012, 2017, 2018) sowie Burkhard Hill und Alicia de Banffy-Hall (2017), zentralen Persönlichkeiten im Diskurs zu Community Music, bezogen. Das Kapitel beleuchtet mögliche Schnittmengen zwischen den Ansätzen von Community Music und den Bedingungen, die für eine inklusive Praxis mit Psychiatrie-Erfahrenen nötig sind. Wo könnten diese Schnittmengen liegen, und wie könnte das genutzt werden?
Aus diesen Gedankenbausteinen ist das Community Music Projekt „Musik in X“ entstanden, welches in dieser Arbeit vorgestellt werden soll. In diesem konnten Menschen, die Freude an Musik haben, in einem offenen unbefangenen Rahmen zusammenfinden um gemeinsam zu musizieren. Den Bewohner*innen der Wohnstätte sollte hierbei, genau wie allen anderen, die Möglichkeit zur Teilhabe gegeben werden. Zunächst wird eine Projektbeschreibung inklusive der Darstellung der Ausgangssituation, Zielsetzung sowie Planung und Durchführung erfolgen. Über qualitative Leitfadeninterviews mit Teilnehmenden werden im Folgenden Aussagen über denen Projektwahrnehmung erarbeitet. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Auswertung dieses Projektes. Wurden die Kriterien für Community Music erfüllt und wie wurden diese wahrgenommen? Hat eine inklusive Praxis stattgefunden und wie wurde dies erlebt?
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Erfahrungen aus der Praxis des Projektes so aufzuarbeiten, dass Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können, die eine Weiterentwicklung dieser Ansätze ermöglichen. Was kann man daraus für Erkenntnisse ziehen? Welche Möglichkeiten ergeben sich eventuell daraus für den Bereich der Sozialpsychiatrie und der Inklusion allgemein? Was kann man aus diesem Projekt für mögliche Zukunftsprojekte lernen? Welche Chancen bietet Community Music für eine inklusive Praxis mit Psychiatrie-Erfahrenen?
2. Inklusion und psychische Erkrankung
a. Teilhabesituation und Barrieren mit Fokus auf kultureller Teilhabe
Wer mit einer psychischen Beeinträchtigung lebt, begegnet im Alltag zahlreichen Herausforderungen und Barrieren, die eine erfüllende Lebensführung erschweren. Diese betreffen unterschiedliche Lebensbereiche, die sich immer auch gegenseitig bedingen. In dieser Arbeit soll der Fokus in Bezug zum Projekt auf dem Bereich der kulturellen Teilhabe liegen. Es gibt bis jetzt wenig empirische Studien, die diese Barrieren tatsächlich messbar machen (vgl. Speck 2018, S.40). Die Untersuchungen, die es gibt, zeigen jedoch deutlich auf, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen insgesamt ein hohes Exklusionsrisiko trifft, und bestätigen damit den subjektiven Eindruck, den ich persönlich im Rahmen meiner Praxisstelle bekommen habe. Zwei relativ aktuelle Studien finden sich bei Kahl (2016) und Speck/Steinhart (2018), die sowohl mit qualitativen wie auch quantitativen Forschungsmethoden gearbeitet haben.
So können zum Beispiel 45,6% der Befragten Freizeitangebote der Stadt nicht oder eher nicht so nutzen, wie sie es sich wünschen, und 60,1% würden gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als sie es bisher tun. (vgl. Kahl 2016, S.197,207). Fast die Hälfte ist nie künstlerisch oder musisch tätig, geht nie ins Kino, zu Pop-Konzerten oder zum Tanzen, ca. ein Drittel unternimmt nie Ausflüge oder kurze Reisen und 60% gehen nie zu Veranstaltungen wie klassischen Konzerten, ins Theater oder Ausstellungen (vgl. Speck, Steinhart 2018, S.80). Die spezifischen Barrieren sind jedoch nicht so einfach zu definieren, wie sie es bei körperlichen Einschränkungen meist sind. Es kann nicht generalisiert werden, für welche psychiatrische Diagnose welche bestimmten Settings eine Barriere darstellen, denn diese sind stark individuell geprägt. Insgesamt könnte die Vielfalt an Menschen, die unter dem Begriff der Menschen mit psychischen Erkrankungen zusammenfallen, nicht heterogener sein, dahinter stehen Menschen mit individuellen Stärken wie auch Bedürfnissen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Dennoch lassen sich allgemeine Faktoren benennen, die die Teilhabe von Menschen mit seelischer Behinderung deutlich erschweren.
Als einen zentralen Faktor kann man die ausgeprägte Leistungsorientierung unserer Gesellschaft betrachten, durch die die Möglichkeiten der Teilhabe für all diejenigen stark eingeschränkt sind, die der geforderten Flexibilität und Leistung nicht nachkommen können (vgl. Kahl 2016, S.38). Betroffene können bestimmten Wertvorstellungen häufig nicht entsprechen und ziehen sich aus Lebensbereichen zurück, in denen sie den Erwartungen nicht gerecht werden können (vgl. ebd. S.39ff). „[Es] fehlen im Kontext der individualisierten Gesellschaft vielen erkrankten Menschen institutionelle Rahmen, die Leistungseinschränkungen tolerieren und unterstützend zur Verfügung stehen. So erfahren Betroffene immer wieder Ablehnung und scheitern an den hohen Erwartungen, die an ihre Leistungsfähigkeit gestellt werden, was einer Genesung im Wege steht“ (Kahl 2016, S.42). Die Diskrepanz von gesellschaftlichen Normen und der eigenen Lebenssituation führt häufig zu Minderwertigkeitsgefühlen und einem „massiv angeschlagenen Selbstbewusstsein“ (Ratzke et al. 2020, S.33). Schwierigkeiten werden oft als Zeichen individuellen Versagens gewertet, die Befragten verorten das Problem meist bei sich selbst (vgl. Kahl 2016, S.238f). Zusätzlich zu dem oft mangelnden Zugehörigkeitsgefühl entsteht bei psychischen Beeinträchtigungen ein Legitimationsdruck, warum man in etwa nicht arbeiten kann, da dies für Unbeteiligte oft nicht offensichtlich bzw. verständlich ist.
Dies ist unter anderem so, da das Thema seelische Gesundheit immer noch zu wenig Beachtung in der Gesellschaft bekommt, und viele Vorurteile gegenüber psychisch Kranken bestehen. Stigmatisierung ist eine der größten Barrieren für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. „Denn im Genesungsprozess muss nicht allein die eigentliche Erkrankung bewältigt werden, sondern auch die Effekte der Stigmatisierung: Stigma zerstört jene individuellen und sozialen Ressourcen, die zur nachhaltigen Bewältigung psychiatrischer Symptome unabdingbar sind. […] Insofern sind gerade bei Menschen mit chronischer Beeinträchtigung der Verlust der Arbeitsperspektive, die soziale Isolierung und die Selbstzweifel weniger auf die Symptome einer Depression oder einer Schizophrenie zurückzuführen als vielmehr auf die expliziten – aber auch impliziten! – Stigmatisierungsprozesse“ (Speck et al. 2018, S. 103). Mehr als die Hälfte der Betroffenen hat prägende Stigma-Erfahrungen in Bezug auf ihre Erkrankung machen müssen oder erwartet weitere (vgl. ebd. S.105). Als Folge werden negative Stereotypen internalisiert und führen zu Selbststigmatisierung, Selbstzweifel und sozialen Ängsten (vgl. Ratzke et al. 2020, S.17f; Kahl 2016, S.167). Befragte äußern die Sorge, dass psychische Probleme vom Umfeld bemerkt werden oder dass sie in der Öffentlichkeit auffallen oder ausgelacht werden und fühlen sich nicht „normal“ oder „außen vor“ bei sozialen Zusammentreffen (vgl. Kahl 2016, S.159,161,173).
Aufgrund dieser Stigmatisierung und Selbststigmatisierung erfolgt häufig der Rückzug aus sozialen Kontexten außerhalb (sozial-)psychiatrischer Hilfsangebote (vgl. Ratzke et al. 2020, S.35f). Diese bieten Schutzräume, die in „normalen“ gesellschaftlichen Kontexten nicht gegeben sind. Solche Schonräume sind als solche wichtig und stabilisierend. Häufig leben Betroffene, besonders mit chronischen Beeinträchtigungen, fast ausschließlich in Sonderwelten des (sozial-)psychiatrischen Hilfesystems, wodurch Ausgeschlossenheit und Abhängigkeiten verfestigt werden können (vgl. ebd. S.19,32). Der ausschließliche Kontakt zu anderen Erkrankten wird als nicht förderlich bzw. gewünscht beschrieben, und doch ist dies bei vielen Realität. (vgl. Kahl 2016, S.161).
Menschen mit schweren, chronischen psychischen Beeinträchtigungen befinden sich meist in prekären Lebensverhältnissen, leben häufiger in Armut und prekären Wohnsituationen, und sind finanziell beispielsweise auf die Grundsicherung angewiesen. Diese ermöglicht in der Regel nicht, regelmäßig an kulturellen Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerten teilzunehmen, ins Restaurant zu gehen, oder Ausflüge und Urlaubsreisen zu machen (vgl. Ratzke et al. 2020, S.18). Fehlende finanzielle Mittel sind eine große Barriere zur Teilhabe. 58,5% der befragten Betroffenen äußern, nicht oder eher nicht über genug Geld zu verfügen, um ihren privaten Interessen nachzugehen (vgl. Kahl 2016, S.198).
Die Teilnahme an solchen kulturellen Aktivitäten ist nicht nur direkt für die Lebensqualität entscheidend, sondern steht auch in einem engen Zusammenhang zu der Gestaltung sozialer Kontakte. Einerseits fällt es leichter, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, wenn man gemeinsam derartigen Aktivitäten nachgehen kann, andererseits fällt es auch leichter, etwa zu Veranstaltungen zu gehen, wenn man es nicht allein tun muss (vgl. Kahl 2016, S.225f). Fehlende soziale Kontakte werden auch als Grund genannt, nicht an Aktivitäten im Sozialraum teilzunehmen (vgl. Kahl 2016, S.176). Dies wird noch bedeutungsträchtiger dadurch, dass 28,5% der Befragten äußern, Freizeitaktivitäten nicht oder eher nicht ohne Unterstützung nachgehen zu können (vgl. ebd. S.196).
Insgesamt ist es für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen schwieriger, soziale Beziehungen aufzubauen und zu halten. Viele berichten von Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme und dem Aufbau engerer Beziehungen sowie Einsamkeit (vgl. Kahl 2016, S.160). 50,9% fällt es schwer und eher schwer, Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen und 61,6% wünschten sich mehr soziale Kontakte (ebd. S.204). So sind nur knapp ein Viertel der Befragten aus der Eingliederungshilfe in fester Partnerschaft, während es in der Allgemeinbevölkerung ca. 80% sind (Speck et al. 2018, S.56). 18,5% unternehmen nie gegenseitige Besuche mit Freunden oder Bekannten, 20,7% nie Besuche bei oder von der Familie oder Verwandtschaft. In der Allgemeinbevölkerung sind es nur 2,5 bzw. 2,4%, die dies nie tun (ebd. S.62).
Natürlich stellen auch die mit der psychischen Krankheit einhergehenden Symptome für den Einzelnen eine Belastung und Barriere da, wie beispielsweise geringe Belastbarkeit, geringer Antrieb, fehlende Energie und Motivation, Reizüberflutung, Überlastung oder Konzentrationsschwierigkeiten (vgl. Kahl 2016, S.174). Diese können zwar nicht einfach durch fördernde, offene Rahmenbedingungen beseitigt, jedoch durchaus berücksichtigt und somit das dadurch verursachte Leid beim einzelnen verringert werden. So kann, indem es zum Beispiel akzeptiert wird, wenn jemand mitten in einer Aktion den Raum verlässt oder auch etwas dazwischen ruft, zwar nicht die innere Unruhe beseitigt werden, die eventuell hinter diesem Verhalten liegt, jedoch das Leid verhindert werden, welches entsteht, wenn das eigene Verhalten auf Missbilligung trifft.
Betont werden soll an dieser Stelle, dass Inklusion natürlich nicht heißen soll, dass jeder mitmachen muss.Nicht alle haben das Bedürfnis, stärker teilzuhaben, und viele sind mit ihrer Teilhabesituation zufrieden (vgl. ebd. S.178). Für viele bestehen jedoch so viele Barrieren, dass sie eben nicht in dem von ihnen gewünschten Maße am sozialen und kulturellen Leben teilhaben können. Es gibt „keine ausreichenden Unterstützungsnetzwerke bzw. gesellschaftliche Strukturen, die es auch schwer psychisch erkrankten Menschen erlauben, ihre Freizeit so zu gestalten, dass sie sich mit ihren psychischen Beeinträchtigungen als gleichberechtigt erleben können“ (ebd. S.209). Auch die vorhandenen gemeindepsychiatrischen Angebote bleiben in der Regel exklusiv für Menschen aus Psychiatrie-Kontexten (vgl. DGSP 2017, S.31f). Die Untersuchungen zeigen große Defizite im Angebot des Hilfesystems und des öffentlichen Lebens, Freizeit und soziale Beziehungen auch für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zugänglich machen.
b. Was ist nötig für eine inklusive Praxis mit Psychiatrie-Erfahrenen?
Welche Aufgabenstellung ergibt sich aus den dargestellten Umständen für die Sozialpsychiatrie bzw. eine Gesellschaft, die sich Inklusion als Ziel gesetzt hat? Welche Strukturen und Angebote wären nötig, um Inklusion zu fördern? Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, an die angeknüpft werden kann, um eine umfassende Teilhabe zu ermöglichen. Zum Beispiel ist eine verstärkt personenzentrierte, flexible Unterstützung und Begleitung notwendig, die auf einer individuellen Ebene die Teilnahme an Aktivitäten im Sozialraum erleichtert und es müssen verstärkt inklusive, offene Räume in der Gesellschaft geschaffen werden.
So müsste sich die gesamte Hilfeplanung auf individueller Ebene mehr auf die Möglichkeiten im Sozialraum fokussieren und Betroffene zur Teilnahme an solchen ermutigt, befähigt und unterstützt werden (vgl. DGSP 2017, S.32). Die materielle und finanzielle Sicherheit der Betroffenen muss als Grundlage für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sichergestellt werden und gegen die meist prekären Lebensumstände dieser Personengruppe angekämpft werden (vgl. Kellmann 2019, S.4f). Selbsthilfefähigkeiten müssen durch ressourcenorientierte Ansätze wie Recovery oder Empowerment gestärkt werden (vgl. Dollerschell, Ortolf 2018, S.43). Hilfen zur Teilhabe müssen bedürfnisorientiert erfolgen und Aktivitäten beispielsweise begleitet werden können. Dieser Bedarf zeigt sich deutlich an dem zuvor dargelegten Ergebnis, dass knapp ein Drittel der Betroffenen Unterstützung benötigen, um Freizeitaktivitäten nachgehen zu können.
Ein weiterer Ansatz, der für das hier vorgestellte Projekt eine große Bedeutung hatte, ist der, Schutzräume in,nicht außerhalb der Gesellschaft zu schaffen. Das heißt, dass Angebote und Veranstaltungen im Gemeinwesen gestaltet werden müssten, in denen ungewöhnliches Verhalten generell kein Ausschlusskriterium ist und der Umgang miteinander von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt ist (vgl. Kahl 2016, S.170). Teilhabe als Schlüsselkonzept würde bedeuten, „nicht die Anpassung der Nutzerinnen und Nutzer sozialpsychiatrischer Leistungen an Normalitätsvorstellungen, sondern die Schaffung einer – vor allem auch sozialräumlich vermittelten – Gelegenheitsstruktur zu Umsetzung ihrer individuellen Freiheiten [anzustreben]“ (Speck 2018, S.31). Es muss an Rahmenbedingungen gearbeitet werden, die eine möglichst offene Definition davon erlauben, was als „normal“ gilt, und was nicht. Eine Etikettierung dieser Art muss unbedingt verhindert werden. Eine der wichtigsten Grundlagen hierfür ist wahrscheinlich, dass die Teilnahme möglichst nicht an bestimmte Leistungserwartungen geknüpft ist, sodass Gefühle der Unzulänglichkeit und des Versagens verhindert werden können. Leistungsorientierte Wertvorstellungen müssten gegen eine allumfassende Wertschätzung von Vielfalt ausgetauscht werden. Eine Atmosphäre muss geschaffen werden, in der die Stärken jedes Individuums erkannt werden und jede*r soziale Anerkennung erfahren kann. Im Kleinen können so „Wir-Räume“ geschaffen werden, in denen Begegnungen möglich werden (vgl. Meins, Röh 2020, S.24). Um die zuvor beschriebenen Barrieren möglichst verringern zu können, ist es außerdem unumgänglich, stärker mit partizipativen Ansätzen bei der Planung und Durchführung von Angeboten zu arbeiten. Psychiatrie-Erfahrene und Genesungsbegleiter haben wohl den besten Blick dafür, Hindernisse zu erkennen und können auf diese aufmerksam machen (vgl. Kahl 2016, S.101). Dabei gewinnt die nähere soziale und räumliche Umgebung an Bedeutung, da weite Wege zu Veranstaltungen oder sozialen Kontakten oft eine Barriere darstellen. Gemeindepsychiatrische Angebote müssen ständig sozialraumorientiert weiterentwickelt werden und Fortbildungen für Mitarbeitende sowie die Finanzierung hierfür sichergestellt sein (vgl. DGSP S.31). Solche Angebote müssen auch für Außenstehende tatsächlich interessant sein, um nicht letztendlich doch nur die eigene Zielgruppe zu erreichen. Die umfangreiche Vernetzung lokaler Akteure und Angebote im Gemeinwesen müssen angestrebt und offene, gemeinsame Projekte realisiert werden. „Durch weitreichende Sozialraumaktivitäten sollen Sondermilieus aufgelöst oder zumindest so vernetzt werden, dass hier Inklusion stattfinden kann.” (Dollerschell, Ortolf 2018, S.51) Dieser Wunsch wird auch von Betroffenen geäußert und als hilfreich und sinnvoll erachtet (vgl. Kahl 2016, S.89, S.111, S.177). „Um […] Einbeziehung zu fördern, haben helfende Einrichtungen die Aufgabe, wiederholt Begegnungen im Gemeinwesen anzustreben. Im Rahmen von Aktionen und Veranstaltungen im Gemeinwesen – und damit auch außerhalb sozialpsychiatrischer Einrichtungen – muss es für Betroffene möglich werden, auch zu solchen Menschen in Kontakt zu treten, die nicht aus Psychiatrie-Kontexten stammen“ (Kahl 2016, S.234). Das Schaffen derartiger Begegnungen birgt auch ein hohes Potenzial, gegen Stigmatisierung anzukämpfen und Vorurteile abzubauen. Langfristig gesehen ist ein Vorgehen gegen bestehende Stigmata eine zentrale Voraussetzung für gelebte Inklusion (vgl. Dollerschell, Ortolf 2018, S.43). Ansätze, die mit konkreten Begegnungen arbeiten, haben sich in diesem Kontext stärker bewährt als beispielsweise massenmediale Kampagnen (vgl. Speck 2018, S.154f). Das Thema seelische Gesundheit muss insgesamt stärker in die allgemeine Stadtentwicklung integriert werden und Hilfsangebote aus der „Psychiatrie-Nische“ herauskommen und als Chance für eine breite Verbesserung der Lebensqualität einer Gemeinde verstanden werden (vgl. ebd.).
3. Community Music
a. Was ist Community Music?
Jedem Menschen soll ein komplett barrierefreier Zugang zu Musik, zur kulturellen Teilhabe in der Gesellschaft und Gemeinschaft ermöglicht werden – niemand soll mehr von Musik wie auch von Gemeinschaft ausgeschlossen sein. Dieser Wille steht hinter dem Begriff „Community Music“, welcher im Zuge der Gegenkultur der 60er Jahre in Großbritannien entstand. Ziel war und ist es, sämtliche hierarchische Muster in der Gesellschaft und somit auch in der Kunst- und Musikszene abzubauen (vgl. Higgins 2012, S.24). Community Music ist mehr als ein Ansatz oder ein Konzept, es beschreibt viel eher eine bestimmte Grundeinstellung zur Musik und zum Menschen an sich. So ist es weniger entscheidend, wasgetan wird, als wiees getan wird. Die konkreten Praxen, die unter den Begriff fallen, können äußerst vielfältig sein und beispielsweise vom kulturellen Wiederaufbau in Nachkriegsregionen bis hin zum Musizieren in Gefängnissen sämtliche Handlungsfelder umfassen (vgl. Bartleet, Higgins 2018, S. 43, 153). Das erschwert eine genaue Definition des Begriffes und die Grenzen zu anderen Bereichen sind fließend (vgl. Banffy-Hall 2017, S.27ff). Vielmehr sind es verschiedene Prinzipien und Grundsätze, durch die sich Community Music definiert. Diese sollen im Folgenden erläutert werden um einen Einblick in das Feld der Community Music-Praxis zu bieten.
Grundlage für jedes Handeln stellt die Intention dar, allen Menschen, unabhängig jeglicher individueller Voraussetzungen oder Vorerfahrung einen aktiven Zugang zu Musik zu ermöglichen. So sollen Angebote nicht nur die „Begabten“ und finanziell gut Aufgestellten erreichen, sondern gerade auch die, die in konventionellen Strukturen ausgeschlossen werden. So darf die Teilnahme zum Beispiel nicht an bestimmte, erwartete Fähigkeiten gebunden sein (vgl. Hill 2017, S.14). Die dahinter liegende Reflexion von Machtgefügen in der Kulturwelt war sehr bedeutsam bei der Entstehung von Community Music. Wer hat welchen Zugang zu Musik, wer entscheidet, was gute Musik bedeutet, und was nicht? Jegliche Hierarchien sollen überwunden werden und lang tradierte Denkmuster abgelöst werden (vgl. Bartleet, Higgins 2018, S. 3). Das Prinzip von „Professionellen“ und „Laien“, „Lehrern“ und „Lernenden“ oder „hoher“ und „niederer“ Kunst soll genauso abgeschafft werden wie die Vorstellung, dass es Menschen mit mehr oder weniger Talent oder Begabung gäbe. Stattdessen ist das Ziel, eine „kulturelle Demokratie“ zu etablieren (vgl. Higgins 2012, S.32ff). Jede*r soll sich mit der eigenen Individualität einbringen und diese frei ausleben können. Zentral ist der inklusive Gedanke, dass Vielfalt anerkannt und wertgeschätzt werden soll, statt einen Grund für Ausschluss darzustellen.
Ein zentrales Prinzip ist die Partizipation. Das Geschehen soll auf gemeinsamer Aushandlung basieren und umfassende Beteiligung möglich sein (vgl. Higgins 2017, S.47f). Wer zuvor eventuell Leiter/Musikpädagoge/Initiator etc. war, muss zum sogenannten „Facilitator“ werden. Dieser hat die Rolle, (musikalische) Dialoge anzuregen, die Begegnung mit Neuem und ein Lernen durch Kooperation zu ermöglichen. Seine Funktion ist, wie die Übersetzung des Begriffs „Facilitation“ andeutet, eine erleichternde, unterstützende Funktion. Er muss dafür sorgen, dass eingebrachte Ideen oder Elemente schnell aufgegriffen und umgesetzt werden und alles in einem Fluss, im „Flow“ bleibt (vgl. ebd. S.51ff). Dabei müssen sowohl die gesamte Gruppendynamik in Auge behalten und gefördert, wie auch Bedürfnisse Einzelner erkannt und erfüllt werden. Insgesamt ist dabei der Prozess stets wichtiger als das Produkt, beim Musikalischen wie auch beim Sozialen. Das heißt, dass der Fokus stärker auf der Entwicklung, sowohl der Gruppe als auch der Individuen liegt, als auf dem Ergebnis, was am Ende dabei herauskommt (vgl. Higgins 2012, S.30).
Die Gemeinschaft spielt eine große Rolle und soziale Aspekte sind mindestens genauso wichtig wie die musikalischen. Dies gilt sowohl auf gemeinschaftlicher wie auch auf individueller Ebene (vgl. Higgins 2017, S.52). Hinter Community Music steckt die Überzeugung eines untrennbaren Zusammenhangs von Identität, Gemeinschaft und Musik. So wird auch dem gemeinschaftsbildenden Aspekt von Musik eine große Bedeutung beigemessen. Jede*r soll sich in jeglicher Hinsicht bedingungslos willkommen und akzeptiert fühlen. Lee Higgins, Leiter des International Centre of Community Music der St. John University in York verwendet hierfür den Begriff der „Gastfreundschaft“ (Higgins 2017, S.53ff). „Community“ kann dabei sowohl im Sinne von Gemeinschaft auf der Ebene einer bestimmten Gruppe oder Gemeinde als auch auf Ebene der Allgemeinheit oder Gesellschaft betrachtet werden. So orientieren sich Community Music Projekte in der Regel am Sozialraum und versuchen, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Gleichzeitig sollen soziokulturelle Veränderungen realisiert werden, indem in einem kleinen Rahmen das umgesetzt wird, was auch gesamtgesellschaftlich angestrebt wird.
b. Community Music als Weg zu einer inklusiven Praxis mit Psychiatrie-Erfahrenen
Betrachtet man den theoretischen Hintergrund zur Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen und die Prinzipien von Community Music, lassen sich deutliche Schnittmengen erkennen. Zentral ist jeweils der Gedanke der Inklusion, dass nicht das Individuum sich den äußeren Umständen anpassen soll, sondern Bedingungen geschaffen werden, durch die niemand mit seiner Individualität ausgeschlossen wird. Die Grundsätze von Community Music zeigen ein Potenzial, Schutzräume inder Gesellschaft zu schaffen, die zuvor als nötig beschrieben wurden. Inklusion ist ein zentraler Fokus von Community Music – eine inklusive Praxis zu ermöglichen ist wesentliches Ziel von Community Music, und wo Community Music stattfindet, muss ein inklusiver Rahmen gegeben sein. Nur dann ist eine grundlegende Bedingung erfüllt, sodass der Begriff Community Music überhaupt verwendet werden kann.
Die vielleicht signifikanteste Rolle nimmt wahrscheinlich der Versuch ein, nicht-leistungsorientierte Räume zu schaffen. Die extreme Leistungsorientierung in der Gesellschaft gilt als große Barriere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Auch bei Veranstaltungen, die keine aktive Beteiligung erwarten, bestehen meist inoffizielle, aber doch bestimmte Verhaltensregeln, welche zu erkennen und einzuhalten für manche Menschen schwierig zu leisten ist. Genau dies soll bei Community Music Projekten nicht vorliegen. Dadurch, dass keine Erwartungen an die Teilnehmenden gestellt werden, soll bei niemandem Druck oder Angst entstehen, Erwartungen nicht entsprechen zu können. Jede*r soll sich auf eigene Art und Weise einbringen können. Es wird wenig vorgegeben, was „normal“ ist, und was nicht, sodass eine möglichst offene Vorstellung davon etabliert werden kann. Community Music Projekte sollen im Miteinander mit den Teilnehmenden entwickelt werden, und das Geschehen partizipativ in Aushandlung miteinander bestimmt werden. So soll die Form durch die Teilnehmenden bestimmt werden, und nicht die Teilnehmenden sich einer Form anpassen. In diesem Ansatz steckt großes Potenzial für eine inklusive Praxis, da Psychiatrie-Erfahrene so die Chance bekommen, ihre persönlichen Bedürfnisse einzubringen.
Das soziale Miteinander nimmt eine zentrale Rolle bei Community Music ein. Der Facilitator muss dabei immer sowohl die gesamte Gruppendynamik als auch das Befinden einzelner im Blick behalten und gegebenenfalls intervenieren, um diese zu verbessern. Auch die Menschen, die eventuell Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme haben, wie viele Menschen mit psychischen Erkrankungen es beschreiben, sollen also nicht auf sich allein gestellt bleiben, alle sollen im Auge behalten werden. So soll im Idealfall eine Gemeinschaft entstehen können, die niemanden ausschließt, in der alle eingebunden sind und somit Gemeinschaft erfahren können.
Menschen treffen sich unter anderem aufgrund eines gemeinsamen Interesses, der Musik. So hat man idealerweise direkt etwas gemeinsam und kann sich als Mensch begegnen, eine eventuell vorhandene psychische Erkrankung rückt an zweite Stelle, oder spielt idealerweise gar keine Rolle mehr. So können Begegnungen möglich werden, die möglicherweise auch Einfluss auf das generelle Denken über Menschen mit psychischen Erkrankungen haben. Über Community Music Projekte könnten so jene Begegnungen möglich werden, die oben für den Abbau von Stigmata als so essenziell beschrieben wurden.
Erwähnt werden soll an dieser Stelle auch der Ansatz von „Community Music Therapy“. Dieser geht davon aus, dass sowohl das Erleben von Gemeinschaft als auch die Musik heilende Effekte haben, die miteinander verbunden werden können. Es wird also versucht, Musiktherapie und Community Music zu vereinen (vgl. Simon 2013, S.1f). Natürlich hatte das in dieser Arbeit vorgestellte Projekt aufgrund fehlender Beteiligung entsprechender Fachkräfte keinen therapeutischen Anspruch. Es ist dennoch sinnvoll, die zugrunde liegende Idee im Hinterkopf zu behalten, da sie relevante Gedanken zur Bedeutung von Teilhabe an Gemeinschaft und Gesellschaft für die seelische Gesundheit enthält. In einer Gemeinschaft so anerkannt zu werden, wie man ist, ist enorm wichtig für das psychische Wohlbefinden, doch gerade von der Norm abweichenden bleibt dies häufig verwehrt. Fehlende soziale Anerkennung kann wortwörtlich krank machen (vgl. Shiloh, Blythe Lagasse 2014, S.116). Das heißt, dass Teilhabe nicht nur der Teilhabe wegen realisiert werden müsste, sondern auch aufgrund der damit verbundenen positiven Einflüsse auf die Gesundheit. Es gibt hier beeindruckende Projekte, auch im Bereich der Neurodiversität, z.B. mit Menschen mit Trisomie 21 (Stige 2014) oder Menschen im Autismus-Spektrum (Shiloh, Blythe Lagasse 2014). Ich konnte bei meiner Recherche jedoch keine Projekte finden, die in diesem Sinne speziell mit Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung arbeiteten.
4. Projektbeschreibung
a. Ausgangssituation in X
Voranzustellen ist, dass eine tatsächliche Sozialraumanalyse in X ein sehr interessantes eigenes Forschungsthema wäre. Dieser Abschnitt soll dies also in keiner Weise ersetzen. Die folgende Beschreibung der Ausgangssituation stellt allein meine individuelle Wahrnehmung dar, und hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Beobachtungen und Eindrücke haben mich mit dazu veranlasst, das Projekt ins Leben zu rufen.
X ist ein Ortsteil von Brandenburg an der Havel mit ca. 1200 Einwohnern. Es gibt einen Dorfladen, der auch eine Art Treffpunkt darstellt, eine freiwillige Feuerwehr, eine Brauerei, einen Fußballverein, eine kleine Kirchengemeinde, einen Kindergarten sowie eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Regelmäßig werden Dorffeste und Aktionen organisiert, zum Beispiel zu Weihnachten oder ein gemeinsames Boßeln. Viele Xer*innen kennen sich untereinander. Durch eine relativ gute Verkehrsanbindung ist die Stadt Brandenburg zu erreichen, unter der Woche fährt zweimal stündlich ein Bus, am Wochenende und abends seltener.
Auch gibt es in X die Wohnstätte X. Die Einrichtung bietet Platz für 39 Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen. Das heißt, dass die meisten Bewohner*innen dort aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung eine Behinderung, teilweise Schwerstbehinderung haben. Die zugrundeliegenden Diagnosen sind stark unterschiedlich, und auch Klient*innen mit Doppeldiagnosen, also einer zusätzlichen Suchterkrankung, können aufgenommen werden, jedoch nur, wenn diese gerade nicht akut ist. Viele Bewohner*innen haben schon eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich und teilweise viele und lange Klinikaufenthalte. Auch wenn regelmäßig eine Visite über einen Psychologen erfolgt, handelt es sich bei der Wohnstätte um keine therapeutische Einrichtung. Ziel ist also nicht, die Krankheiten zu „heilen“, sondern den Umgang und das Leben mit ihnen (wieder) zu erlernen. Obwohl auch einige Leute aus X in dieser Wohnstätte arbeiten, bildet diese eher eine Lebenswelt für sich ab und die Bewohner*innen sind nicht wirklich in das Dorfleben integriert. Viele der Dorfbewohner*innen sind der Wohnstätte und ihren Bewohner*innen sehr kritisch gegenüber eingestellt und Feste werden getrennt voneinander gefeiert. Durch meine dreijährige Anstellung im Rahmen meines Studiums kannte ich die Bewohner*innen schon relativ gut, und diese auch mich. Über meine musikpädagogischen Angebote wusste ich, bei welchen Bewohner*innen welche besonderen musikalischen Interessen und Ressourcen vorliegen, und dass generell bei vielen eine große Begeisterung für Musik vorhanden war. Und doch waren diese Ressourcen bei noch keinem oder keiner der Bewohner*innen in einen sozialen Kontext außerhalb der Wohnstätte integriert. Insgesamt lassen sich die im Theorieteil beschriebenen Schwierigkeiten bei der Teilhabe bei den meisten Bewohner*innen wiedererkennen. Sie scheinen sogar noch verstärkt dadurch, dass sie sich durch die genannten Voraussetzungen, also der Unterkunft in einer Wohnstätte, des schweren, chronischen Verlaufs der Erkrankung und teilweise Hospitalisierungserfahrungen in einer besonders prekären Lebenssituation befinden. Viele befinden sich schon seit vielen Jahren im Hilfesystem und haben kaum Kontakte außerhalb von diesem. Eine Tatsache, die oft bedauert wird, sie zu ändern jedoch von vielen, sowohl den Betroffenen selbst als auch dem Personal nicht für realistisch gehalten wird. Auch die beschriebenen Ängste und Sorgen beim Begeben in soziale Kontexte lässt sich bei vielen wiederfinden, sowie die finanzielle Situation, die bei den meisten nicht viel Spielraum für Aktivitäten lässt.
b. Idee des Projektes
Bei einem Hochschul-Seminar zum Thema „Community Music“ kam mir die Idee, dass X genau der richtige Ort für ein Community Music Projekt sein könnte. Schon länger beschäftigten mich die beobachteten Barrieren zur kulturellen und sozialen Teilhabe und wie man deren Überwindung unterstützen könnte. Die Ansätze von Community Music schienen mir genau jene Grundlagen zu bieten, die es für ein inklusives Musikprojekt mit Psychiatrie-Erfahrenen zu brauchen schien.
So kam die Idee auf, das gesamte Dorf und somit auch die Bewohner*innen der Wohnstätte zu einer offenen Sing- und Musizierrunde einzuladen. Damit wollte ich einen Raum anbieten, in dem in lockerer Atmosphäre gemeinsam musiziert werden kann. Die genaue Gestaltung sollte noch offenbleiben. Ich hoffte darauf, dass es in der Umgebung auch so viele Musikinteressierte gab wie in der Wohnstätte. Bewusst warb ich an keiner Stelle für ein „inklusives“ Projekt, es sollte ein unvoreingenommenes Kennenlernen möglich werden. Ich hoffte darauf, dass die Menschen vielleicht gar keine Trennung untereinander vornehmen würden, wer aus der Wohnstätte käme und wer von außerhalb. Die Idealvorstellung dahinter war, dass die Teilnehmenden sich einfach als Menschen, die ein gemeinsames Interesse an Musik haben, sehen und begegnen würden. Ziel war es, dass im Laufe der Zeit durch das gemeinsame Singen und Musizieren die Menschen sich untereinander kennenlernen würden und eine Gemeinschaft entstehen könnte. Alle Teilnehmenden sollten die Möglichkeit erhalten, sich musikalisch ausleben und verwirklichen zu können und ästhetische Erfahrungen zu sammeln.
c. Vorbereitung und Verlauf
Planung:
Mit umfassender Unterstützung von Prof. Dr. Christiane Gerischer und Hausleiterin Berit Harrendorf konnte bald ein konkreter „Fahrplan“ für die Umsetzung der Idee erarbeitet werden. Gemeinsam mit Frau Grimmsmann, Ansprechpartnerin für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising beim LAFIM, konnte durch einen Projektantrag bei Aktion Mensch die finanzielle Unterstützung gesichert werden. Mit dieser konnten Musikinstrumente angeschafft, die Raummiete gezahlt sowie bei jedem Treffen für ein paar Getränke und Snacks gesorgt werden. Als Räumlichkeit bot sich das Bürgerhaus in X an, ein großer Dorfgemeinschaftsraum, der für Feste und Veranstaltungen genutzt wird. Freundlicherweise ermöglichte der Besitzer für die ersten Treffen eine kostenfreie Nutzung, und auch später verlangte er nur eine relativ geringe Unkosten-Entschädigung, um das Projekt zu unterstützen. Um für die Projekt-Idee zu werben, beschloss ich, Flyer im Dorf zu verteilen. Diese sollten zunächst einmal nur das Interesse wecken, als Anregung dienen und einen groben Eindruck zu der Idee hinter dem Projekt vermitteln (siehe Anhang). Wer interessiert war, konnte sich an die eigens für das Projekt erstellte Mail-Adresse wenden. So hoffte ich, auch schon einmal einen ersten Eindruck über die vorhandenen Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten zu erlangen. Ein Bewohner der Wohnstätte erklärte sich bereit, beim Austragen der Flyer zu helfen, sodass bald jeder Haushalt in X diese Information im Briefkasten finden konnte. Außerdem legte auch der Besitzer des Dorfladens die Flyer aus und hängte das Plakat auf. Er zeigte sich begeistert für die Idee und gab an, Auskunft zu geben, falls jemand danach fragt. Später, als der erste Termin feststand, wurde dieselbe Art der Werbung wiederholt, mit Flyern und Plakaten im selben Design, jedoch nun mit den konkreten Daten. Diesen ließ ich dann zusätzlich im Meeting-Point, einer Online-Plattform für aktuelles Geschehen in Brandenburg und Umgebung sowie im Brandenburger Kurier der Märkischen Allgemeinen Zeitung veröffentlichen. Den entsprechenden Link zum Meeting-Point teilte auch das Musikgeschäft auf seiner Facebook-Seite. Als Termin erschien ein 14-tägiger Rhythmus sinnvoll. Die Überlegung dahinter war, dass ein wöchentlicher Termin zu viel Belastung darstellen könnte, bei einem monatlichen Termin jedoch der Beziehungsaufbau etc. schwierig werden könnte, sich alles etwas „verlieren“ könnte. Da es am Wochenende oft andere Veranstaltungen gibt fiel die Entscheidung auf Donnerstagabend um 19 Uhr als Termin. Die Hoffnung war, dass dann die meisten Menschen schon von der Arbeit zurück wären, es aber dennoch nicht zu spät abends wird. Da ich es so offen wie möglich halten wollte, und sich die (Musik-)Richtung natürlich möglichst an den noch unbekannten Teilnehmenden orientieren sollte, war die Wahl der Musikinstrumente nicht leicht. Ich entschied mich für die Anschaffung eines E-Pianos, einer Cajon und eines E-Basses in einem Brandenburger Musikinstrumentengeschäft. Verschiedene Perkussionsinstrumente wie Bongos, Schellenringe, Tambourine, Caxixis und Klanghölzer waren in der Wohnstätte schon vorhanden und konnten genutzt werden. Zusätzlich brachte ich diverse private Instrumente wie die Steel-Tongue-Drum, Akustik-Gitarre, Querflöte, Maultrommeln und Ukulele mit ein. So hatte ich das Gefühl, ausreichend Instrumente für den ersten Termin zur Verfügung stellen zu können, und das Budget war noch nicht voll ausgelastet, falls sich noch besondere Bedarfe entwickeln würden.
Verlauf:
Bereits auf den ersten Flyer folgten einige E-Mails von Interessierten. So konnte ich einen ersten Eindruck davon gewinnen, wer da eventuell bei einem ersten Treffen mit welchen Interessen auftauchen könnte. Zum ersten Treffen waren dann circa 20 Interessierte der Einladung ins Bürgerhaus gefolgt, drei Bewohner*innen aus der Wohnstätte waren dabei. Viele waren schon früher da, kamen ins Gespräch miteinander, betrachteten interessiert die aufgebauten Instrumente und probierten diese mit meiner Aufmunterung etwas aus. Es war eine sehr heterogene Gruppe zusammengekommen. So waren die jüngsten Teilnehmerinnen neun Jahre alt, während die älteste mit 78 Jahren teilnahm. Zur Begrüßung hatte ich ein afrikanisches Begrüßungslied vorbereitet, welches durch eine Body-Percussion mit wechselnden Partnern im Kreis begleitet werden konnte. Dabei wurde viel gelacht, vor allem, wenn es immer wieder durcheinander ging, und auch diejenigen, die zunächst skeptisch blickten, ließen sich darauf ein. Danach waren verschiedene Fragen zu persönlichen musikalischen Interessen vorbereitet, zu denen sich in den Ecken des Raumes positioniert werden sollte. Dabei stellte sich heraus, dass der Musikgeschmack der meisten im Bereich Pop, Rock und Schlager lag, während nur wenige auch beispielsweise Klassik, Rap oder Metal hörten, dabei dem anderen jedoch auch nicht abgeneigt waren. Einige spielten schon unterschiedlich lang Instrumente, andere wussten, dass sie gerne Singen. Daraufhin ließ ich zwischen drei Liedern abstimmen, welche ich mit Text und Akkorden vorbereitet hatte. Es wurde für „Ein Kompliment“ von den Sportfreunde Stiller gestimmt, welches daraufhin angestimmt wurde. Das Lied war allen bekannt und jeder beteiligte sich auf unterschiedliche Art und Weise. Manche mit ihren eigenen Instrumenten wie Gitarre und Ukulele, andere probierten sich an den Percussion-Instrumenten aus, und viele sangen. Ich betonte, dass bei den nächsten Treffen Lieder gespielt werden sollten, die sich die Teilnehmenden wünschten, und verwies auf eine Liste, die ich ausgelegt hatte, wo jede*r Ideen und Wünsche eintragen sollte. Zum Abschluss lud ich zu einer Improvisation mit der Steel-Tongue-Drum ein. Das Instrument sorgte für viel Interesse, da es kaum jemandem bekannt war. Einige probierten es aus und waren begeistert von dem Klang. Viele trauten sich, mit ihrem Instrument oder mit den vorhandenen Instrumenten vorsichtig etwas dazu zu spielen, andere hörten zu. Es entstand eine schöne Stimmung. Nach dem offiziellen Ende meinerseits blieben viele noch länger, unterhielten sich, bedienten sich bei den Snacks und Getränken und es wurde noch das ein oder andere Lied angestimmt. Nach einer groben Zählung hatten sich am Ende fast alle in die E-Mail-Liste eingetragen, die ich ausgelegt hatte, um von dem nächsten Termin zu erfahren. Außerdem erschien nach diesem Treffen ein positiver Artikel zu dem Projekt in der Märkischen Allgemeinen Zeitung, der nochmals die Aufmerksamkeit einiger Menschen erreichte (siehe Anhang).
Die darauffolgenden Treffen verliefen meist ähnlich. Ich bereitete stets unterschiedliche „Opener“ zur Auflockerung als Start vor, mal einen Kanon, mal eine Body-Percussion, mal einen Sprechgesang. Daraufhin wurden bei jedem Treffen zwei neue Lieder von der Wunschliste gespielt sowie alte wiederholt. Die Lieder, die auf die Liste geschrieben wurden, lagen meist im Bereich der „Kultlieder“, die viele Menschen kennen. Hauptsächlich deutsche „Klassiker“, beispielsweise von Karat, Westernhagen, den Puhdys, Reinhard Mey oder der Spider Murphy Gang, aber auch englische Titel wurden sich gewünscht wie „Hallelujah“, „Amazing Grace“, „Country Roads“ oder „I am sailing“. Da einige Teilnehmende mit Englisch Schwierigkeiten hatten, suchte ich für einige dieser original englischen Lieder deutsche Versionen heraus. Auf Wunsch der Teilnehmenden verschickte ich die zugehörigen Akkorde und Noten jeweils eine Woche im Voraus, da einige diese schon vor den Treffen üben wollten. Und in der Wohnstätte stimmten wir die jeweiligen Lieder bei der internen Musikgruppe an, sodass auch die Bewohner*innen schon im Voraus mit ihnen vertraut werden konnten. Immer wieder probierte ich auch freiere Improvisationen wie mit der Steel-Tongue-Drum anzuregen, was mal besser funktionierte und mal etwas schwieriger war. Mit der Zeit änderte sich die Konstellation der Teilnehmenden etwas. Die jungen Mädchen waren nach ein paar Treffen nicht mehr dabei sowie ein paar der älteren Damen. Dafür kristallisierte sich im Laufe der Zeit ein fester Kern von Teilnehmenden heraus, die regelmäßig mit dabei waren. Auch aus der Wohnstätte kamen bald ein paar regelmäßig, andere ab und zu, sodass meist etwa 5-7 Teilnehmende von dort dabei waren. Manche beteiligten sich aktiver, etwa mit Gesang, Keyboard oder der Steel-Tongue-Drum, andere hörten lieber nur zu oder nahmen mal ein Percussion-Instrument in die Hand. Einige, die bei den ersten Treffen ihr Instrument noch nicht dabeihatten, brachten dieses später auch mit. So war bald regelmäßig eine Vielfalt von Instrumenten vertreten: Akustik-Gitarre, E-Gitarre, Ukulele, Geige, Querflöte, Akkordeon, Cajon, Djembe und Klavier. Die Zeit nach dem „offiziellen“ Programm wurde auch genutzt, um sich unter anderem über andere interessante Instrumente auszutauschen, die mitgebracht wurden, und diese auszuprobieren,. So brachte mal jemand eine Harfe mit, stellte seine selbstgebauten Fujara-Obertonflöten vor, zeigte etwas auf Maultrommeln oder es wurde gemeinsam versucht, einer mitgebrachten Mandoline schöne Klänge zu entlocken. Außerdem wurden dann immer noch verschiedene Lieder angestimmt und ein bisschen „gejamt“, während sich andere noch unterhielten. Es kamen immer mehr eigene Ideen seitens der Teilnehmenden, sei es, mal einen Themenabend mit Weihnachts- oder Frühlingsliedern zu machen, eine eigene Lampe mitzubringen, um die Lichtstimmung zu verbessern, oder die Texte über einen Beamer an die Wand zu werfen, statt Liedzettel zu verteilen.
Über die Teilnehmenden durfte ich auch andere Veranstaltungen in der Umgebung kennenlernen, die man durchaus als Community Music beschreiben könnte, den „Musiker-Stammtisch“ im Schloss in Plaue sowie den „Shruti-Club“ („Musikalische Späterziehung für Anfänger“) bei Christian Radecke in Brandenburg. So verbrachte ich auch privat Zeit, nicht nur zum Musizieren, mit ein paar der Teilnehmenden, die zum „festen Kern“ geworden waren, und wir reflektierten ab und zu informell gemeinsam die Treffen und überlegten neue Ideen und Verbesserungen.
Leider mussten die Treffen aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Um den Kontakt und den Gedanken an das Projekt aufrecht zu erhalten, verschickte ich weiterhin regelmäßig Lieder von der Wunschliste mit der Einladung, dieses zum normalen Termin Zuhause am Fenster zu spielen, worauf positive Rückmeldungen kamen. Aufgrund der besonderen Bestimmungen für das gemeinsame Singen zog sich diese Projekt-Pause länger hin als erwartet. Als es die aktuellen Hygiene-Richtlinien wieder zuließen, lud ich zu einem erneuten Treffen ein. Es sollte draußen auf der Wiese hinter dem Bürgerhaus stattfinden. Für mich hatte sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass ich das Projekt aus persönlichen Gründen nach Beendigung des Studiums nicht weiterführen können würde. Dies kündigte ich in der Einladung zu dem Treffen schon an, in Verbindung mit der Aufforderung, Ideen zu sammeln, wer eventuell in welchem Rahmen Lust hätte, das Projekt weiterzuführen und zu entwickeln. So sollte dieses Treffen gewissermaßen einen Abschluss, aber auch die Plattform für einen Neustart bieten. Einer der Teilnehmer erklärte sich bereit, die Gesprächsrunde zur Ideensammlung hierfür zu leiten. So kamen zu diesem Treffen ca. 15 Leute, 6 davon aus der Wohnstätte, ein paar sagten per Mail Bescheid, dass sie an dem Termin verhindert wären, jedoch auch weiterhin dabei sein möchten. Alle zeigten sich motiviert, das Projekt weiterzuführen und es wurden Aufgaben verteilt, wer welche Organisationsfragen übernimmt. Danach wurde ausgiebig miteinander musiziert und ausgetauscht, es war deutlich die Freude des Wiedersehens zu spüren.
5. Auswertung
a. Verwendete Methodik
Zur Auswertung des Projektes wählte ich die Methode des qualitativen Leitfadeninterviews. Mir war wichtig, dass die Teilnehmenden genug Raum dafür bekamen, anzusprechen und zu erzählen, was ihnen persönlich an dem Projekt wichtig war und wie sie persönlich es erlebt haben, und dennoch bestimmte Themen direkt ansprechen und die Sichtweise dazu erfragen zu können. Hierbei legte ich besonderen Wert darauf, herauszufinden, welche Prinzipien von Community Music zum Tragen gekommen sind und ob und in welchem Maße bei dem Projekt eine inklusive Praxis stattgefunden hat und was dazu beigetragen bzw. daran gehindert hat. Deshalb orientierte ich mich bei der deduktiven Kategorienbildung an den Bereichen, die bei Community Music eine Rolle spielen und ging dabei besonders auf inklusive Aspekte ein. Den Interviewleitfaden (siehe Anhang), wollte ich vor allem als Fragen-Pool nutzen, um die Teilnehmenden zum Erzählen über ihr Erleben anzuregen.
Insgesamt erklärten sich 11 Teilnehmer*innen bereit, sich mit ihrer Meinung an der Auswertung zu beteiligen. Die meisten Interviews erfolgten aufgrund der Corona-Maßnahmen als Telefon-Gespräche. Zwei Teilnehmerinnen teilten mir ihre Gedanken zum Projekt lieber als Text bzw. Sprachnachricht mit. Die Interviews mit den Bewohner*innen sowie einer Betreuerin erfolgten persönlich in der Wohnstätte.
Die Interviews wurden mit dem vereinfachten Transkriptionssystem nach Dresing & Pehl transkribiert, wobei persönliche Daten anonymisiert wurden. Die transkribierten Interviews befinden sich im Anhang. Die Auswertung erfolgte mithilfe der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ nach Mayring. Die für die Erstellung des Leitfadens gebildeten deduktiven Kategorien wurden im Prozess durch induktive Kategorien, die sich aus dem Textmaterial ergeben haben, ergänzt. Das Textmaterial wurde in Sinnabschnitten kodiert und bedeutsam erscheinende Passagen den Kategorien zugeordnet. So wurden die unterschiedlichen Aussagen der Interviewpartner*innen nach Themen sortiert. Die folgende Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an dieser Sortierung nach den Kategorien und fasst prägnante Aussagen der Interviewpartner*innen zu diesen zusammen.
b. Darstellung der Ergebnisse
Motivation. Betrachtet man die Aussagen zu den Erwartungen und Hoffnungen, die an das Projekt gestellt wurden, lässt sich eine gewisse Versorgungslücke im kulturellen Angebot der Umgebung erkennen. Teilnehmende berichten davon, schon länger auf der Suche nach bestimmten Settings gewesen zu sein und hofften, diese in dem Projekt vorzufinden oder umsetzen zu können. Zwei Teilnehmende beispielsweise singen zwar in Chören, wollten aber gerne auch mal freieres Singen ausprobieren. Manche spielen zwar Instrumente, hatten jedoch das Gefühl, sich mit ihrem aktuellen Niveau noch nicht in vorhandene Strukturen einfügen zu können. So waren bei anderen Veranstaltungen häufig bestimmte Barrieren vorhanden, zum Beispiel, dass sie zu professionell wirkten, der Termin nicht wahrnehmbar war oder der Weg dorthin zu weit war. Teilweise hat das Angebot auch nicht dem musikalischen Geschmack entsprochen, sodass von einer Teilnahme z.B. an Chören abgesehen wurde. Insgesamt schien der lockere Rahmen und auch die Tatsache, dass es nicht viel derartige Initiativen in der Umgebung gibt, Neugierde ausgelöst zu haben. Manche hofften, ihr persönliches Instrumentalspiel verbessern zu können und eine Anregung zum regelmäßigen Üben zu bekommen. Eine Teilnehmerin nahm das Projekt auch zum Anlass, nach langer Pause überhaupt mal wieder mit ihrem Instrument zu spielen. Eine andere Teilnehmerin hoffte auch auf kleine Auftritte mit der Gruppe, da sie dies gerne macht, und auch in dieser Hinsicht noch sicherer werden möchte. Außerdem schien es auch als Gelegenheit wahrgenommen zu werden, Freunde zu treffen und etwas gemeinsam mit Freunden zu unternehmen. Auch bei den Teilnehmenden aus der Wohnstätte schien Neugierde ein zentrales Moment gewesen zu sein. Generell schien es bei diesen jedoch insgesamt viele Zweifel gegeben zu haben. Die meisten mussten persönlich überzeugt werden, um es auszuprobieren. Die direkte Ansprache und Motivation sowohl von Betreuer*innen als auch Mitbewohner*innen hat hier eine wichtige Rolle eingenommen. Eine Betreuerin, die teilweise Bewohner*innen zu den Treffen begleitet hat, vermutet auch, dass manche Bewohner*innen teilgenommen haben, um uns Betreuern einen Gefallen zu tun. Dann haben sich für die Bewohner*innen die Treffen als „willkommene Abwechslung“ herausgestellt und es wurde sich auf sie gefreut als ein „Highlight, das war wie früher, als wenn sie wieder Jugendliche sind und zur Disko konnten“ (I-5, Z.61-64), beobachtete die Betreuerin. Für eine Bewohnerin stellten die Treffen eine Möglichkeit zur Entspannung und Ablenkung von ihren Zwangsgedanken dar. „Das war mal wieder eine Zeit, wo ich ausgespannt habe“ (I-3, Z.7), beschreibt sie, „Die Gedanken waren nicht so viel. Waren zwar noch da, aber waren nicht so viel, ne? Das war schön.“ (I-3, Z.28-29) Sie habe bei sich selbst dadurch eine positive Entwicklung beobachten können: „Bin aufgegangen wie eine Blume“ (I-3, Z.6).
Bedeutung der Musik.Die Musik an sich schien für die Teilnehmenden eine sehr unterschiedliche Rolle gespielt haben. Während für manche die musikalischen Aspekte am wichtigsten waren, war sie für andere „nur Teppich, um sich zu treffen“ (I-11, Z.307). Vor allem auf individueller Ebene würdigten einige besonders, dass sie musikalisch viel aus dem Projekt mitnehmen konnten, sei es, um das eigene Instrumentalspiel auszubauen, überhaupt wieder Freude am Instrument zu finden und eine neue Motivation zum Musizieren zu haben. Eine Teilnehmerin empfand, dass die Musik gerade zu Beginn zu wenig im Fokus stand, dass es eher ein „Schnattertreff“ (I-5, Z.168) war. Eine Teilnehmerin aus der Wohnstätte konnte in dem Projekt Singen als persönliche Stärke entdecken und die Erfahrung machen, Anerkennung dafür von den anderen zu erhalten. Ein Bewohner erlebte das Mitspielen mit dem Keyboard als sehr anstrengend, es war eine Herausforderung für ihn, und er war immer froh, wenn es geschafft war. Vielen war besonders das Zusammenspiel wichtig. Sowohl das gemeinsame Singen als auch die Art und Weise, wie sich die vielen verschiedenen Instrumente einfügen konnten, sodass ein „wahnsinniges Zusammenspiel“ (I-1, Z.34) zustande kommen konnte, wurde wertgeschätzt. Das Miteinander, das dadurch entstehen konnte, hatte auch eine große Bedeutung für die Teilnehmenden. So betonte eine Teilnehmerin, dass es ihr gefallen hat, dass der Fokus darauf lag, gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen, statt musikalische Perfektion anzustreben. Durch das gemeinsame Singen sei eine gelockerte Atmosphäre und gute Laune entstanden. Ein Teilnehmer brachte den Gedanken ein, dass die Musik als „dritter Fokus“ (I-11, Z.630) bei derartigen Veranstaltungen die Kontaktaufnahme zu anderen erleichtern kann. So könne man, wenn etwa ein Gespräch ins Stocken gerät, sich wieder gemeinsam auf die Musik konzentrieren, ohne dass eine peinliche Stille entsteht. Eine Teilnehmerin sagte, dass sie ohne das Projekt wahrscheinlich nie von der Wohnstätte erfahren hätte, geschweige denn, Bewohner*innen kennengelernt hätte, und bezeichnete die Musik in diesem Zusammenhang als „schöne Brücke“ (I-1, Z.106) zur Annäherung. Nicht nur in Bezug zu den Heimbewohnern, auch insgesamt fand sie, dass dieses Musikprojekt ein guter Anlass war, „mit anderen was zu machen.“ (I-1, Z.134f). Dass der Aspekt des gemeinsamen Musizierens im Vordergrund stand, zeigt sich auch darin, dass toleriert wurde, wenn die Lieder nicht vollständig den eigenen musikalischen Geschmack getroffen haben. Zwar bezeichneten einige die Liedauswahl als „schöne Mischung“ (I-1, Z.23) und „abwechslungsreich“ (I-5, Z.80), brachten aber auch ein, dass nicht alle Lieder gefallen haben. Dies schien jedoch auch niemand erwartet zu haben.
Gemeinschaft und soziale Aspekte.In vielen Bereichen hätte das Projekt wahrscheinlich noch eine längere Laufzeit gebraucht, um sich zu entwickeln. Im Bereich der sozialen Aspekte wird dies besonders deutlich. In manchen Aussagen der Teilnehmenden zeigt sich schon in Ansätzen die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls, was sich über die Zeit eventuell noch weiterentwickelt hätte. „Als ich das allererste Mal mit da war, dachte ich, oh, das sind so Grüppchen, da macht jeder so seins, aber es ist dann unheimlich gewachsen, muss ich sagen, im Laufe der Zeit“, schildert die Betreuerin, die die Treffen manchmal begleitet hat, ihre Beobachtungen, „es war sehr, sehr schön dann zum Schluss. Also ihr wart wirklich eine tolle Gemeinschaft“ (I-5, Z.9-13). So haben sich zwei Teilnehmerinnen beispielsweise in der Gruppe wie in einer Band oder einem kleinen Orchester gefühlt. Eine Teilnehmerin meint, dass zwar noch eine große Distanz vorhanden war zwischen den Leuten, die sich noch nicht vorher kannten und auch noch erkennbar war, dass sich einige untereinander schon besser kannten und somit eher eine Gruppe für sich bildete, sie jedoch dennoch schon ein gewisses Gruppengefühl allein durch das gegenseitige Wiedererkennen gespürt hat. Eine Teilnehmerin fand, dass allein der Aspekt, sich dort mit Menschen gleicher Interessen zu treffen, eine verbindende Funktion hatte. Eine andere meinte, dass sie zu manchen Leuten besser eine Beziehung aufbauen konnte als zu anderen, jedoch zu niemandem dort ein wirklich schlechtes Verhältnis hatte.
Alle Interviewpartner*innen beschreiben insgesamt positive Erfahrungen mit der Interaktion in der Gruppe, trotz dessen, dass sich auch an eine noch zu beschreibende Konfliktsituation erinnert wurde. Diese wurde als schwierig und grenzwertig, jedoch auch als gut gelöst erlebt. Davon abgesehen wird von Situationen berichtet, in denen sich untereinander Mut zugesprochen wurde, indem positive Rückmeldungen gegeben wurden. Beim Musikmachen wurde sich gut abgesprochen und aufeinander eingegangen. Es herrschte eine hilfsbereite Atmosphäre und es „wurde keiner irgendwie komisch angeguckt, wenn irgendwas nicht klappte, sondern ganz im Gegenteil, immer geguckt, wer könnte noch wo wie was machen.“ (I-1, Z.77f). Die Betreuerin aus der Wohnstätte konnte beobachten, wie ein Bewohner dadurch an Selbstwertgefühl gewinnen konnte, dass er Anerkennung in der Gruppe finden konnte und niemand etwa über ihn gelacht hat. „Die Treffen baten ein lockeres, entspanntes und angenehmes Umfeld, wo jeder so sein konnte wie er eben ist.“ (I-6, Z.23f), meint eine Teilnehmerin. Eine Teilnehmerin aus der Wohnstätte beschreibt, dass bei ihr ein Gefühl der Geborgenheit entstanden ist dadurch, dass alle „lieb“ (I-3, Z.31) zueinander waren. Auch wurde beschrieben, dass alle „ganz locker drauf“ (I-7, Z.108) waren und viel gelacht wurde. Dieser lockere Umgang miteinander hat einem Bewohner, der zuvor Bedenken angesichts der Tatsache hatte, dort fremde Menschen zu treffen, diese Bedenken genommen. Er habe dann festgestellt, dass man sich gut mit den Leuten dort verstehen, unterhalten und sie kennenlernen konnte, was von Mal zu Mal immer besser wurde.
Was die Entstehung von Gesprächen betrifft, wurden gegensätzliche Aussagen gemacht. Eine Teilnehmerin meint, sie „ist schnell ins Gespräch gekommen, obwohl ich vorher niemanden bewusst gekannt hatte.“ (I-10, Z.17). Zwei andere meinten, es wären nicht viele Gespräche entstanden, unter anderem, da sich die Runde im Nachhinein relativ schnell auflöste. Sich untereinander wirklich kennenzulernen war anscheinend im gegebenen Rahmen für manche eher schwierig. Die Interviewpartner*innen konnten sich selten an alle Namen erinnern, und manche äußerten, insgesamt wenig über die anderen Teilnehmenden erfahren zu haben. Eine Teilnehmerin meint, hier hätte man eine richtige Kennlernrunde oder ähnliches machen müssen.
Die Teilnehmenden schienen überlegt zu haben, wie sie sich am besten mit ihren persönlichen Ressourcen in die Gruppe einfügen konnten. Sehr interessant ist, wie unterschiedlich dabei die Einstellungen und Überlegungen sein können. So beschreibt eine Teilnehmerin, dass sie zwar eigentlich auch Gitarre und Flöte spielt, was sie eventuell gerne mehr ausprobiert hätte, dann jedoch nicht mehr so viel hätte singen können. Da es mit der Zeit weniger wurden, die ohne Instrument nur gesungen haben, hatte sie das Gefühl, dass dies mehr gebraucht wurde und sich deshalb darauf konzentriert. Eine andere Teilnehmerin hat die gleiche Entwicklung beobachtet. In ihr hatte dies jedoch die gegenteilige Wirkung erzeugt: Sie hatte die Befürchtung, bald die einzige ohne Instrument zu sein, und hat deshalb beschlossen, ihr Akkordeon mitzubringen.
Wertschätzung von Vielfalt.Es gab niemanden unter den Befragten, der in der Gruppe nicht zwischen den Bewohner*innen der Wohnstätte und dem „Rest“ unterschieden hat. Das Verhältnis zueinander wurde unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. Eine Teilnehmerin hatte das Gefühl, dass bestimmte Elemente im Programm extra für die Bewohner*innen vom Niveau her herabgestuft waren, was sie als störend empfand. Sie konnte außerdem „nicht so den Draht“ (I-2, Z.175) zu diesen Leuten finden. Ein Teilnehmer erklärt den Versuch der Inklusion sogar als gescheitert. „Ich glaube, das ist eine zu große Herausforderung. Es ist ja schon schwierig genug für die normalen Leute, so einen sozialen Kontext zu schaffen.“ (I-11, Z.711f). Bei manchen löste die Anwesenheit der Bewohner*innen Unsicherheit und Hilflosigkeit aus, da sie nicht wussten, wie man mit diesen Leuten umgehen sollte. Zwei Interviewpartner hätten sich gewünscht, etwas über das Krankheitsbild der Leute zu erfahren, um einen besseren Zugang zu finden. Doch in gewissem Maße konnte diese Unsicherheit anscheinend beseitigt werden. „Ich fand das dann erstaunlich, dass man mit denen einfach so dann Musik machen kann“ (I-1, Z.114f), erzählt eine Teilnehmerin. Insgesamt wurde es durchaus als positiv bewertet, dass die Bewohner*innen dabei waren, auch von Teilnehmenden, die den Umgang als teilweise schwierig empfunden haben. Dies wurde auch explizit geäußert. Eine Teilnehmerin begründet dies damit, dass sie sich auch oft „anders“ fühlt: „ich denke halt von mir auch, ich bin auch anders. Ich habe eine Sprachstörung, ich habe depressive Phasen, ich bin auch sehr sensibel, und ich finde es halt gut, dass man diese Leute dann auch mit einbindet. Und die halt nicht außenvor lässt.“ (I-2, Z.159-161). Eine Interviewpartnerin fand es gut, dass diese Menschen für sie über das Projekt zum ersten Mal überhaupt sichtbar geworden sind. „Normalerweise sind die ja wie, wie aus dem Gesicht, die bemerkt man ja gar nicht.“ (I-1, Z.109). Die Betreuerin aus der Wohnstätte fand, dass die Bewohner*innen in der Gruppe sehr gut angenommen wurden. „Du hast keine Ausgrenzung gemerkt, dass du schief angeguckt wurdest oder so.“ (I-5, Z.20f). Derartige schiefe Blicke kenne sie aus anderen Situationen allzu gut, weshalb sie positiv überrascht darüber war, dass dies hier nicht der Fall war. Wie dieses Verhältnis zueinander aus Sicht der Bewohner*innen war, ist schwierig zu beurteilen. Ein Teilnehmer von dort empfand die lustige Stimmung als schön, sagte jedoch auch, dass er selbst nie mitlachen konnte, wenn gelacht wurde. Ein anderer Bewohner hingegen erzählte wie schon erwähnt von guten Gesprächen mit den anderen Leuten.
Barrieren/Barrierefreiheit:Das Ziel, dass es keine Rolle spielen sollte, welche Fähigkeiten jemand im Einzelnen mitbringt, um Teil des Projektes zu werden, wurde den Aussagen der Interviewpartner*innen nach überaus gut angenommen und auch teilweise erreicht. Der Anspruch, in dem Projekt einen Raum ohne Leistungsorientierung zu schaffen, wurde als äußerst positiv empfunden. Für manche war es anscheinend sogar ein Hauptgrund, warum sie selbst sich wohlfühlen und einbringen konnten. „Bei dir jetzt war irgendwie so die Atmosphäre egal wie gut man spielen kann egal was man kann, man kann irgendwie mitmachen und das fand ich sehr angenehm.“ (I-1, Z.19-21), meinte eine Teilnehmerin, der es in anderen Kontexten schwerer gefallen ist, sich zu trauen. Eine andere Teilnehmerin beschreibt, dass sie in anderen Rahmen Schwierigkeiten hat, sich mit ihrem Instrumentalspiel einzubringen, da sie sich selbst noch als Anfängerin betrachtet und öfter Fehler macht. An einem anderen Ort, wo sie öfter versucht, mitzuspielen, bestehen relativ hohe Qualitätserwartungen, was in ihr großen Druck verursacht und sie unsicherer spielen lässt: „Aber wenn ich […] schon diese Gedanken habe, du musst jetzt gut spielen, weil ansonsten hört es sich scheiße an, und das ist halt doof, dann spielt man auch unsicher.“ (I-2, Z.51-53). Dies sei hier nicht der Fall gewesen: „Da fand ich es gut, dass dort wirklich üben auch gewollt ist und dass Fehler auch gewollt sind und dass man da halt nicht perfekt spielen können muss, sondern dass es einfach nur nach Spaß geht“ (I-2, Z.15-17), „Also das ist, wenn man zu einem Treff kommt, und da zu üben ist okay, und wenn halt mal ein Ton nicht so gut kommt oder so, ist es auch nicht schlimm, dann nimmt man das viel lockerer.“ (I-2, Z.53-55). Dies war anscheinend vor allem so, da jedem freigestellt war, auf welche Art und Weise teilgenommen werden wollte. „Und hier war ja die Einstiegshürde quasi Null. Du kannst dich da einfach mit dazu setzen und vielleicht einfach nur mitsingen oder so, und da sein.“ (I-11, Z.322f). Aussagen wie diese zeigen eindrücklich, dass ein starker Leistungsdruck nicht nur speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen eine Barriere darstellt, sondern es insgesamt als positiv erlebt wird, wenn dieser ausbleibt. Doch nicht für alle erschien die Einstiegshürde „quasi Null“ zu sein. Eine Teilnehmerin schildert, dass sie nicht wirklich aktiv mitmachen konnte und erklärt sich das über eigene Defizite. „Ich war für dieses Projekt vielleicht einfach zu „unmusikalisch“ veranlagt bzw. auch zu schüchtern, mich so richtig zu integrieren.“ (I-6, Z.55f). Auch die Raumkonstellation und Lichtverhältnisse schienen nicht optimal gewesen zu sein. „War mir alles zu hell, viel zu hell, viel zu groß und zu leer und zu verloren“, sagt ein Teilnehmer dazu, „dann fühlt man sich so beobachtet“ (I-11, Z.64,68).
Das Projekt war also keineswegs komplett barrierefrei. Einige der im Theorieteil beschriebenen Hürden wurden auch hier von Bewohner*innen genannt. Ein Bewohner musste sich zur Teilnahme überwinden, „wegen der Aufregung, so viele Leute und so“ (I-7, Z.13). Diese Überwindung ist ihm dadurch gelungen, dass er mit einer anderen Bewohnerin gemeinsam hingehen konnte. Geholfen hat hier anscheinend auch, dass die Bewohner*innen zu mir als Veranstalterin schon ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut hatten. „Jetzt warst du da, dich kannten sie, zu dir haben sie Vertrauen aufgebaut“ (I-5, Z.76), wäre dies nicht der Fall gewesen hätten sie wahrscheinlich „zu große Berührungsängste“ (I-5, Z.75) gehabt und nicht teilgenommen, vermutet die Betreuerin. Auch ein anderer Bewohner äußerte, dass er zunächst Bedenken hatte, „auch ein bisschen Scheu, weil, naja was heißt Scheu, naja, Schüchternheit, weil das waren fremde Menschen gewesen, die ich nicht gekannt habe“ (I-9, Z.14f), und deshalb bei den ersten Treffen noch nicht dabei war. Doch die Atmosphäre in der Gruppe konnte ihm diese Bedenken dann nehmen. „Aber ich habe dann mitgekriegt, wo ich dann da war, ach, die Menschen, die sind eigentlich ganz locker drauf, und so, ja. Und ja, dann bin ich auch öfter hingegangen, und so hat das dann auch Spaß gemacht“ (I-9, Z.15-17). Eine Bewohnerin berichtet auch von Einschränkungen durch Symptome der psychischen Erkrankung, wie dass sie manchmal „keine Kraft“ (I-3, Z.22) hatte und sich aufraffen musste, um dort hinzugehen.
Partizipation.Die meisten Interviewpartner*innen gaben an, dass sie sich gut einbringen konnten in das Projekt. Am häufigsten wurde hier die Beteiligung an der Liederauswahl über die Wunschliste genannt. Beim Musizieren konnte jede*r auf eigene Art und Weise mitmachen und so die eigenen Fähigkeiten einbringen. Ein paar Teilnehmer brachten sich stärker mit ihren Ideen ein und prägten das Projekt dadurch mit, beobachtete eine andere Teilnehmerin. Damit meint sie wahrscheinlich die Teilnehmer*innen, die sich nachher häufig noch in einer Bar trafen. Hier wurden informell Ideen und Verbesserungsvorschläge ausgetauscht. Ein Teilnehmer meint, diesen Prozess hätte man noch gezielter angehen sollen, etwa offiziell zu einem derartigen „Projektentwicklungskreis“ einzuladen um so einen „festen Kern“ von „Machern“ zu bilden, die dann aktiv gemeinsam das Projekt gestalten und sich verantwortlich, aber auch „zuhause“ dabei fühlen (I-11, Z.190, 570, 207).
(Lern-)Prozesse.„Ich fand es interessant, da das Projekt für alle offen stand, und es nicht festgelegt war, wo es eigentlich einmal hinführen sollte.“ (I-10, Z.12f). Die Prozessorientierung, die bei Community Music Projekten angestrebt wird, scheint auch bei den Teilnehmenden vorhanden gewesen zu sein. Es wurde beschrieben, dass bei sich selbst Lernprozesse beobachtet werden konnten oder diese noch erwartet werden, vor allem, was das eigene Musizieren betrifft. Doch auch, was das soziale Miteinander angeht, wurde eine Entwicklung beobachtet und weiterhin erhofft, dass man sich gegenseitig besser kennenlernt und dadurch auch zunehmend mehr zutraut. Ein Teilnehmer hatte jedoch den Eindruck, dass alle zwar geduldig waren und hofften, dass es sich noch entwickelt, es aber „nicht richtig los ging“ (I-11, Z.150) und dass mehr Erwartungen vorhanden waren als dann auch tatsächlich umgesetzt wurden.
Organisationsstruktur.Terminlich scheint es immer schwierig, allen gerecht zu werden. Eine Teilnehmerin empfand den 14-tägigen Rhythmus als gut gewählt. „So war man nicht unter Druck, dass man laufend einen Termin hatte, sondern hat sich schon auf den nächsten Termin gefreut.“ (I-10, Z.50f). Eine andere Interviewpartnerin meinte, dass es ihr dadurch, dass sie am nächsten Tag arbeiten musste, zu spät geworden wäre, wenn sie nachher noch das Gespräch zu anderen gesucht hätte, und dies auch deshalb nicht getan hat. Die Information und Terminerinnerung über den E-Mail-Verteiler wurden als praktisch empfunden. Die Strukturierung der einzelnen Treffen wurde ambivalent bewertet. Manche Elemente wurden von dem einen als positiv hervorgehoben, während sie jemand anderes weggelassen hätte. Zum Beispiel fand eine Teilnehmerin, dass das Warm-up mit Body-Percussion „die Runde noch etwas mehr aufgelockert hat“ (I-6, Z.46) und eine andere meinte, dass man sich durch die wechselnden Partner dabei gerade am Anfang schon etwas kennenlernen konnte. Eine andere Teilnehmerin fand dies überflüssig und hätte lieber sofort mit den Liedern angefangen. Dennoch schien gut aufgenommen worden zu sein, dass es überhaupt eine vorbereitete Struktur gab. „Es gab einen roten Faden und dennoch Platz für spontane Wünsche.“ (I-6, Z.42f). Ein Teilnehmer meinte, es ging oft nach diesem vorbereiteten Teil, „hinterher erst richtig los“, wo dann „ein bisschen gejamt“ (I-11, Z.174-176) wurde, glaubt jedoch auch, dass es dafür diesen Input davor auch gebraucht hat. Bei der Veranstaltung selbst sei also durch mich als „Gastgeber“ die nötige Struktur vorhanden gewesen zu sein, und ich hätte mit meiner „positiven Art so offen, freundlich und fröhlich die Leitung des Ganzen übernommen“ (I-6, Z.25f), auch wenn ich diese Rolle noch präsenter und mit lauterer Stimme hätte einnehmen können. Dabei wäre ich „auf die Wünsche der Leute während des Treffens eingegangen“ (I-6, Z.26), für die Beteiligung über die Teilnahme an den Treffen hinaus hätte es jedoch an einer passenden Struktur gemangelt. Sehr gut fanden die Teilnehmenden das vorhandene Angebot an Instrumenten, die ausprobiert und genutzt werden konnten. Auch, dass einzelne Instrumente und Instrumentengruppen immer mal wieder in den Mittelpunkt gerückt wurden. Ein Teilnehmer überlegte, ob man die Lieder vielleicht noch gezielter hätte arrangieren und einüben können und hätte sich so eventuell sicherer gefühlt. Und ein anderer versuchte manchmal, aus seiner Chor-Erfahrung heraus eine zweite Stimme zu singen, kam jedoch zu dem Schluss, dass das konkrete Einüben von Mehrstimmigkeit in diesem Rahmen nicht unbedingt nötig ist, da als Hauptsache der Spaß rüberkommen sollte. Eine andere Teilnehmerin hatte schon das Gefühl, dass die Lieder auch wirklich zusammen eingeübt wurden, und fand die Mischung aus dort üben und zusammen spielen gut. Wichtig für das Funktionieren der Struktur war anscheinend, dass immer „genug“ (I-6, Z.20) Leute da waren, und vor allem, dass ein „harter Kern“ an „Vollblutmusikern“ (I-6, Z.21f) immer das nötige Grundgerüst bilden konnte.
Persönliches Befinden in Abhängigkeit vom sozialen Kontext. Eine Komponente, die mir immer wieder in den Interviews begegnete, war die des eigenen Selbstbewusstseins und wie dieses abhängig ist vom (sozialen) Umfeld. So beschrieb eine Teilnehmerin, dass sie bei allen Teilnehmenden eine bestimmte Unsicherheit beobachten konnte, und auch selbst eine solche verspürt hat. Doch genau dieser Faktor, dass sie auch andere unsicher wirkten, dass sie damit nicht allein war, habe ihr dabei geholfen, sich zu trauen und einen Zugang zu finden. „In anderer Atmosphäre mit Profi-Musikern da fühlt man sich immer eher so ganz klein wenn man nicht so richtig ausgebildet ist, traut sich dann gar nichts zu machen, wenn man dann aber bei allen Leuten so die ein oder andere Unsicherheit spürt, sich erstmal einzubringen, dann findet man auch selber eher einen Zugang.“ (I-1, Z.46-50). Und auch bei anderen konnte sie einen solchen Prozess beobachten, die zunächst zurückhaltend wirkten, dann aber Mut fassen und aus sich herauskommen konnten. Gewissermaßen wurde also durch die gemeinsame Unsicherheit aller Beteiligten ein Kollektivierungsmoment geschaffen, der die Überwindung dieser Unsicherheiten möglich machte. „Ich denke auch, dass dieses Projekt einigen Menschen viel Selbstbewusstsein und auch Mut gegeben hat, sich selbst in eigener musikalischer Weise zu verwirklichen“ (I-6, Z.29-31), vermutet eine andere Teilnehmerin. Eine der Geigerinnen beschreibt ein ähnliches Phänomen. Ihr hat es geholfen, nicht die einzige zu sein, die noch etwas unsicher auf ihrem Instrument ist: „Wenn man halt mehrere hat, die es noch nicht so gut können, dann fühlt man sich auch nicht so alleine mit dem Gefühl von wegen ach, ich darf jetzt nicht so spielen, weil ich könnte mich ja verspielen, und ich bin die einzige hier, die halt noch nicht so viele Lieder so gut kann.“ (I-2, Z.39-42). Dadurch konnte sie sicherer und freier spielen. Ein Teilnehmer aus der Wohnstätte erzählte, dass er das Keyboard extra leise gestellt hätte, damit nur er hören konnte, was er spielt, da er sich nicht sicher war, ob es sich gut anhörte. Für ihn sei es aber schon „ein ganz großer Sprung“ (I-5, Z.205f) gewesen, dass er überhaupt in einer so großen Gruppe mit dabei war und mitmachte, meint dazu die Betreuerin.
c. Besondere Situationen
Im Folgenden möchte ich gerne zwei Situationen genauer beschreiben, bei denen sich sowohl Schwierigkeiten als auch ein guter Umgang innerhalb des Projektes zeigten. Natürlich gäbe es noch zahlreiche Situationen mehr, die einer Erwähnung wert wären, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, beschränke ich mich jedoch auf diese zwei. Beide zeigen deutlich auf, dass von dem jeweils involvierten Bewohner schon Stigma-Erfahrungen gemacht wurden, woraus sich unterschiedliche Bewältigungsstrategien entwickelt haben.
Die erste Situation ist keineswegs repräsentativ für das übliche Geschehen bei den Treffen, ist aber vielen stark in Erinnerung geblieben. Herr P., ein junger Bewohner aus der Wohnstätte mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, der stark mit der Affektkontrolle insbesondere von Aggressionen zu kämpfen hat, hatte bisher ohne besondere Vorfälle schon an ein paar Treffen teilgenommen. An einem Abend jedoch verstand er eine Bemerkung, die im Spaß von einem anderen Teilnehmer, Herrn K. gemacht wurde, etwas falsch. Es ging um Medikamente, in etwa: „Hast du etwa deine Tabletten heute nicht genommen“ wurde zu einem anderen Teilnehmer als Witz gesagt. Herr P. bezog dies auf sich und schrie Herrn K. an, dass man über diese Themen keine Witze mache, und dass es nicht witzig wäre, Psychopharmaka einnehmen zu müssen. Er nahm dabei seinen Stuhl über den Kopf und drohte Herrn K. damit. Dieser schien stark „überrumpelt“, blieb jedoch ruhig und meinte, so hätte er das nicht gemeint. An alle Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, vermutlich, da ich selbst etwas geschockt und überfordert war mit der Situation. Jedenfalls konnte sich Herr P. wieder beruhigen und die Musikrunde wurde wieder aufgenommen. Nach Ende der Veranstaltung kamen die beiden nochmal ins Gespräch und ich versuchte unterstützend dazu zu kommen. Beide erklärten in besonnenem Ton ihr Verhalten. Herr K. betonte nochmals, dass er damit niemanden persönlich angreifen wollte. Herr P. erklärte, dass er eigentlich auch gar nicht so übertrieben reagieren wollte. Er redete offen darüber, dass dies auch Teil seines Krankheitsbildes ist, er was das Thema psychische Krankheit anging sehr empfindlich sei und schnell das Gefühl hätte, dass man schlecht über ihn redet. Außerdem hätte er heute einen schwierigen Tag gehabt und kam schon gereizt dort an. Der andere Teilnehmer zeigte hier viel Verständnis. Auch in der Wohnstätte besprach ich mit Herrn P. nochmal den Vorfall. Dabei bat ich ihn unter anderem, dass wenn er merkte, dass er schon sehr angespannt ist, er auf sich achten sollte und nicht noch mehr Belastungen wie etwa die Teilnahme an dem Treffen auf sich laden sollte. Leider kam er danach überhaupt nicht mehr, unter anderem, da sich die Situation insgesamt auch in der Wohnstätte in eine schwierige Richtung entwickelte, was hier nicht genauer erläutert werden kann und soll, jedoch auch der Grund ist, warum ich ihn bedauerlicherweise auch nicht mehr in diese Auswertung des Projektes mit einbeziehen konnte. Ich denke jedoch, dass ein so verständnisvoller Umgang mit einer solch schwierigen Situation nicht selbstverständlich ist und die akzeptierende Atmosphäre in dem Projekt untereinander verdeutlicht.
An einem Tag bereiteten ein paar Männer den Raum für eine Feier des Fußball-Vereins am nächsten Tag vor, während ich gerade alles für das Treffen am Abend aufbaute. Sie waren insgesamt freundlich und hilfsbereit zu mir. Als dann Herr S., ein Bewohner der Wohnstätte, dazustieß, der immer sehr frühzeitig kam, wurde die Situation meines Empfindens nach sehr unangenehm. Ich merkte, wie die Fußballer begannen, sich über Herrn S. und sein Auftreten zu amüsieren. Ich versuchte, ihn in ein möglichst normales Gespräch zu verwickeln, um sowohl ihm als auch den anderen zu signalisieren, dass er hier willkommen ist, so wie er ist. Meiner Wahrnehmung nach richteten sich daraufhin die „komischen Blicke“ auf uns beide. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, empfand die Situation jedoch als sehr belastend. Ich war froh, als die anderen Teilnehmenden langsam ankamen und wir anfangen konnten. Die Männer vom Fußball-Verein schauten noch eine Weile zu, bevor sie dann irgendwann gingen. Der Abend war dann noch sehr schön und erfüllend. Leider gelang es mir nicht, mit Herrn S. ins Gespräch darüber zu kommen, wie er die Situation erlebt hat. Meinem Eindruck nach war für ihn diese Situation nicht außerordentlich besonders, er schien derartige Begegnungen auf eine erschreckende Art und Weise schon gewöhnt zu sein. Mir persönlich hat der Kontrast von dieser Situation zu der Atmosphäre bei dem darauffolgenden Treffen deutlich gemacht, dass ein so offener und akzeptierender Umgang, wie ich ihn bei den Musiktreffen beobachten konnte, alles andere als selbstverständlich ist.
6. Schlussfolgerung und Reflexion
In diesem Abschnitt sollen nun die Erkenntnisse aus der theoretischen Betrachtung und den Interviews zusammengeführt werden und auch meine persönliche Reflexion des Projektes mit einfließen. Welche Bedingungen waren konkret in diesem Projekt förderlich? Welche Barrieren wurden hier konkret erlebt und welche wurden eventuell beseitigt bzw. verringert? Was hätte man anders machen können? Welche Rolle haben dabei die angestrebten Aspekte von Community Music gespielt? Die Schlussfolgerungen speziell für die Praxis in diesem Projekt sollen jeweils auf eine allgemeinere Ebene extrahiert werden. Welche Möglichkeiten und Chancen ergeben sich daraus für die Inklusion in diesem Bereich? Können Community Music Projekte die Teilhabesituation von psychisch kranken Menschen verbessern? Welche Bedingungen sind dafür nötig und wo liegen die Herausforderungen, denen sich gestellt werden muss?
Sowohl die Prinzipien von Community Music als auch von Inklusion konnten in diesem Projekt in Teilen, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden. Dies ist nicht verwunderlich, da es sich um angestrebte Ideale handelt, die ein teilweise grundlegendes Umdenken aller Beteiligten erfordern. Es reicht eben nicht, einfach alle Menschen an einen Ort zu bringen, um inklusive Räume zu kreieren. Kategorien wie „normal“ und „beeinträchtigt“ wurden gebildet und zwischen „wir“ und „die“ unterschieden. Auch sollte kritisch hinterfragt werden, ob das Projekt tatsächlich dazu beitragen konnte, Vorurteile abzubauen oder ob diese nicht eventuell sogar bestätigt, bestärkt oder im schlimmsten Falle erst gebildet worden. So ist zum Beispiel die zuvor beschriebene Konfliktsituation mit dem jungen Mann aus der Wohnstätte mitunter stark in Erinnerung geblieben. Wurde diese Situation ausreichend nachbereitet, um von den Beteiligten verarbeitet werden zu können, ohne dass dabei Vorurteile entstanden sind? Oder bringen Beteiligte nun eventuell psychische Erkrankungen generell mit aggressivem Verhalten in Verbindung, die dies vorher nicht getan hätten? Und wie ist es mit dem involvierten Bewohner, konnte er die Situation verarbeiten und das Verständnis aus dem Gespräch danach als positives Erlebnis mitnehmen, oder war es eine weitere kränkende Stigma-Erfahrung für ihn? Außerdem könnte man hinterfragen, ob in dem Projekt nicht generell nur Menschen teilgenommen haben, die auch so schon einen relativ offenen Blick haben und wahrscheinlich nicht die Leute sind, die in der Öffentlichkeit mit „komischen Blicken“ reagieren. So haben die Männer aus der zweiten beschriebenen Situation beispielsweise eben nicht teilgenommen.
Es ist in Betracht zu ziehen, dass ein Diskurs zum Thema psychische Erkrankungen eventuell sinnvoll gewesen wäre. Mehrere Teilnehmende äußerten in den Interviews den Wunsch, mehr über die Beeinträchtigungen und den Umgang damit zu lernen. Und tatsächlich habe ich den Teilnehmenden viel zugemutet, was den Umgang mit diesen teilweise herausfordernden oder sonderbaren Verhaltensweisen betrifft. Bei den Interviews hat sich gezeigt, dass hier stärkere Zweifel und Unsicherheiten vorhanden waren, als ich gedacht habe. Hier wären mehr Begleitung und Unterstützung nötig gewesen. Für zukünftige Projekte müsste man sich hier Wege überlegen, wie man Räume für derartige Sorgen und deren Beseitigung schaffen könnte. Denkbar wäre zum Beispiel eine professionelle Unterstützung aus dem psychiatrischen Bereich, die sich dann explizit als Ansprechpartner bei Sorgen und Ängsten vorstellt und die Nachbereitung schwieriger Situationen begleitet. Natürlich für alle, und ohne dabei den Eindruck zu vermitteln, es ginge nur um Probleme mit den Psychiatrie-Erfahrenen. Dieser Ansprechpartner könnte auch für die Teilnehmer*innen mit psychischen Beeinträchtigungen hilfreich sein. Denn auch diese waren sehr auf sich allein gestellt in meinem Projekt und die in den Studien genannten sozialen Interaktions- und Kontaktschwierigkeiten waren auch hier erkennbar. Es hat sich gezeigt, dass die alleinige Teilhabe an Aktivitäten im Gemeinwesen nicht auch automatisch eine qualitative Teilhabe an interpersonellen Interaktionen bedeutet. Ich bin in dieser Hinsicht sehr naiv, vielleicht sogar unvorsichtig an das Ganze herangegangen, habe Schwierigkeiten und Diversität übersehen oder sogar unbewusst ignoriert. Mir war die Gefahr, dass Stigma-Erfahrungen reproduziert werden könnten und was das für Betroffene bedeuten kann, vor der Bearbeitung des Theorie-Teils dieser Arbeit nicht in einem angemessenen Maße bewusst. Eine gute Planung mit Berücksichtigung solcher Aspekte ist äußerst wichtig für mögliche zukünftige Projekte.
Für eine solche gute Planung wäre es auch sinnvoll gewesen, stärker mit partizipativen Methoden zu arbeiten. Schon im Planungsprozess hätte ich gezielter versuchen können, die Bewohner*innen der Wohnstätte, aber auch die anderen Dorfbewohner*innen mit einzubeziehen, um herausfinden zu können, welche Bedingungen sie persönlich bräuchten, um sich bei einem solchen Projekt wohl zu fühlen. Und auch im Verlauf des Projektes hätte Partizipation eine größere Rolle spielen müssen. Der Anspruch, dass das Projekt sich in Struktur und Durchführung ihnen anpasst und nicht umgekehrt, konnte so nicht erfüllt werden. Zwar betonte ich stets, offen für jegliche Ideen und Vorschläge zu sein, jedoch hätte es hier in irgendeiner Form strukturiertere Möglichkeiten der Partizipation geben müssen, die mit einer direkteren Aufforderung verbunden wären. Für manche Teilnehmer*innen aus der Wohnstätte hätte ich hier auch noch nach kreativeren Umsetzungsmöglichkeiten suchen müssen, besonders für die, denen es eher schwerfällt, solche Themen zu reflektieren und in Worte zu fassen. Ich hatte einen Denkfehler gemacht, indem ich möglichst vermeiden wollte, dass die Teilnahme am Projekt für die Leute Aufwand bedeutet. Mehr Beteiligung, gemeinsame Planung und Überlegungen hätten zwar natürlich mehr Aufwand für die Beteiligten bedeutet, einige hätten sich dies jedoch gewünscht und wären auch bereit gewesen, diesen Aufwand aufzubringen. Das hat sich auch noch einmal deutlich bei dem letzten Treffen nach der „Corona-Pause“ gezeigt, wo bereitwillig Aufgaben zur weiteren Planung angenommen wurden. Eine Idee, wie man solche aktiven Menschen mit einzubeziehen, beschrieb ein Teilnehmer im Interview. Er schlug vor, man hätte von Beginn an zu einer Art „Projektentwicklungskreis“ einladen können, Besprechungstreffen in einem informellen Rahmen, zum Beispiel in einer Bar, um so einen festen Kern zu finden, der sich engagiert und auch verantwortlich fühlt. Solche oder ähnliche Formate sind für das Gelingen eines solchen Projektes sinnvoll, nicht zuletzt, damit das Stattfinden der Treffen nicht an die Anwesenheit einer einzelnen Person gebunden ist. Solche motivierten Personen aktiv zu suchen hätte sogar schon Teil der Vorbereitung sein können. So hätte ich Treffpunkte wie den Musikerstammtisch oder den Shruti-Club durchaus auch schon vorher finden können und in diesen Netzwerken Mitstreiter für meine Idee involvieren können. Eine Analyse des Sozialraums ist generell förderlich für derartige Projekte, man sollte versuchen, den Ort und die Menschen dort zu durchdringen, um herauszufinden, was es hier speziell braucht.
Ein zentraler Punkt, um eine Praxis auch wirklich zu Community Music zu machen, ist, dass der Facilitator seine Rolle adäquat ausführen kann. Ich war mit meinen Fähigkeiten noch weit von den Fähigkeiten, die ein Facilitator benötigt, entfernt. So konnte ich nicht musikalische Aspekte, Aspekte der Soziodynamik wie auch individuelle Bedürfnisse einzelner gleichermaßen berücksichtigen. Dies hätte ich erkennen müssen und eventuell jemanden als Unterstützung suchen können, der beispielsweise speziell darauf achtet, ob jemand nicht mehr mitkommt, so wie es die genannte Betreuerin, wenn sie dabei war, für die Bewohner*innen tun konnte.
Trotz aller genannten Verbesserungspunkte betrachte ich das Projekt insgesamt als Erfolg. Viele Barrieren waren in dem Projekt beseitigt bzw. nicht vorhanden oder überwindbar. So hat die örtliche Nähe des Veranstaltungsortes ein selbstständiges Erreichen der Treffen für die Bewohner*innen der Wohnstätte möglich gemacht. Dadurch waren sie weder auf den Heimbus angewiesen, noch mussten sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, was für viele eine große Belastung dargestellt hätte und manche überhaupt nicht ohne Unterstützung können. Auf diesem Wege konnten alle kommen und auch gehen, wann sie selbst es wollten. Ich denke, dass gerade diese Möglichkeit, einfach wieder gehen zu können, für einige die nötige „Fluchtmöglichkeit“ darstellte, um überhaupt teilzunehmen. Auch eine finanzielle Hürde gab es nicht. Eine solche hätte für die meisten Bewohner*innen einen Ausschluss bedeutet, die auf jeden Euro achten müssen. Bestimmte Ängste, Schüchternheit und Aufgeregtheit waren zwar vorhanden, konnten aber überwunden werden. Hierbei hat die regelmäßige persönliche Ansprache und Motivation sowohl von Betreuer*innen als auch Mitbewohner*innen geholfen, wie auch wenn sie etwa zu zweit hingehen konnten. Auch scheint es förderlich gewesen zu sein, wenn die Betreuerin aus der Wohnstätte manchmal mit dabei war. Sie konnte einen Blick auf das Wohlbefinden der Bewohner*innen haben und diese einzeln unterstützen. Gleichzeitig hat ihre Anwesenheit auch den anderen Teilnehmer*innen Sicherheit vermittelt. Eine solche Begleitung zu organisieren, sodass sie verlässlich zur Verfügung stehen könnte, kann die Qualität eines derartigen Projektes auf jeden Fall verbessern. Eine sehr gute, vielleicht sogar zentrale Voraussetzung war auch, dass ich als Veranstalterin des Projektes den Bewohner*innen seit fast drei Jahren schon vertraut war. Ein solches Setting ist ideal und wahrscheinlich nicht überall leicht herzustellen. Sollte diese Voraussetzung an einem anderen Ort nicht vorhanden sein, ist es wahrscheinlich wichtig, eine derartige vertraute Person mit einzubeziehen. Eine Vermutung könnte auch sein, dass dadurch, dass ich als Veranstalterin die Bewohner*innen deutlich akzeptiert und wertgeschätzt habe, diese Einstellung auch von den Teilnehmenden übernommen wurde, sich in dieser Hinsicht am Veranstalter orientiert wird/wurde. Ich habe - denke ich - deutlich gezeigt, dass, wer hier dabei sein möchte, alle anderen Teilnehmenden auch akzeptieren muss, wie sie sind. Dies war nach meinen Beobachtungen insgesamt auch der Fall. In den Interviews wurde die Anwesenheit und Einbeziehung der Teilnehmer*innen aus der Wohnstätte oft positiv bewertet, und auch bei den Treffen selbst konnte ich eine allgemein große Akzeptanz beobachten.
Die Musik hat dabei eine entscheidende Rolle eingenommen. Durch sie wurde eine „Brücke“ geschaffen, miteinander in Kontakt zu treten. Es waren von Beginn an gemeinsame Interessen vorhanden, was als verbindend empfunden wurde. Manche, deren größte Motivation zur Teilnahme in musikalischen Aspekten lag, haben die sonstigen Bedingungen und auch schwierige Situationen in Kauf genommen, um diesen Ort zum Musizieren nutzen zu können. Denn genau diese Art zu Musizieren in einem lockeren, ungezwungenen Rahmen wurde von manchen Teilnehmer*innen schon länger gesucht, wie genau da die Gruppe zusammengesetzt war, hat für diese Teilnehmer*innen eine eher zweitrangige Rolle gespielt.
Die geringe Leistungsorientierung, die schon im theoretischen Teil herausgearbeitet wurde, hat sich auch in der Praxis als essenziell erwiesen. Dadurch, dass von niemandem etwas Spezielles erwartet wurde, konnten alle teilnehmen, auch, wer zunächst nur zuhören wollte. Die Interviews haben deutlich gezeigt, dass die Abwesenheit von Leistungsdruck allengut getan hat, nicht nur den Bewohner*innen der Wohnstätte. Es wurde durchweg als positiv empfunden, dass es nicht in erster Linie darauf ankam, wie gut jemand spielt. Das hat vielen dabei geholfen, Ängste und Unsicherheiten überwinden zu können. Denn Unsicherheiten, gerade in neuen, unbekannten Kontexten und mit unbekannten Personen, waren wahrscheinlich bei den meisten Teilnehmenden vorhanden und kennen insgesamt die meisten Menschen, unabhängig von jeglichen psychischen Krankheiten. Hier war es erlaubt, Unsicherheiten zu zeigen, beispielsweise im Umgang mit dem eigenen Instrument. Es war kein Ausschlusskriterium. Im Gegenteil, gerade dadurch, dass alle etwas unsicher waren oder wirkten, konnte der/die Einzelne diese Unsicherheiten überwinden, denn es musste sich niemand allein fühlen mit diesen Gefühlen.
Der wohl bedeutsamste Faktor für das Gelingen des Projektes war, dass dort eine Gruppe von wirklich offenen, herzlichen und motivierten Menschen zusammengekommen ist. Die mit Humor nehmen konnten und auch genug Geduld zeigten, wenn etwas mal nicht so gut klappte und auch auf schwierige Situationen gut reagieren konnten. Alles steht und fällt mit den Teilnehmer*innen. In dieser Hinsicht hatte ich möglicherweise schlichtweg Glück, mit meinem Flyer solch wunderbar motivierte Menschen erreicht zu haben, und bin dafür äußerst dankbar.
7. Fazit
Community Music Projekte bieten vielseitige Chancen für eine inklusive Praxis mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die theoretischen Überlegungen hierzu wurden in meinem Projekt in X mehrfach bestätigt. Die notwendigen Bedingungen hierfür zu schaffen ist in der praktischen Umsetzung nicht einfach. Rückblickend und mithilfe der Erkenntnisse aus der theoretischen Betrachtung sowie aus den Interviews haben sich die in der Schlussfolgerung erläuterten Verbesserungspunkte zur Planung und Durchführung derartiger Projekte ergeben, die hoffentlich in zukünftigen Projekten umgesetzt werden können. Aus diesen Verbesserungspunkten kann man auch schließen, dass sich mit einem vollständigeren Umsetzen der Ansprüche von Community Music wahrscheinlich auch die Qualität der inklusiven Praxis verbessert hätte.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass es in gewissem Maße gelungen ist, mit diesem Projekt einen Schutzraum inder Gesellschaft zu schaffen, wie es in der theoretischen Überlegung als notwendig dargestellt wurde. Es besteht hier eindeutig ein großes Potenzial für die Sozialpsychiatrie, dieses Konzept noch weiter auszubauen, um Begegnungen schaffen zu können. Am geeignetsten wäre hierfür ein multiprofessionelles Team, welches mehrere Perspektiven und vielfältiges Expertenwissen einbringen kann, zum Beispiel EX-IN Genesungsbegleiter*innen, erfahrene Community Musicians, (sozial-)psychiatrisches Fachpersonal aber auch motivierte Bürger*innen vor Ort. Möglich wäre so auch die Weiterentwicklung zu einem therapeutischen Konzept.
In der Auswertung des Projektes ist deutlich geworden, dass eine inklusive, akzeptierende Umgebung, in der jede*r so sein kann wie er/sie ist inklusive aller „Fehler“, Schwierigkeiten und Unsicherheiten, für allewohltuend ist, nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen. Durch eine uneingeschränkte (kulturelle) Teilhabe kann die Lebensqualität deutlich verbessert werden, ob nun mit oder ohne psychische Erkrankung. Man kann zwar nicht auf einen Schlag die gesamte Gesellschaft verändern, wohl aber versuchen, im Kleinen inklusive Bedingungen zu schaffen. Je mehr dies in überschaubaren Rahmen wie in diesem Projekt umgesetzt wird, umso mehr wird auch gesamtgesellschaftlich dem Ziel der Inklusion nähergekommen. Mit Community Music Projekten kann hierzu definitiv ein Beitrag geleistet werden.
8. Quellen- und Literaturverzeichnis
Bartleet, Brydie-Leigh; Higgins, Lee (Hrsg): The Oxford Handbook of Community Music, New York: Oxford University Press, 2018
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Hrg): Die UN-Behindertenrechtskonvention - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Stand: Januar 2017, https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2 , zuletzt aufgerufen am 04.08.2020
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. (Hrsg.): „denk-an-stöße“ – Grundsätze, Kontroversen, Ziele,Köln: 5., überarbeitete Auflage 2017
Dollerschell, Bernhard; Ortolf, Martin: Partizipation aus Perspektive der Psychiatrie-Erfahrenen: Teilhabe bei psychischen Erkrankungen in: Bliemetsrieder, Sandro; Maar, Katja; Schmidt, Josephina; Tsirikiotis, Athanasios (Hrsg.): Partizipation in sozialpsychiatrischen Handlungsfeldern, Hochschule Esslingen, 2018
Higgins, Lee: Community Music – In Theory and In Practice, New York: Oxford University Press, 2012
Higgins, Lee: Community Music verstehen – Theorie und Praxis, in: Hill, Burkhard; BanffyHall, Alicia (Hrsg.): Community Music - Beiträge zur Theorie und Praxis aus internationaler und deutscher Perspektive , Münster/New York: Waxmann, 2017
Hill, Burkhard; BanffyHall, Alicia (Hrsg.): Community Music - Beiträge zur Theorie und Praxis aus internationaler und deutscher Perspektive , Münster/New York: Waxmann, 2017
Kahl, Yvonne: Inklusion und Teilhabe aus der Perspektive von Menschen mit psychischen Erkrankungen, Köln: Psychiatrie-Verlag, 2016
Kellmann, Markus: Arm dran. Wie Menschen mit seelischer Behinderung soziale Teilhabe verwehrt wird, in: Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (Hrsg.): soziale psychiatrie, Heft 03/2019
Masanz, Klaus: „Und ich steh immer draußen, vor der Türe!“ – Exklusionsprozesse und biographische Strukturierung von jungen, psychisch kranken, suchtkranken und wohnungslosen Menschen, Kassel: kassel university press GmbH, 2019
Meins, Anna; Röh, Dieter: Sozialraumorientierung und das Bundesteilhabegesetz, in: Beb (Hrsg.): Kerbe – Forum für soziale Psychiatrie,Heft 02/2020
Ratzke, Katharina; Bayer, Wolfgang; Bunt, Svenja (Hg.): Inklusion für die gemeindepsychiatrische Praxis – Erfahrungen aus einem Modellprojekt, Köln: Psychiatrie Verlag GmbH, 2020
Shiloh, C. J.; Blythe Lagasse, A.: Sensory Friendly Concerts: A community music therapy initiative to promote Neurodiversity, in: International Journal of Community Music,Heft 7/1, 2014
Simon; Christine: Community Music Therapy – Musik stiftet Gemeinschaft , Klein Jasedow: Drachen Verlag GmbH, 2013
Speck, Andreas; Steinhart, Ingmar; Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.(Hg.): Abgehängt und chancenlos? Teilhabechancen und -risiken von Menschen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen, Köln: Psychiatrie-Verlag, 2018
Stige, Brynjulf: Community music therapy and the process of learning about and struggling for openness, in: International Journal of Community Music,Heft 7/1, 2014
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Teilhabesituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen und wie Community Music als inklusiver Ansatz genutzt werden kann, um Barrieren abzubauen. Sie analysiert das Community Music Projekt "Musik in X", bei dem Bewohner einer Wohnstätte für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen und andere Musikinteressierte zusammen musizierten.
Was ist Community Music?
Community Music ist ein Ansatz, der allen Menschen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen oder Vorerfahrungen, einen aktiven Zugang zu Musik ermöglichen soll. Es geht darum, hierarchische Muster in der Musikszene abzubauen und eine "kulturelle Demokratie" zu etablieren, in der Vielfalt anerkannt und wertgeschätzt wird.
Welche Barrieren hindern Menschen mit psychischen Erkrankungen an der Teilhabe am kulturellen Leben?
Zu den Barrieren gehören die Leistungsorientierung der Gesellschaft, Stigmatisierung, Selbststigmatisierung, Rückzug aus sozialen Kontexten, finanzielle Schwierigkeiten, fehlende soziale Kontakte und die mit der psychischen Krankheit einhergehenden Symptome.
Was ist für eine inklusive Praxis mit Psychiatrie-Erfahrenen notwendig?
Es braucht eine personenzentrierte, flexible Unterstützung, inklusive und offene Räume in der Gesellschaft, Rahmenbedingungen, die eine offene Definition von "normal" erlauben, partizipative Ansätze bei der Planung und Durchführung von Angeboten, die Vernetzung lokaler Akteure und Projekte, und den Abbau von Stigmatisierung.
Was war das Ziel des Projekts "Musik in X"?
Das Ziel war, einen offenen Raum zu schaffen, in dem Menschen mit und ohne psychische Erkrankungen gemeinsam musizieren können, um soziale Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaft zu erleben und Barrieren abzubauen. Es sollte ein unvoreingenommenes Kennenlernen ermöglicht werden, bei dem die Teilnehmenden sich einfach als Menschen mit einem gemeinsamen Interesse an Musik begegnen.
Wie wurde das Projekt "Musik in X" ausgewertet?
Das Projekt wurde mithilfe von qualitativen Leitfadeninterviews mit Teilnehmenden ausgewertet. Die Interviews wurden transkribiert und analysiert, um die Wahrnehmung des Projekts, die Erfüllung der Kriterien für Community Music und das Erleben einer inklusiven Praxis zu erfassen.
Welche Ergebnisse brachte die Auswertung des Projekts?
Die Auswertung zeigte, dass das Projekt in Teilen die Prinzipien von Community Music und Inklusion umsetzen konnte, aber auch Barrieren und Verbesserungspotenziale aufdeckte. Es wurde ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, soziale Kontakte geknüpft und Selbstbewusstsein gestärkt. Die geringe Leistungsorientierung wurde als positiv empfunden, aber auch Unsicherheiten im Umgang mit psychischen Erkrankungen und der Wunsch nach mehr Informationen und Unterstützung wurden deutlich. Die Musik wirkte als "Brücke" zur Annäherung und zum Abbau von Vorurteilen.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Projekt ziehen?
Community Music Projekte bieten vielseitige Chancen für eine inklusive Praxis mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Schaffung der notwendigen Bedingungen erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, partizipative Ansätze, die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und die Einbeziehung von Fachkräften und Genesungsbegleitern.
Was hätte man bei dem Projekt anders machen können?
Es wäre sinnvoll gewesen, stärker mit partizipativen Methoden zu arbeiten, die Bewohner der Wohnstätte und andere Dorfbewohner stärker in den Planungsprozess einzubeziehen, einen Diskurs zum Thema psychische Erkrankungen anzubieten, Räume für Sorgen und Ängste zu schaffen, und das Projekt insgesamt inklusiver zu gestalten.
Welche Rolle spielte die Musik bei dem Projekt?
Die Musik spielte eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Verbindungen und dem Abbau von Barrieren. Sie diente als "Brücke" zur Annäherung und ermöglichte es den Teilnehmenden, sich auf einer gemeinsamen Ebene zu begegnen. Das gemeinsame Musizieren schaffte eine lockere Atmosphäre und förderte die Entstehung von Gemeinschaft.
Welchen Beitrag können Community Music Projekte zur Inklusion leisten?
Community Music Projekte können einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen leisten, indem sie Schutzräume in der Gesellschaft schaffen, Vorurteile abbauen, soziale Kontakte fördern, Selbstbewusstsein stärken und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Es ist wichtig, die notwendigen Bedingungen für eine inklusive Praxis zu schaffen und die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden zu berücksichtigen.
- Quote paper
- Franziska Lagg (Author), 2020, Community Music und inklusive Praxis mit Psychiatrie-Erfahrenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1391765