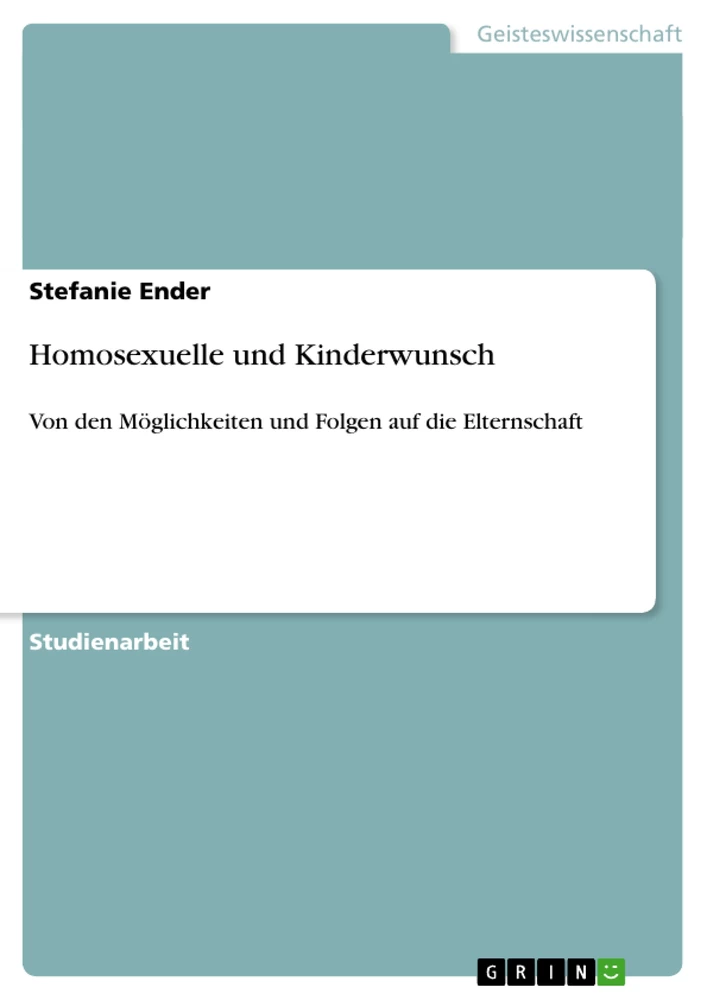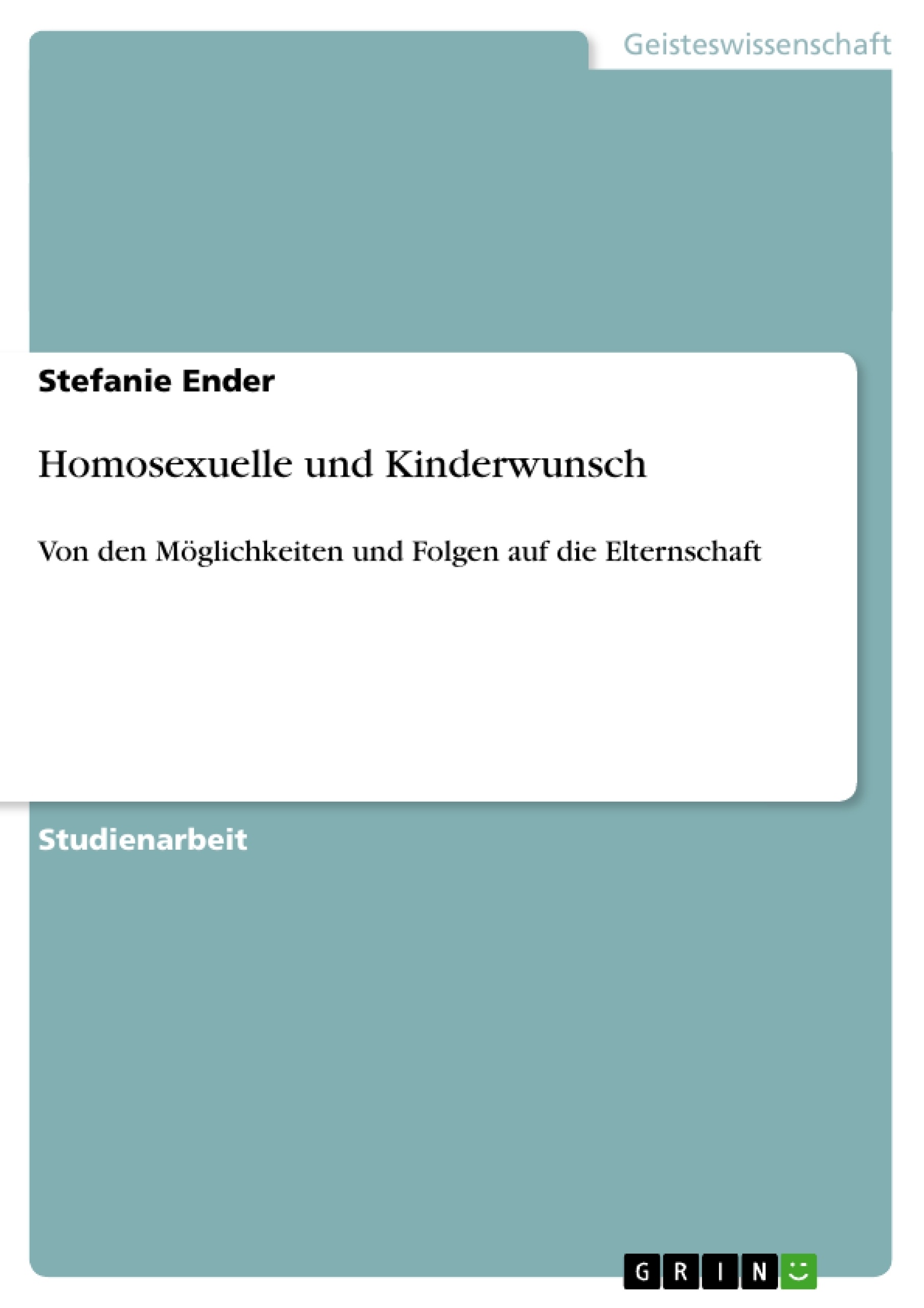Lange litten Homosexuelle unter gesellschaftlicher und rechtlicher Diskriminierung. Im Nationalsozialismus wurden sie in Deutschland sogar in Konzentrationslagern vernichtet. Heute ist die gesellschaftliche Diskriminierung zunehmend einer immer breiter werdenden Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren gewichen. Ab dem 1. August 2001 ist es homosexuellen Paaren durch das Lebenspartnerschaftsgesetz in Deutschland möglich "dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit [zu] erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen"1. Die Lebenspartnerschaft einzugehen ist zwar nicht das gleiche wie zu heiraten, aber es stellt eine erhebliche Verbesserung der rechtlichen Lage für Homosexuelle dar. Dennoch ergeben sich für Homosexuelle rechtliche Nachteile, wenn sie ihren Kinderwunsch realisieren möchten, eben aus dem Grund, weil sie in Deutschland keine Ehe eingehen können.
In dieser Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie es homosexuellen Paaren trotz der meist hinderlichen Rechtslage in Deutschland möglich ist, ihren Kinderwunsch zu realisieren. Weiterführend soll untersucht werden, welche Folgen die verschiedenen Familienformen, die aus der Realisierung des Kinderwunsches Homosexueller entstanden, auf die Formen von Elternschaft haben. Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mich mit Literatur über homosexuelle Eltern zu beschäftigen versucht. Leider ist dieses Gebiet in der Soziologie2 bisher wenig erforscht worden und ich musste eine Beratungsbroschüre des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland e.V.3 zu Rate ziehen, obwohl die Daten, die dort genannt werden, nicht hinreichend belegt sind. Dieses Problem sollte in naher Zukunft durch wissenschaftliche Analysen zum Thema "Kinderwunsch Homosexueller" behoben werden. In der vorliegenden Hausarbeit beginne ich in Kapitel 2 die Formen von Elternschaft zu erläutern, die es nach Hoffmann-Riem gibt. In Kapitel 3 beschreibe ich Möglichkeiten, die Homosexuelle haben, um ihren Kinderwunsch zu realisieren. Dabei gehe ich auf rechtliche Beschränkungen in Deutschland ein und versuche Lösungen für diese Probleme zu geben. In Kapitel 4 untersuche ich die Folgen auf die Elternschaft bzw. erkläre die resultierende Komplexität der Elternschaft. In Kapitel 5 gehe ich darauf ein, welche Konsequenzen sich aus der Komplexität der Elternschaft und der Tatsache, dass ein Kind homosexuelle Eltern hat, für die Elter-Kind-Beziehung ergeben.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Formen von Elternschaft
3. Möglichkeiten zur Realisierung des Kinderwunsches
3.1. Adoption
3.2. Heterologe Insemination
3.3. Pflegschaft
3.4. Leihmutterschaft
3.5. Queer - Familie
4. Folgen auf die Formen von Elternschaft
4.1. Adoptionsfamilie
4.2. Familie aus heterologer Insemination
4.3. Pflegschaftsfamilie
4.4. Familie, die auf Leihmutterschaft gründet
4.5. Queer - Familie
5. Folgen auf die Elter-Kind-Beziehung
6. Zusammenfassung
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Lange litten Homosexuelle unter gesellschaftlicher und rechtlicher Diskriminierung. Im Nationalsozialismus wurden sie in Deutschland sogar in Konzentrationslagern vernichtet. Heute ist die gesellschaftliche Diskriminierung zunehmend einer immer breiter werdenden Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren gewichen. Ab dem 1. August 2001 ist es homosexuellen Paaren durch das Lebenspartnerschaftsgesetz in Deutschland möglich "dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit [zu] erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen"[1]. Die Lebenspartnerschaft einzugehen ist zwar nicht das gleiche wie zu heiraten, aber es stellt eine erhebliche Verbesserung der rechtlichen Lage für Homosexuelle dar. Dennoch ergeben sich für Homosexuelle rechtliche Nachteile, wenn sie ihren Kinderwunsch realisieren möchten, eben aus dem Grund, weil sie in Deutschland keine Ehe eingehen können.
In dieser Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie es homosexuellen Paaren trotz der meist hinderlichen Rechtslage in Deutschland möglich ist, ihren Kinderwunsch zu realisieren. Weiterführend soll untersucht werden, welche Folgen die verschiedenen Familienformen, die aus der Realisierung des Kinderwunsches Homosexueller entstanden, auf die Formen von Elternschaft haben. Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mich mit Literatur über homosexuelle Eltern zu beschäftigen versucht. Leider ist dieses Gebiet in der Soziologie[2] bisher wenig erforscht worden und ich musste eine Beratungsbroschüre des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland e.V.[3] zu Rate ziehen, obwohl die Daten, die dort genannt werden, nicht hinreichend belegt sind. Dieses Problem sollte in naher Zukunft durch wissenschaftliche Analysen zum Thema "Kinderwunsch Homosexueller" behoben werden. In der vorliegenden Hausarbeit beginne ich in Kapitel 2 die Formen von Elternschaft zu erläutern, die es nach Hoffmann-Riem gibt. In Kapitel 3 beschreibe ich Möglichkeiten, die Homosexuelle haben, um ihren Kinderwunsch zu realisieren. Dabei gehe ich auf rechtliche Beschränkungen in Deutschland ein und versuche Lösungen für diese Probleme zu geben. In Kapitel 4 untersuche ich die Folgen auf die Elternschaft bzw. erkläre die resultierende Komplexität der Elternschaft. In Kapitel 5 gehe ich darauf ein, welche Konsequenzen sich aus der Komplexität der Elternschaft und der Tatsache, dass ein Kind homosexuelle Eltern hat, für die Elter-Kind-Beziehung ergeben.
2. Formen von Elternschaft
In der Kernfamilie[4], dem Familienmodell, welches heutzutage als anzustrebende Normalität[5] gilt, gibt es einen Vater und eine Mutter, die die biologischen Eltern eines Kindes sind. Ein Paar zeugt zusammen ein Kind und lebt mit ihm als rechtlich anerkannte Familie zusammen in einem Haushalt. Aus diesem Grund sind die biologischen Eltern des Kindes in der Kernfamilie auch die sozialen und rechtlichen Eltern.
Was bedeutet biologische, rechtliche und soziale Elternschaft? Biologische Elternschaft zeichnet sich durch eine Verwandtschaftsbeziehung zu einem Kind aus. Ein biologischer Elter hat auf natürlichem Weg ein Kind gezeugt.[6] Die soziale Elternschaft kennzeichnet nicht eine Verwandtschaftsbeziehung, sondern eine persönliche Beziehung, ein weiter gefasster Begriff von Karl Lenz und Frank Nestmann[7], der nicht nur eine Elter-Kind-Beziehung im herkömmlichen Sinne einschließt. Ein sozialer Elter lebt dauerhaft mit dem Kind zusammen, wobei beide in der Regel in einem Haushalt leben und der soziale Elter eine Bindung zum Kind aufbaut. Meist werden die sozialen Eltern vom Kind "Mama" oder "Papa" genannt. Die rechtliche Elternschaft wiederum hat der inne, der vor dem Gesetz als Elter gilt. Rechtliche Eltern haben das Sorgerecht für das Kind und damit verbundene Rechte und Pflichten.
Wie oben angedeutet wurde, fallen die rechtliche, die soziale und die biologische Elternschaft in einer Kernfamilie zusammen. In davon abweichenden Familienformen ist das meist nicht der Fall. Abweichende Familienformen definieren sich gegenüber der Kernfamilie gerade durch die komplexeren Formen der Elternschaft in einer erweiterten Elternkette[8]. Und erst dadurch, dass es abweichende Familienformen gibt, wurden die verschiedenen Formen der Elternschaften erkennbar.
In dieser Hausarbeit geht es um die Elternschaft von homosexuellen Paaren, in den Familienformen, die sie bilden können. Es soll hier nicht diskutiert werden ob die Partner Mutter- und Vaterrolle einnehmen oder eine gänzlich andere Elternrolle spielen. Es geht hier ausschließlich um die soziale, biologische und rechtliche Elternschaft und ihre Eigenschaften, wie sie oben beschrieben wurden. Um die Komplexität der Elternschaft zu erklären, die sich aus gleichgeschlechtlichen Familienformen ergeben, müssen zunächst die Möglichkeiten erklärt werden, mit denen homosexuelle Paare eine Familie mit mindestens einem Kind gründen können.
3. Möglichkeiten zur Realisierung des Kinderwunsches
Da homosexuelle Paare auf natürlichem Weg[9] keine Kinder zeugen können, müssen sie im Falle eines Kinderwunsches andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Es ist in jedem Fall ein Dritter notwendig.[10] Nicht alle homosexuellen Paare haben den Wunsch nach einem "eigenen Kind". Lange galt es in der Lesben- und Schwulenszene als authentisch keinen Kinderwunsch zu haben. Die Betroffenen wurden als "unechte" Homosexuelle verspottet.[11] Heute haben homosexuelle Paare vermehrt den Wunsch mit Kindern zusammen zu leben. Verschiedene Studien nennen dazu unterschiedliche Daten.[12] Ich möchte hier die Zahlen anführen, die der Beratungsführer des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland e.V. 2002 veröffentlicht hat: "Umfragen zufolge will heute jede zweite lesbische Frau und jeder dritte schwule Mann in Deutschland gerne mit Kindern zusammenleben."[13] Andere Studien nennen Daten, die davon mehr oder weniger abweichen. Das kommt davon, weil es schwer ist das Phänomen des homosexuellen Lebensentwurfs zu fassen bzw. "zwischen Episoden, homoerotischen Erfahrungen, stabilen Beziehungen und Lebensformen"[14] zu unterscheiden. Außerdem ist es in Deutschland aus Datenschutzgründen nicht erlaubt nach der sexuellen Orientierung der Befragungspersonen zu fragen. Die neueren Studien zeigen jedoch, dass die
Akzeptanz von homosexuellen Paaren als Eltern in der Schwulen- und Lesbenszene zugenommen hat, wenn Paare bereit sind, ihren Kinderwunsch zu artikulieren. Außerdem wurden deutschlandweit Selbsthilfegruppen gegründet, die sich an Homosexuelle mit Kinderwunsch richten.
Wenn Kinder in einem homosexuellen Haushalt leben, stammen sie meist aus einer früheren heterosexuellen Beziehung von einem der Partner. Manchmal haben die Paare den Wunsch, ein gemeinsames Kind zu bekommen.[15] Wie sie diesen Wunsch trotz der hinderlichen Rechtslage in Deutschland in die Tat umsetzen können, möchte ich im folgenden Kapitel erläutern.
3.1. Adoption
Bei der Adoption bekommen heute "sozial- und biologischelternlose Kinder die Möglichkeit in einer Familie aufzuwachsen."[16] Durch eine Adoption übernehmen Menschen, die durch ein Auswahlverfahren gründlich auf ihre soziale und finanzielle Eignung überprüft wurden, die Verantwortung und bekommen das Sorgerecht für ein Kind. Es ist aber zu beobachten, dass "die Ansprüche an die Qualität des Umfeldes adoptionswilliger Personen steigen, soziale Sicherheit ist ein entscheidendes Kriterium."[17]
Homosexuelle haben in Deutschland die Möglichkeit ein Kind zu adoptieren. Jedoch beschränkt das Bürgerliche Gesetzbuch diese Möglichkeit auf einen der Partner. Dort heißt es nämlich: "Wer nicht verheiratet ist, kann ein Kind nur alleine annehmen."[18] Da homosexuelle Paare in Deutschland zwar die Lebenspartnerschaft, nicht aber die Ehe eingehen können[19], bleibt ihnen eine gemeinsame Adoption eines Kindes verwehrt. Das Sorgerecht für das adoptierte Kind hat immer der Adoptierende, der Partner kann es im Nachhinein nur erhalten, wenn beide eine Sorgeerklärung unterschreiben oder wenn beide in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben und er das Verfahren der Stiefkindadoption durchläuft.[20]
Seit 2005 gibt es in Deutschland die Stiefkindadoption, durch die das Kind des Partners adoptiert werden kann. Dieses Verfahren gilt nur, wenn das Kind keinen leiblichen Vater hat, also durch einen sogenannten No-Spender, einen anonymen Samenspender, in-vitro gezeugt wurde, oder wenn der biologische Vater der Stiefkindadoption zugestimmt hat.[21] Durch die Stiefkindadoption bekommt der Lebenspartner das "kleine Sorgerecht" zugesprochen. Er hat damit "im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil die Befugnis zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des alltäglichen Lebens" und bei Gefahr im Verzug ist er berechtigt, "alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohle des Kindes notwendig sind".[22] Es liegt jedoch in den Angelegenheiten des Gerichtes, wie das "Wohl des Kindes" definiert wird. Aus diesem Grund ist das "Kleine Sorgerecht" durch die Gesetzgebung zu ungenau definiert worden. Außerdem stellt das "Kleine Sorgerecht" keine großartige Verbesserung dar. Da die Partner, um das "Kleine Sorgerecht" zu bekommen, sowieso in einer Lebenspartnerschaft leben müssen, ist die Fürsorge für das Kind des Partners auch ohne "Kleines Sorgerecht" meist selbstverständlich. Nach einer Trennung und einer längeren Zeit des Getrenntlebens verliert der Lebenspartner das "Kleine Sorgerecht" und hat keinerlei Rechte oder Pflichten gegenüber dem Kind mehr, so wie es ohne "Kleines Sorgerecht" auch wäre.[23]
Die meisten homosexuellen Paare bekommen in Deutschland auf Adoptionsanfragen allerdings Ablehnungsbescheide. Adoptionsstellen befürchten, dass gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen nicht von langer Dauer sind und dass das Kind durch eine Adoption zu einem homosexuellen Paar einer doppelten Belastung ausgesetzt wäre: nämlich der Belastung der Adoption an sich und der zusätzlichen Stigmatisierung seiner sozialen Umwelt gegenüber dem homosexuellen Paar, welches seine sozialen Eltern sind.[24] Homosexuelle haben zwei Möglichkeiten zu einer höheren Chance auf ein Adoptivkind. Oft verraten sie ihre sexuelle Orientierung und geben den Adoptionsbehörden an, sie würden das Kind als Einzelperson annehmen wollen. Die Adoption durch Einzelpersonen ist im Vergleich zur Adoption durch Ehepaare selten, aber dennoch verspricht dieses Vorgehen bessere Chancen, als wenn der Adoptierende angibt, das Kind mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner aufziehen zu wollen.[25]
[...]
[1] vgl. Lebenspartnerschaftsgesetz im BGB
[2] Auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen wie zum Beispiel Pädagogik und Psychologie ist das Thema bisher wenig erforscht worden.
[3] vgl. Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland e.V. (2007):
Regenbogenfamilien - alltäglich und doch anders. Beratungsführer für lesbische Mütter, schwule Väter und familienbezogenes Fachpersonal.
[4] In der Literatur taucht immer wieder dieser Begriff auf. Im Folgenden wird er auch hier verwendet werden.
[5] Die Kernfamilie ist die Familienform, die in der Gesellschaft als normal gilt. Es ist eine Norm diese Familienform anzustreben. Vgl. dazu Hoffmann-Riem, Christa (2008): Der Verlust von Natur und "Natürlichkeit" am Beispiel von Zeugung und Schwangerschaft.
[6] Vgl. Hoffmann-Riem, Christa (2008): Der Verlust von Natur und "Natürlichkeit" am Beispiel von Zeugung und Schwangerschaft. S. 172ff.
[7] Vgl. Lenz, Karl & Frank Nestmann (2009): Handbuch Persönliche Beziehungen.
[8] vgl. Hoffmann-Riem, Christa (2008): Der Verlust von Natur und "Natürlichkeit" am Beispiel von Zeugung und Schwangerschaft. S. 195ff.
[9] Die Bezeichnung "natürlicher Weg" wurde hier in Anlehnung an Hoffmann-Riem gewählt, die den natürlichen bzw. Normalfall einer Familie in der Kernfamilie sieht. Die Kernfamilie besteht im ursprünglichen Sinn aus einem Paar, welches durch Geschlechtsverkehr ein Kind zeugt und somit eine Familie begründet.
[10] Vgl. Pohl, Gudrun-Maria (2006): Regenbogenfamilien und Kinder. Zum Aufwachsen von Kindern in homosexuellen Familien. S. 27.
[11] Vgl. ebd. S. 25.
[12] Vgl. ebd. S. 26.
[13] Vgl. Schwules Netzwerk NRW (1999).Lesbische und schwule Familien. Ergebnisse einer Befragung unter Lesben und Schwulen in NRW.oder vgl. Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland e.V. (2007): Regenbogenfamilien - alltäglich und doch anders. Beratungsführer für lesbische Mütter, schwule Väter und familienbezogenes Fachpersonal. S. 9.
[14] Birgit Bernhardt, www.webfamilie.at/Artikel199.html2002
[15] Vgl. Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland e.V. (2007): Regenbogenfamilien - alltäglich und doch anders. Beratungsführer für lesbische Mütter, schwule Väter und familienbezogenes Fachpersonal. S. 26.
[16] Pohl, Gudrun-Maria (2006): Regenbogenfamilien und Kinder. Zum Aufwachsen von Kindern in homosexuellen Familien. S. 32.
[17] Ebd. S. 32.
[18] BGB §1741
[19] Vgl. Lebenspartnerschaftsgesetz
[20] BGB §1626
[21] Vgl. BGB § 1626
[22] Lebenspartnerschaftsgesetz §9
[23] Vgl. Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland e.V. (2007): Regenbogenfamilien - alltäglich und doch anders. Beratungsführer für lesbische Mütter, schwule Väter und familienbezogenes Fachpersonal. S. 65ff.
[24] Vgl. Pohl, Gudrun-Maria (2006): Regenbogenfamilien und Kinder. Zum Aufwachsen von Kindern in homosexuellen Familien. S. 33f.
[25] Vgl. ebd. S. 33f.
- Quote paper
- Stefanie Ender (Author), 2009, Homosexuelle und Kinderwunsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139154