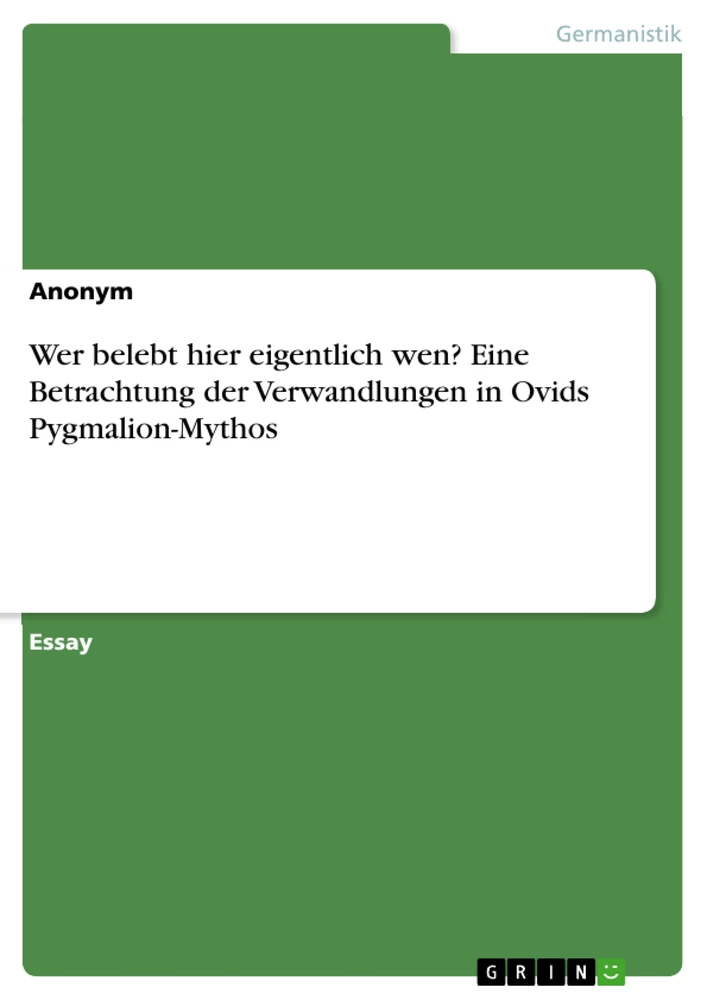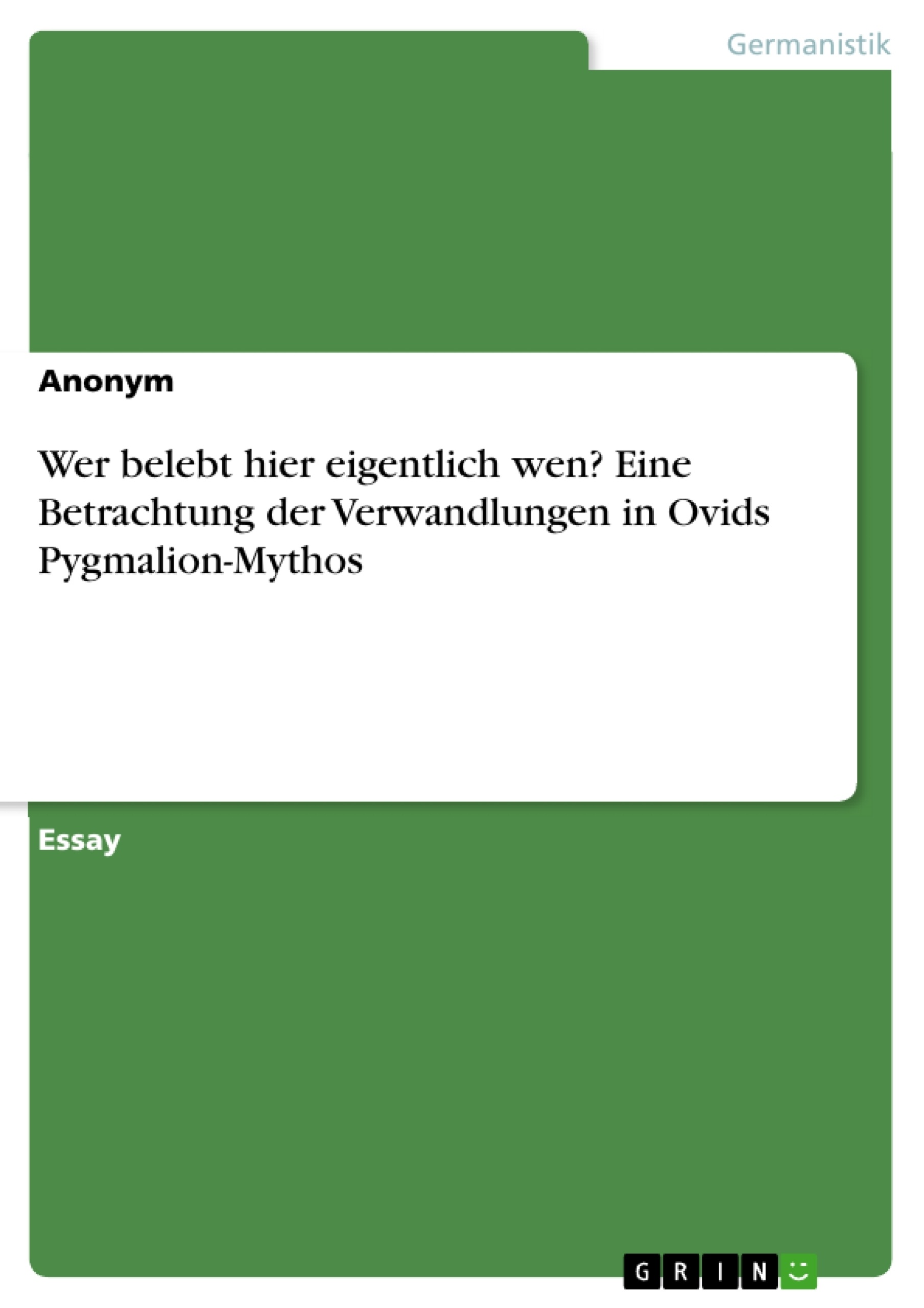Im Pygmalion Mythos Ovids ersehnt sich der Protagonist eine Geliebte, die sein Lager mit ihm teilt. AUs Verzweiflung schafft er sich eines Tages eine wunderschöne Frauenstatue aus Elfenbein, in die er sich verliebt. Bis zu dieser Stelle mag man meinen, Pygmalion sei hier der aktive Part, das Subjekt, und somit Ausgangspunkt der Handlung. Er ist es schließlich, der das tote Material „belebt“, indem er daraus eine Figur schöpft, die beinah aussieht „wie ein wirkliches Mädchen“. Doch nun geht auf einmal ein Feuer vom Objekt aus. Ist dieses etwa doch nicht so passiv, wie es scheint?
Wird womöglich nicht ausschließlich auf die Statue eingewirkt, sondern wirkt diese auch auf ihren Erschaffer? Wer belebt hier eigentlich wen?
Inhaltsverzeichnis
- Wer belebt hier eigentlich wen?
- Der Mythos „Pygmalion“
- Die Metamorphose der Statue
- Von Natur zu Kunst: Pygmalions Rolle
- Von Kunst zu Natur: Venus' Rolle
- Die Metamorphose des Künstlers
- Die admiratio als passive Emotion
- Emotionale Reanimation des Betrachters
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Rolle der Verwandlungen in Ovids Pygmalion-Mythos, wobei er sich insbesondere auf die Frage konzentriert, wer hier eigentlich wen belebt. Er analysiert die Metamorphose der Statue von Elfenbein zu einem lebenden Körper und die damit einhergehende Veränderung des Künstlers Pygmalion, der durch die Begegnung mit seinem Kunstwerk emotional wieder zum Leben erweckt wird.
- Die Wechselwirkung von Kunst und Natur im Pygmalion-Mythos
- Die Rolle der Mimesis in der Kunst und die Überwindung der Grenze zwischen Kunst und Natur
- Die emotionale Verwandlung des Künstlers Pygmalion
- Die Bedeutung der admiratio und die passive Rolle des Betrachters
- Die „Reanimation“ des Künstlers und sein Wandel von einem abgeklärten Mann zu einem liebenden Ehemann und Vater
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der Einführung des Pygmalion-Mythos, der in Ovids „Metamorphosen“ beschrieben wird. Er beleuchtet die geschichtliche Einbettung des Mythos und seine Beziehung zu anderen Verwandlungsgeschichten.
Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Analyse der Metamorphose der Statue. Dabei wird die Rolle des Bildhauers Pygmalion als Schöpfer der Kunstform hervorgehoben, die durch seine „glückliche Hand“ und seine Liebe zur Figur zum Leben erwacht. Die Rolle der Göttin Venus wird als „göttlicher Funke“ beschrieben, der die Statue endgültig zum Leben erweckt.
Der Text beschäftigt sich dann mit der Metamorphose des Künstlers Pygmalion. Durch seine Bewunderung der Statue wird er von seinen anfänglichen negativen Emotionen gegenüber Frauen befreit und findet schließlich die Liebe. Die Betrachtung der Statue löst in ihm eine „admiratio“ aus, die ihn emotional verändert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Pygmalion, Metamorphose, Verwandlung, Kunst, Natur, Mimesis, admiratio, Emotion, Reanimation, Statue, Elfenbein, Venus, Liebesgöttin, Propoetiden, Ovid, Metamorphosen, Kunst und Natur, Belebung, Wiederbelebung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Wer belebt hier eigentlich wen? Eine Betrachtung der Verwandlungen in Ovids Pygmalion-Mythos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1391361