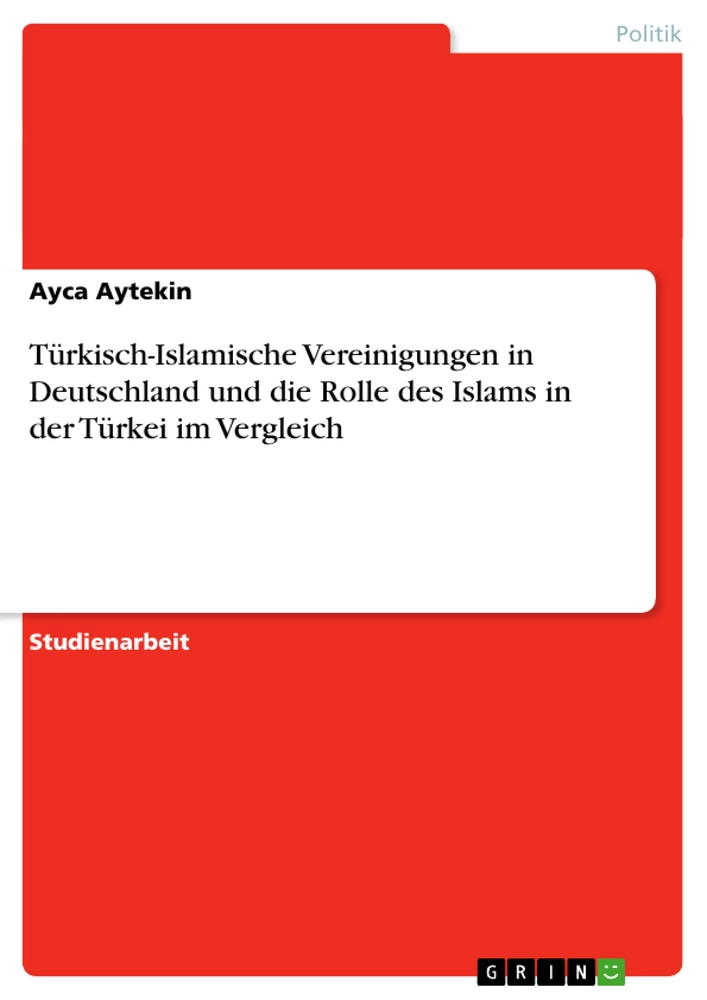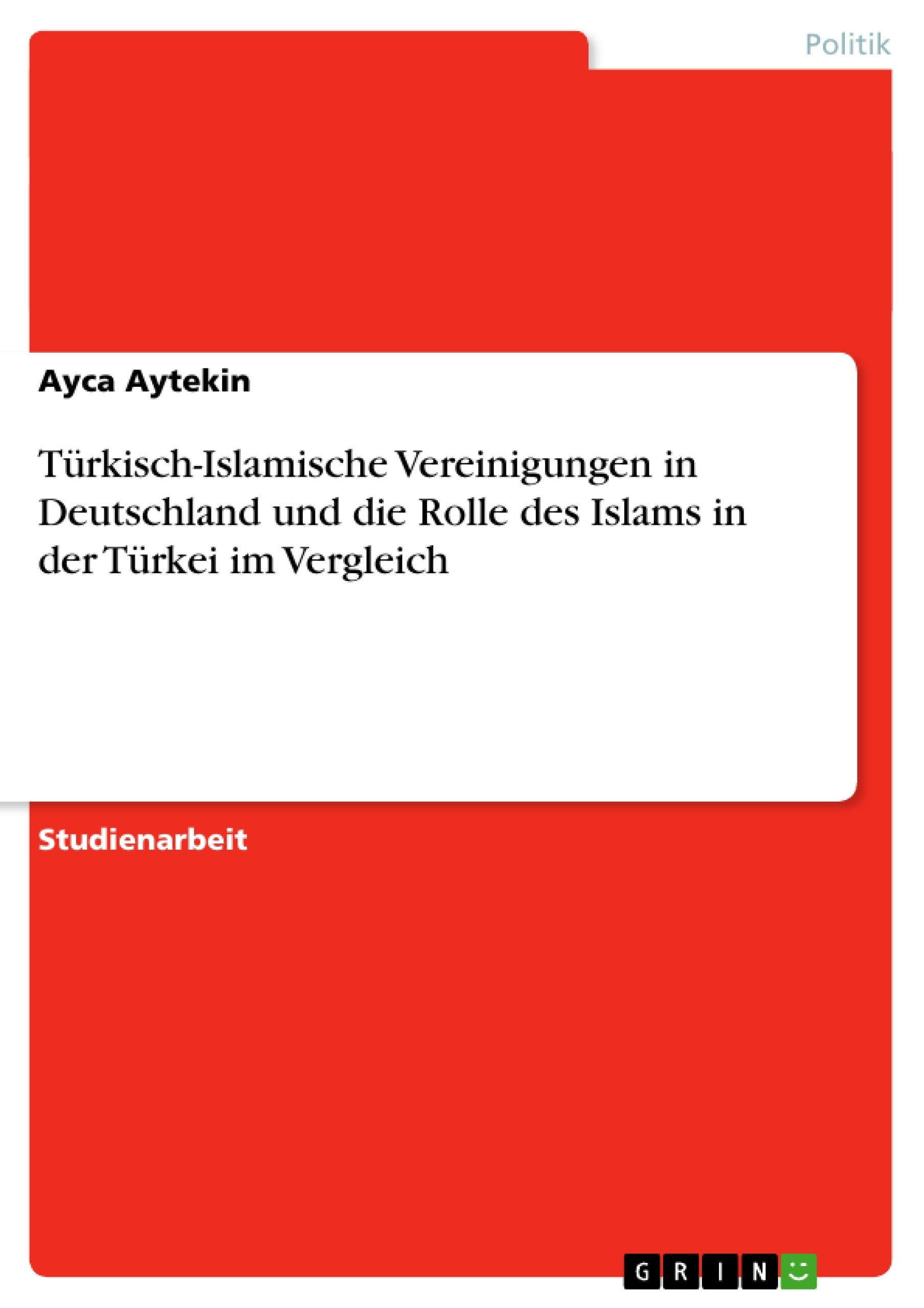Die muslimische Bevölkerung bildet in Deutschland einen wichtigen Teil der Gesellschaft, mit ca. 3,5 Mio. Muslimen aus verschiedenen Herkunftsländern. Die Türken bilden unter diesen Muslimen die größte Gruppe und ein Großteil ist dem sunnitischen Islam zuzuordnen. Der Rest bekennt sich zum Alevitentum. Die türkisch- muslimischen Vereinigungen verstehen sich als Repräsentanten der türkisch-muslimischen Gesellschaft und konnten sich mit den Jahren hervorragend organisieren und ein europaweites Netzwerk aufbauen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den türkisch-muslimischen Vereinigungen, Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V. (IGMG) , Verein islamischer Kulturzentren e. V. (VIKZ), Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) und der Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V. (AABF). Die Vereinigungen werden zunächst anhand der Sekundärliteratur dargestellt und zusätzlich wird die Internetpräsenz der Vereinigungen als Vergleich herangezogen. Die türkisch-islamischen Vereinigungen sind wichtige Kooperationspartner der deutschen Integrationspolitik. Aber der IGMG und VIKZ sind dabei umstrittene Partner und werden oft als ein Hindernis für die Integrationsbemühungen betrachtet, da sie aufgrund ihrer Haltung dem islamistischen Flügel zuzuordnen sind. Die Vorstellung der Vereinigungen versucht gleichzeitig Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den aufzuzeigen und ihre historische Entwicklung zu verstehen. Auffällig ist, dass keiner dieser Vereine ein „deutsches Produkt“ ist, sondern mit der Türkei eng in Verbindung steht und vor ihrer Gründung in Deutschland, in der Türkei bereits existiert hat. Der erfolgreichste ist wohl die IGMG, obwohl laut statistischen Angaben die Mehrheit der Türken sich durch die DITIB repräsentiert fühlen. Im Jahre 2005 fühlten sich 51,5 % der Türken durch die DITIB vertreten und nur 3,0 % von der IGMG.
Die IGMG ist im Gegensatz zu DITIB viel repräsenter und der Zusammenhalt ihrer Mitglieder stärker. Sie ist jedoch aus der Sicht der deutschen Politik ein hemmender Part der Integration. Es wäre nicht falsch zu behaupten, dass die IGMG sogar systematisch die „selbstgewollte Ausgrenzung“ von Türken, insbesondere von Mädchen und Frauen unterstützt. Zum Beispiel wird Eltern geholfen, ihre Töchter und auch Söhne vom Schwimm- und Sportunterricht zu befreien, dabei beruft sich die IGMG gerne auf die Grundrechte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (DITIB)
- 2.1 Selbstdarstellung und Internetpräsenz der DITIB
- 3. Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e. V. (IGMG)
- 3.1 Selbstdarstellung und Internetpräsenz der IGMG
- 4. Verband islamischer Kulturzentren e. V. (VIKZ)
- 4.1 Selbstdarstellung und Internetpräsenz der VIKZ
- 5. Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. (AABF)
- 5.1 Selbstdarstellung und Internetpräsenz der AABF
- 6. Zusammenfassung
- 7. Islam im Osmanischen Reich
- 7.1 Atatürk und seine Reformen
- 8. Zusammenfassung der Rolle des Islam in der Türkei
- 9. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht türkisch-islamische Vereinigungen in Deutschland und vergleicht deren Rolle mit der des Islams in der Türkei. Die Zielsetzung ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Vereinigungen aufzuzeigen und ihre historische Entwicklung im Kontext der türkischen und deutschen Gesellschaft zu verstehen.
- Die Rolle türkisch-islamischer Vereinigungen in der deutschen Integrationspolitik
- Vergleich der verschiedenen Vereinigungen (DITIB, IGMG, VIKZ, AABF) hinsichtlich ihrer Selbstverortung und Integrationsbemühungen
- Der Einfluss der Türkei auf die Organisation und die Ideologie der Vereinigungen
- Die Entwicklung des Islams in der Türkei und die Beziehung zwischen Laizismus und Religion
- Die spezifische Situation der Aleviten in Deutschland und der Türkei
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der muslimischen Bevölkerung in Deutschland, insbesondere der türkischstämmigen Muslime, dar und führt in die Thematik der türkisch-islamischen Vereinigungen ein. Sie benennt die im weiteren Verlauf untersuchten Vereinigungen (DITIB, IGMG, VIKZ, AABF) und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf Sekundärliteratur und Internetpräsenzen der Vereinigungen basiert. Der Fokus liegt auf der Rolle dieser Organisationen in der Integrationsdebatte und ihren Verbindungen zur Türkei. Die Einleitung weist auf die Komplexität der Beziehungen zwischen den Vereinen und die Herausforderungen der Integration hin, wobei die IGMG als umstrittener Akteur hervorgehoben wird.
2. Die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (DITIB): Dieses Kapitel beschreibt die DITIB, ihre Gründung, ihre Organisation und ihre Beziehung zum türkischen Staat. Es hebt den laizistischen Charakter der DITIB hervor, der im Gegensatz zu anderen Vereinigungen wie der IGMG steht. Die DITIB wird als größter Akteur im Feld der türkisch-islamischen Vereinigungen in Deutschland vorgestellt, aber auch ihre kritische Rolle und ihren Einfluss der politischen Geschehnisse in der Türkei wird diskutiert. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der DITIB: Einerseits bemüht sie sich um Integration, andererseits wird ihre Nähe zum türkischen Staat kritisiert.
7. Islam im Osmanischen Reich: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Rolle des Islams im Osmanischen Reich, um die heutige Situation in der Türkei besser zu verstehen. Es beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Laizismus und Islam und führt in die Geschichte der Konflikte ein, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Der Abschnitt behandelt die Herausforderungen, vor denen die islamischen Gemeinschaften im Kontext der Säkularisierung standen und stehen.
Schlüsselwörter
Türkisch-islamische Vereinigungen, DITIB, IGMG, VIKZ, AABF, Integration, Laizismus, Islam in der Türkei, Aleviten, Deutschland, Religionspolitik, Integrationspolitik, Interkultureller Dialog, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Türkisch-Islamische Vereinigungen in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht türkisch-islamische Vereinigungen in Deutschland, insbesondere die DITIB, IGMG, VIKZ und AABF. Sie vergleicht deren Rolle mit der des Islams in der Türkei und beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Vereinigungen sowie deren historische Entwicklung im Kontext der türkischen und deutschen Gesellschaft.
Welche Vereinigungen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf vier Hauptvereinigungen: die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (DITIB), die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e. V. (IGMG), den Verband islamischer Kulturzentren e. V. (VIKZ) und die Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. (AABF).
Welche Aspekte der Vereinigungen werden betrachtet?
Die Analyse umfasst die Selbstdarstellung und Internetpräsenz der Vereinigungen, ihre Rolle in der deutschen Integrationspolitik, ihre Integrationsbemühungen, den Einfluss der Türkei auf ihre Organisation und Ideologie, sowie die spezifische Situation der Aleviten in Deutschland und der Türkei.
Wie wird die Rolle des Islams in der Türkei behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Islams im Osmanischen Reich, insbesondere die Reformen Atatürks und die komplexe Beziehung zwischen Laizismus und Religion in der Türkei. Dies dient als Kontext für das Verständnis der heutigen Situation und der Rolle der untersuchten Vereinigungen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf Sekundärliteratur und der Analyse der Internetpräsenzen der untersuchten Vereinigungen. Der Fokus liegt auf der Rolle dieser Organisationen in der Integrationsdebatte und ihren Verbindungen zur Türkei.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitel zur Einleitung, zu den einzelnen Vereinigungen (DITIB, IGMG, VIKZ, AABF), einem Kapitel zum Islam im Osmanischen Reich mit Fokus auf Atatürks Reformen, einer Zusammenfassung der Rolle des Islams in der Türkei, sowie einer Schlussfolgerung. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Türkisch-islamische Vereinigungen, DITIB, IGMG, VIKZ, AABF, Integration, Laizismus, Islam in der Türkei, Aleviten, Deutschland, Religionspolitik, Integrationspolitik, Interkultureller Dialog, Identität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle türkisch-islamischer Vereinigungen in Deutschland zu verstehen und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Integration und die komplexen Beziehungen zwischen den Vereinen und der Türkei.
Wie wird die IGMG in der Arbeit behandelt?
Die IGMG wird als umstrittener Akteur im Kontext der türkisch-islamischen Vereinigungen in Deutschland hervorgehoben. Ihre Rolle und ihr Verhältnis zur Türkei werden kritisch beleuchtet.
Wie wird die DITIB in der Arbeit dargestellt?
Die DITIB wird als größter Akteur im Feld der türkisch-islamischen Vereinigungen in Deutschland beschrieben. Ihre Ambivalenz wird hervorgehoben: Einerseits bemüht sie sich um Integration, andererseits wird ihre Nähe zum türkischen Staat kritisiert.
- Arbeit zitieren
- Ayca Aytekin (Autor:in), 2009, Türkisch-Islamische Vereinigungen in Deutschland und die Rolle des Islams in der Türkei im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139132