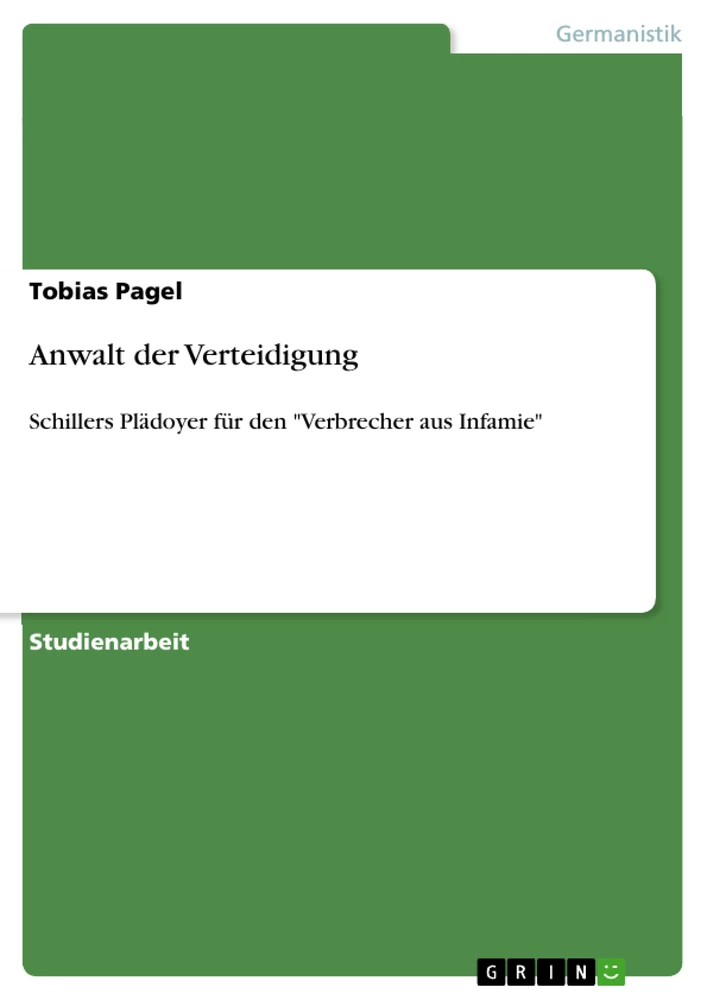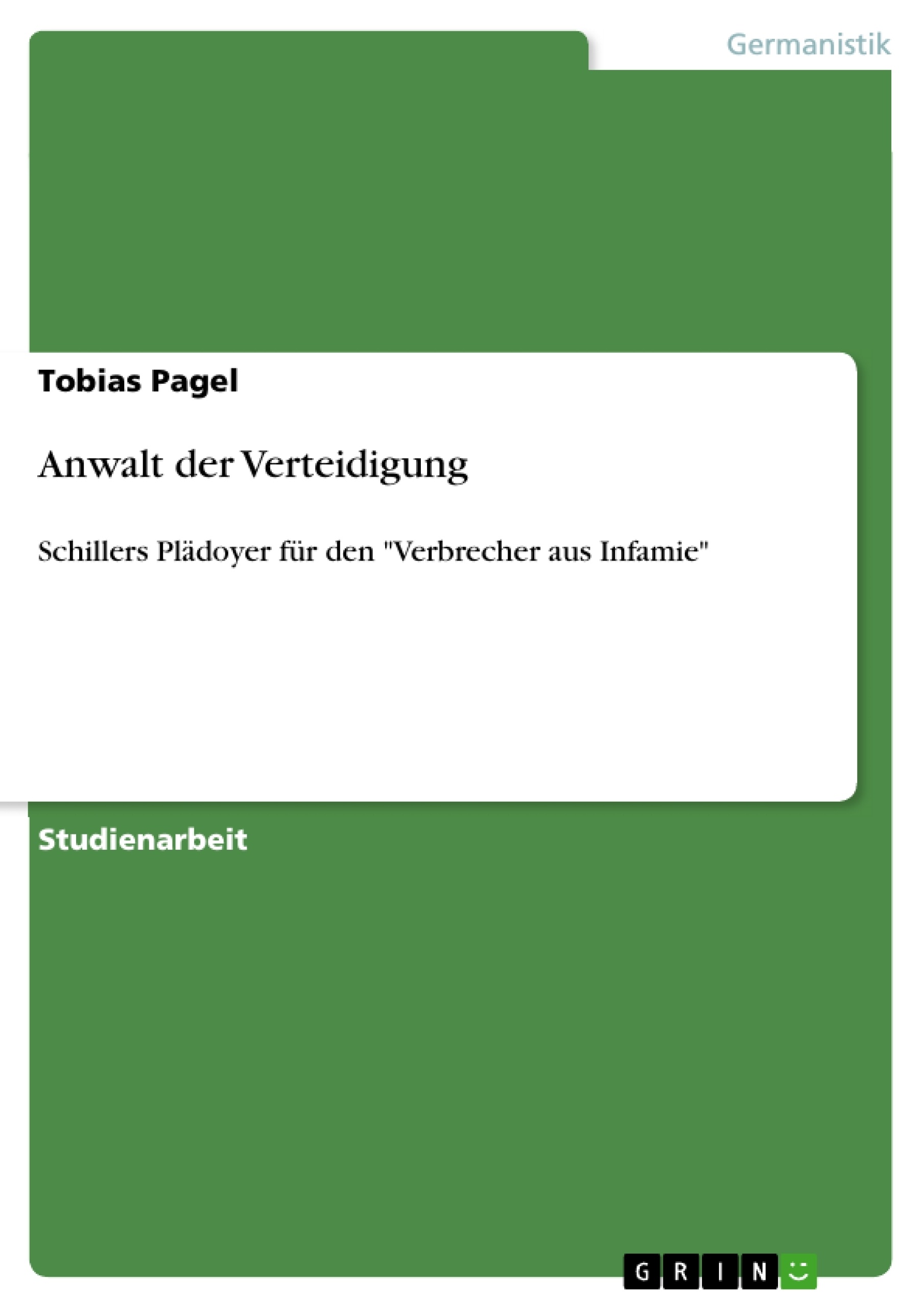1.Einleitung
Unzurechnungsfähigkeit, Lebensumstände, Motiv, Mitschuld, psychische Verfassung und Schuldfähigkeit.
All dies sind Begriffe – und Fragen -, die in unserem heutigen Rechtssystem einen festen Platz haben. Dies war freilich nicht immer so.
Während Täter heute - aufgrund ihrer psychischen Verfassung oder ihrer „Lebensgeschichte“ – durchaus mit einem milderen Urteil oder gar einem Freispruch rechnen können, war es im Rechtssystem zu Schillers Zeiten üblich, dass nicht der Täter, sondern die Tat – und nur die Tat – im Zentrum der Betrachtung stand.
Diese Arbeit wird sich im Folgenden damit beschäftigen, wie Schiller in seiner Erzählung „Verbrecher aus Infamie – Eine wahre Geschichte“ aus dem Jahr 1786 versucht, eben diesen Blickwinkel zu verschieben und für den bereits Verurteilten zu sprechen.
Schiller erfindet jedoch nicht einfach die Geschichte eines Verbrechers, sondern bedient sich eines historischen Vorbildes, nämlich des „Sonnenwirtes“ Fridrich Schwan. Allerdings dient dessen Lebensgeschichte lediglich als grobes Gerüst, um das Schiller seine eigene Erzählung spinnt,
was in sofern legitim ist, da er nicht den Anspruch stellt, eine historisch korrekte Biographie zu schreiben, sondern vielmehr die Geschichte dazu nutzt, seine Kritik am herrschenden Rechtssystem und die Mängel der Gesellschaft aufzuzeigen.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Schiller auch auf die Bekanntheit der Geschichte des „Sonnenwirtes“ baute, um mit seiner Botschaft eine breitere Leserschaft zu erreichen.[...]
1. Einleitung
Unzurechnungsfähigkeit, Lebensumstände, Motiv, Mitschuld, psychische Verfassung und Schuldfähigkeit.
All dies sind Begriffe – und Fragen -, die in unserem heutigen Rechtssystem einen festen Platz haben. Dies war freilich nicht immer so.
Während Täter heute - aufgrund ihrer psychischen Verfassung oder ihrer „Lebensgeschichte“ – durchaus mit einem milderen Urteil oder gar einem Freispruch rechnen können, war es im Rechtssystem zu Schillers Zeiten üblich, dass nicht der Täter, sondern die Tat – und nur die Tat – im Zentrum der Betrachtung stand.
Diese Arbeit wird sich im Folgenden damit beschäftigen, wie Schiller in seiner Erzählung „Verbrecher aus Infamie – Eine wahre Geschichte“ aus dem Jahr 1786 versucht, eben diesen Blickwinkel zu verschieben und für den bereits Verurteilten zu sprechen.
Schiller erfindet jedoch nicht einfach die Geschichte eines Verbrechers, sondern bedient sich eines historischen Vorbildes, nämlich des „Sonnenwirtes“ Fridrich Schwan. Allerdings dient dessen Lebensgeschichte lediglich als grobes Gerüst, um das Schiller seine eigene Erzählung spinnt,
was in sofern legitim ist, da er nicht den Anspruch stellt, eine historisch korrekte Biographie zu schreiben, sondern vielmehr die Geschichte dazu nutzt, seine Kritik am herrschenden Rechtssystem und die Mängel der Gesellschaft aufzuzeigen.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Schiller auch auf die Bekanntheit der Geschichte des „Sonnenwirtes“ baute, um mit seiner Botschaft eine breitere Leserschaft zu erreichen.
Schiller spricht jedoch nicht direkt für den Verbrecher, sondern schafft mit seiner Erzählung eine Wirklichkeit, in der der Leser die Rolle des Richters übernehmen soll. Er begnügt sich nicht nur damit, den Leser in seiner programmatischen Vorrede darauf vorzubereiten, sondern liefert ihm nachfolgend ein Gesellschafts- und Rechtsbild, das zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Rechtssituation führen muss.
Diese Arbeit mit folgenden Punkten beschäftigen:
- Schillers Kritik an der bestehenden Rechtswirklichkeit und deren Darstellung in der Rechtsliteratur der Zeit.
- Die Rolle der Ehre und Ehrlosigkeit als treibende Kraft in Christian Wolfs Kampf um gesellschaftliche Anerkennung und ihre Mitschuld an seinem gesellschaftlichen Fall.
- Die gesellschaftliche Mitschuld am Schicksal des Christian Wolf
Um die Veränderungen zur realen Biographie des „Sonnenwirtes“ zu verdeutlichen, soll in dieser Arbeit auch die Erzählung „Lebens-Geschichte Fridrich Schwans“ (1787) von Jacob Fridrich Abel kurz Beachtung finden. Mit dieser Erzählung lieferte Abel eine historisch korrekte Biographie des „Sonnenwirtes“, anhand derer die – von Schiller vorgenommenen – Veränderungen deutlich gemacht werden können. Darüber hinaus bestand eine enge Verbindung zwischen Schiller und Abel, die Schillers Wahl der Geschichte sehr wahrscheinlich beeinflusst haben wird.
2. Die Entstehungsgeschichte
Wenn man sich mit den beiden Erzählungen von Schiller und Abel befasst, kommt man nicht darum herum, auch das Verhältnis der beiden zueinander näher zu beleuchten.
Die Forschung vermutet, dass Schiller nähere Informationen zu dieser Geschichte von Abel erfahren hatte. Dieser war – obwohl nur 8 Jahre älter - 1775 Schillers Philosophielehrer an der der Hohen Karlsschule und darüber hinaus war es Abels Vater, der als Oberamtmann in Vaihingen an der Enz den „Sonnenwirt“ 1760 festgenommen und zum Geständnis gebracht hatte.
Es ist jedoch zu vermuten, dass sich Abel den Erfolg der bereits erschienenen Erzählung Schillers zu Nutze machte. Aus Abels Aufzeichnungen geht darüber hinaus hervor, dass Schiller ihn mehrmals über Fridrich Schwan ausfragte.[1]
Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass Schiller von der Geschichte des „Sonnenwirtes“ schon früher erfahren hat. Zur Zeit der Verhaftung von Fridrich Schwan war Schiller zwar erst ein Jahr alt, jedoch wurden derartig spektakuläre Geschichte noch lange und oft erzählt.
Schiller veröffentlichte seine Novelle das erste Mal anonym im 2. Heft der Thalia 1786 unter dem Titel „Verbrecher aus Infamie – eine wahre Geschichte“. Sechs Jahre später veröffentlichte er eine überarbeitete Fassung in den Kleineren prosaischen Schriften unter seinem Namen. Diesmal lautete der Titel „Der Verbrecher aus verlorener Ehre – eine wahre Geschichte“. Die inhaltlichen Veränderungen waren jedoch gering und bezogen sich überwiegend auf sprachlich anstößige Stellen und dialektale Unebenheiten.[2]
3. Die Erzählung „Verbrecher aus Infamie – Eine wahre Geschichte“
Schillers Erzählung ist in zwei Teile gegliedert, einer programmatischen Vorrede und der Lebensgeschichte des „Sonnenwirtes“ Christian Wolf.
Während die Vorrede an dieser Stelle näher untersucht werden soll, wird die Lebensgeschichte lediglich kurz wiedergeben. Eine tiefergehende Analyse wird in den kommenden Punkten stattfinden.
Darüber hinaus sollen in einem weiteren Unterpunkt die wichtigsten Unterschiede zwischen den Erzählungen von Schiller und Abel betrachtet werden
3.1 Die programmatische Vorrede
„In der ganzen Geschichte des Menschen ist kein Kapitel unterrichtender für Herz und Geist, als die Annalen seiner Verirrungen.“[3]
In diesem Satz wird die Intention Schillers deutlich. Er will mit seiner Erzählung belehren.
Er verweist zu Beginn auf die Medizin, welche ihre größten Erkenntnisse aus der „Leichenöffnung“[4] gezogen hat. „Die Seelenlehre, die Moral, die gesetzgebende Gewalt sollen billig diesem Beispiel folgen“[5] und aus den „Sektionsberichten des Lasters“[6] – wie Gefängnissen, Gerichten und Kriminalakten – ihre eigene Belehrung holen.
Schiller will damit bewirken, dass das Subjekt nicht nur über seine Tat definiert wird, sondern auch der Mensch hinter der Tat Betrachtung findet, sein seelischer Zustand auf die Urteilsfindung einwirkt.
Er will, dass der Leser „den Unglücklichen [als den sieht], der noch in eben der Stunde, wo er die Tat beging, so wie in der, wo er dafür büßet, Mensch war wie wir, für ein Geschöpf fremder Gattung […], dessen Blut anders umläuft, als das unsrige, dessen Willen anderen Regeln gehorcht, als der unsrige“[7].
[...]
[1] Mahl, Bernd: Zum Verbrecher aus verlorener Ehre in: Steinbach, Dietrich (Hg.): Schiller, Friedrich: Der Verbrecher aus verlorener Ehre, Stuttgart, 2004, S.90
[2] Vgl.: Aurnhammer, Achim: Engagiertes Erzählen: „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, in: Aurnhammer, Achim/Manger, Klaus/Strack, Friedrich (Hg.): Schiller und die höfische Welt, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1990, S. 254f.
[3] Ich zitiere den Text nach folgender Ausgabe:
Schiller, Friedrich: Verbrecher aus Infamie – Ein wahres Verbrechen, in: Dann, Otto (Hg.):Friedrich Schiller, Werke und Briefe (in 12 Bänden), Band 7, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main, 2004, S. 562
[4] Ebd.: S. 562
[5] Ebd.: S. 562
[6] Ebd.: S. 562
[7] Schiller, S. 563
- Citar trabajo
- Tobias Pagel (Autor), 2009, Anwalt der Verteidigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139131