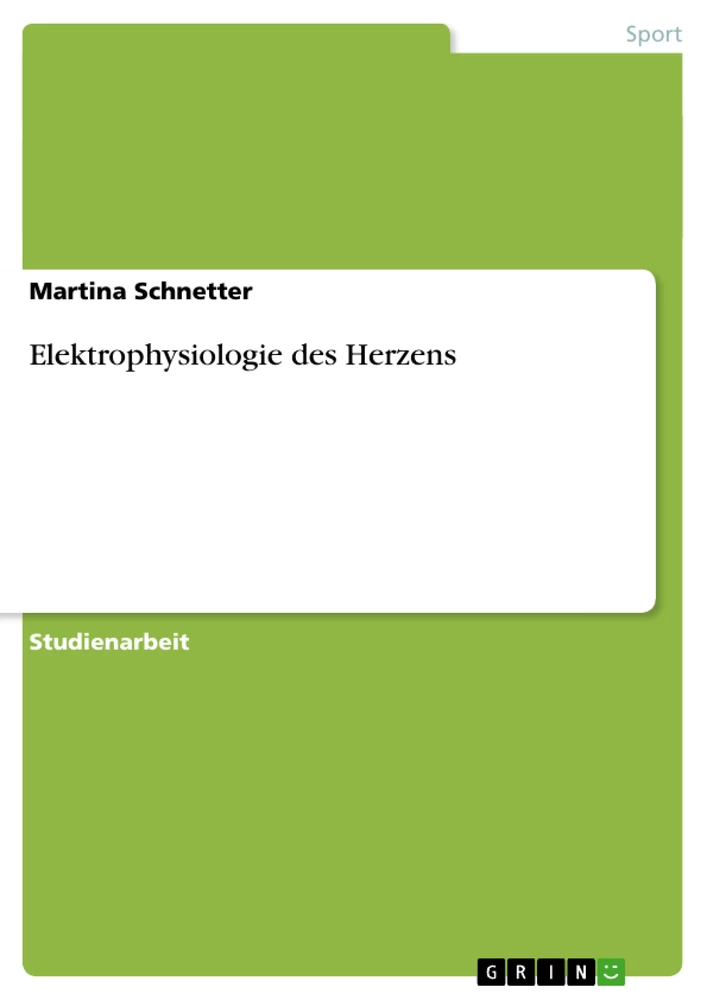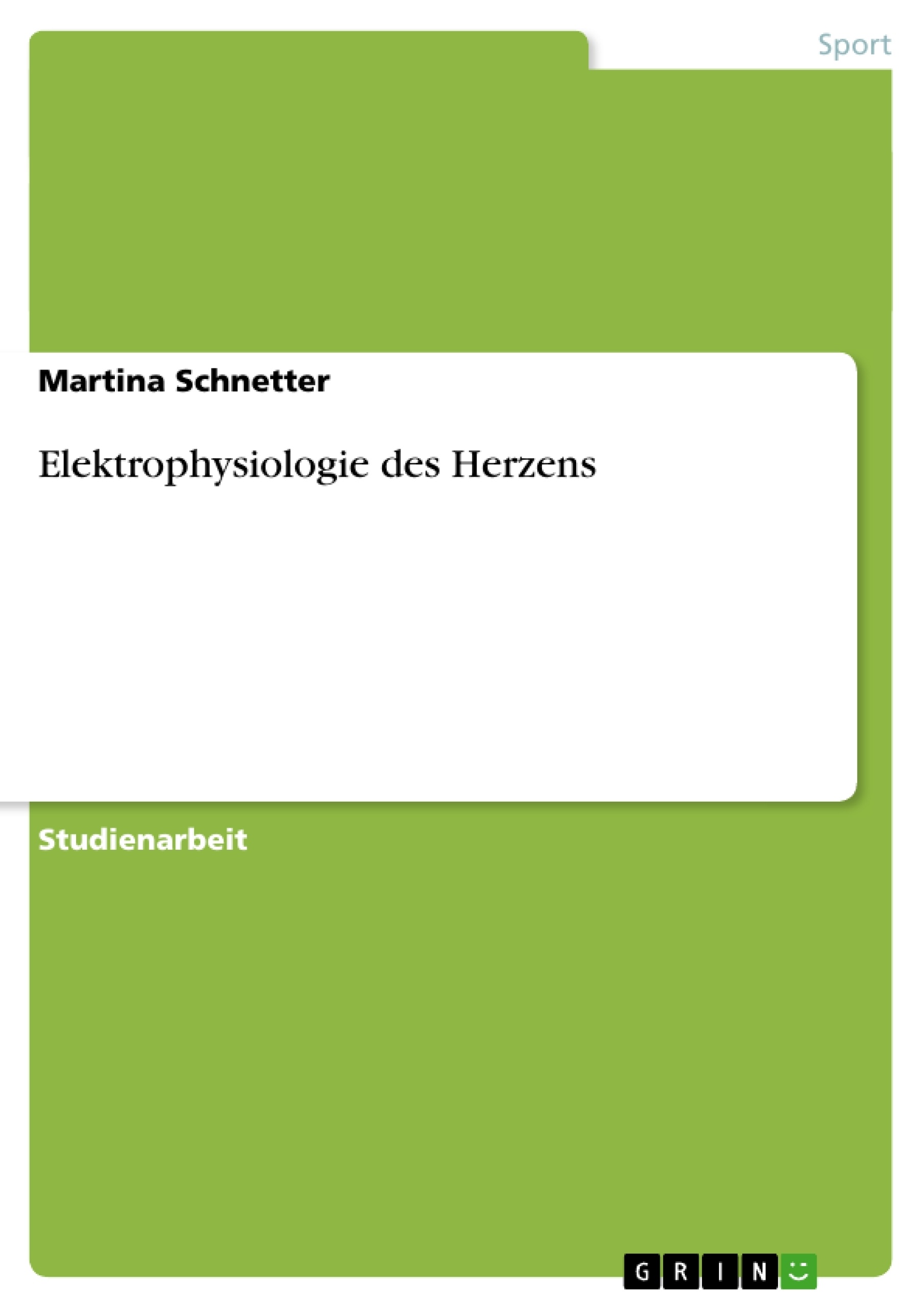Vergleicht man den Herzmuskel mit der Skelettmuskulatur, dann bestehen bei der
Erregung des Herzens, ihrer Ausbreitung und der Kontraktion des Herzmuskels eine
Reihe von Besonderheiten. Nimmt man im Tierversuch, z. B. beim Frosch, das Herz
aus dem Körper heraus und führt ihm genügend sauerstoff- und nährstoffreiches Blut
zu, dann kann das isolierte Herz einige Stunden lang außerhalb des Körpers spontan
schlagen, d. h. sich rhythmisch kontrahieren, ohne dass es von Nerven versorgt wird
(sogenannte Autorhythmie). Demnach besitzt das Herz ein automatisch arbeitendes
System, das Erregungen bilden und innerhalb des Herzmuskels weiterleiten kann.
In der folgenden Arbeit soll nun zunächst auf das Ruhe- und Aktionspotential der
Herzmuskelzelle eingegangen werden. Im nachfolgenden Punkt wird die
Erregungsbildung und Erregungsausbreitung im Herzen behandelt und im Anschluss
daran soll noch eine kurze Einführung in das Elektrokardiogramm gegeben werden. Der Herzmuskel besteht aus einem Geflecht von Herzmuskelzellen. Dabei
unterscheidet man zwei Typen von
Herzmuskelzellen (-fasern): Zum einen
Zellen, die fähig sind, Impulse zu bilden
und weiterzuleiten (= Erregungsbildungs-
und Leitungssystem:
Sinusknoten, Atrioventrikularknoten,
His-Bündel, Tawara-Schenkel,
Purkinje-Fasern), zum anderen Zellen,
die solche Impulse mit einer
Verkürzung bzw. Kontraktion
beantworten (= Arbeitsmyokard). Die
Zellgrenzen der Herzmuskelzellen sind
als Glanzstreifen (Disci intercelares)
miteinander verbunden sind. Diese
Glanzstreifen sind kein Hindernis für
die Erregungsfortleitung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ruhe- und Aktionspotential der Herzmuskelzelle
- Grundlagen
- Ruhemembranpotential
- Aktionspotential
- Refraktärphase
- Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen
- Reihenfolge der Erregungsausbreitung
- Hierarchie der Herzerregung und Ersatzrhythmen
- Die Erregungsbildung im Herzen
- Elektromechanische Kopplung
- Vegetative und afferente Innervation des Herzens
- Das Elektrokardiogramm (EKG)
- Grundlagen der Elektrokardiographie
- Die einzelnen Abschnitte des EKG
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die elektrophysiologischen Grundlagen des Herzens verständlich darzustellen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Ruhe- und Aktionspotentials der Herzmuskelzellen, der Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen sowie einer Einführung in das Elektrokardiogramm (EKG).
- Ruhe- und Aktionspotential der Herzmuskelzellen
- Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen
- Das Elektrokardiogramm (EKG) und seine Grundlagen
- Das funktionelle Synzytium des Herzens
- Autorhythmie des Herzens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Besonderheiten der Erregung und Kontraktion des Herzmuskels im Vergleich zur Skelettmuskulatur ein. Sie hebt die Fähigkeit des isolierten Herzens zur spontanen Kontraktion (Autorhythmie) hervor und kündigt die folgenden Kapitel an, die sich mit dem Ruhe- und Aktionspotential, der Erregungsbildung und -ausbreitung und dem Elektrokardiogramm befassen.
Ruhe- und Aktionspotential der Herzmuskelzelle: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen des Ruhe- und Aktionspotentials der Herzmuskelzellen. Es differenziert zwischen Erregungsbildungs- und -leitungssystem und Arbeitsmyokard und erklärt das funktionelle Synzytium des Herzens, welches die gleichmäßige Erregungsausbreitung ermöglicht. Ausführlich wird das Ruhemembranpotential mit der Rolle der Na+-K+-ATPase erläutert. Das Aktionspotential wird in seine drei Phasen (Depolarisation, Plateau, Repolarisation) unterteilt, wobei die Rolle der Ionenkanäle detailliert beschrieben wird. Der Bezug zum Alles-oder-Nichts-Prinzip des Herzens wird hergestellt.
Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen. Es beschreibt die Reihenfolge der Erregungsausbreitung, beginnend vom Sinusknoten, und erklärt die Hierarchie der Herzerregung und die Entstehung von Ersatzrhythmen. Die elektromechanische Kopplung, die die Erregung mit der Kontraktion verbindet, wird ebenso behandelt wie die vegetative und afferente Innervation des Herzens, welche die Herzaktivität beeinflussen.
Das Elektrokardiogramm (EKG): Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Grundlagen der Elektrokardiographie und beschreibt die einzelnen Abschnitte des EKGs. Es erklärt, wie die elektrische Aktivität des Herzens mittels EKG aufgezeichnet und interpretiert werden kann. Obwohl keine spezifischen Abschnitte des EKG genannt werden, wird das Prinzip der Ableitung und Aufzeichnung der Herzaktivität als Grundlage für die weitere Diagnose von Herzrhythmusstörungen und anderen pathologischen Zuständen im Herz-Kreislauf-System vermittelt.
Schlüsselwörter
Herzmuskelzelle, Aktionspotential, Ruhemembranpotential, Erregungsleitung, Sinusknoten, Elektrokardiogramm (EKG), Autorhythmie, funktionelles Synzytium, Na+-K+-ATPase, Depolarisation, Repolarisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Elektrophysiologie des Herzens
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die elektrophysiologischen Grundlagen des Herzens. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Die behandelten Themen umfassen das Ruhe- und Aktionspotential der Herzmuskelzellen, die Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen sowie das Elektrokardiogramm (EKG).
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt detailliert das Ruhe- und Aktionspotential der Herzmuskelzellen, einschließlich des Ruhemembranpotentials und der Rolle der Na+-K+-ATPase. Das Aktionspotential wird in seine Phasen (Depolarisation, Plateau, Repolarisation) unterteilt, und die Funktion der Ionenkanäle wird erklärt. Weiterhin wird die Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen beschrieben, beginnend beim Sinusknoten, einschließlich der Hierarchie der Herzerregung, der Entstehung von Ersatzrhythmen und der elektromechanischen Kopplung. Schließlich wird eine Einführung in das Elektrokardiogramm (EKG) gegeben, einschließlich der Grundlagen der Elektrokardiographie.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Dokuments?
Das Hauptziel ist es, die elektrophysiologischen Grundlagen des Herzens verständlich darzustellen. Die Schwerpunkte liegen auf dem Verständnis des Ruhe- und Aktionspotentials der Herzmuskelzellen, der Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen sowie einer Einführung in das Elektrokardiogramm (EKG). Zusätzliche Themen sind das funktionelle Synzytium des Herzens und die Autorhythmie.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Herzmuskelzelle, Aktionspotential, Ruhemembranpotential, Erregungsleitung, Sinusknoten, Elektrokardiogramm (EKG), Autorhythmie, funktionelles Synzytium, Na+-K+-ATPase, Depolarisation und Repolarisation.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel unterteilt: Einleitung, Ruhe- und Aktionspotential der Herzmuskelzelle, Erregungsbildung und -ausbreitung im Herzen, Das Elektrokardiogramm (EKG) und Fazit. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument eignet sich für Personen, die ein grundlegendes Verständnis der elektrophysiologischen Prozesse im Herzen erwerben möchten. Es ist insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise gedacht.
Wo finde ich weitere Informationen zu den behandelten Themen?
Das Dokument dient als Einführung. Für vertiefende Informationen zu den einzelnen Themen wird empfohlen, weitere Fachliteratur zu konsultieren.
- Quote paper
- Martina Schnetter (Author), 2003, Elektrophysiologie des Herzens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13904