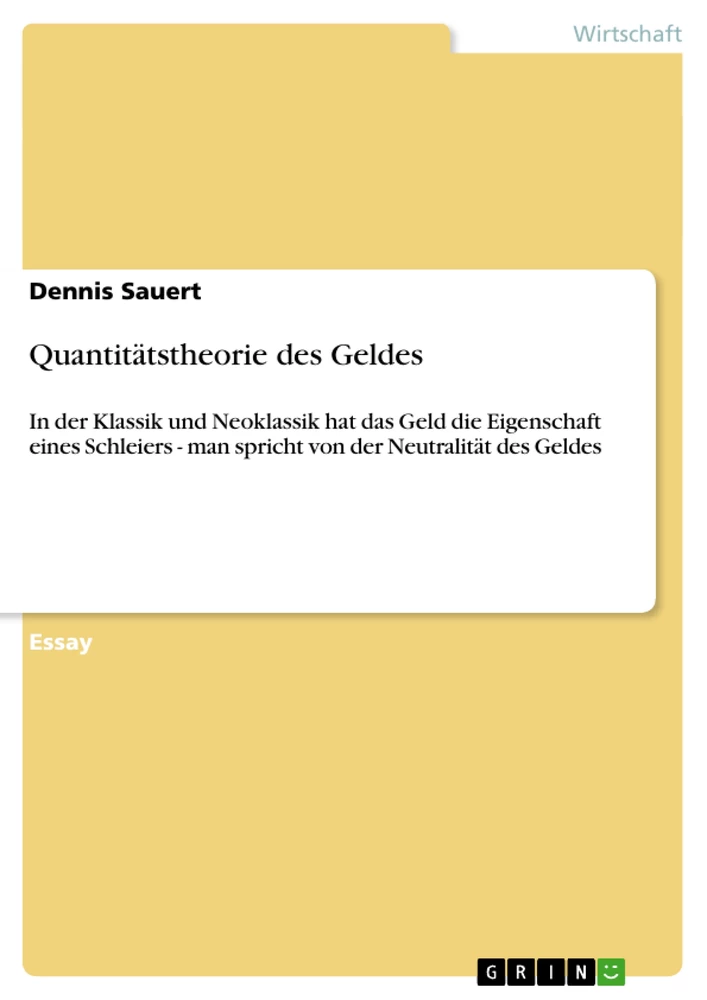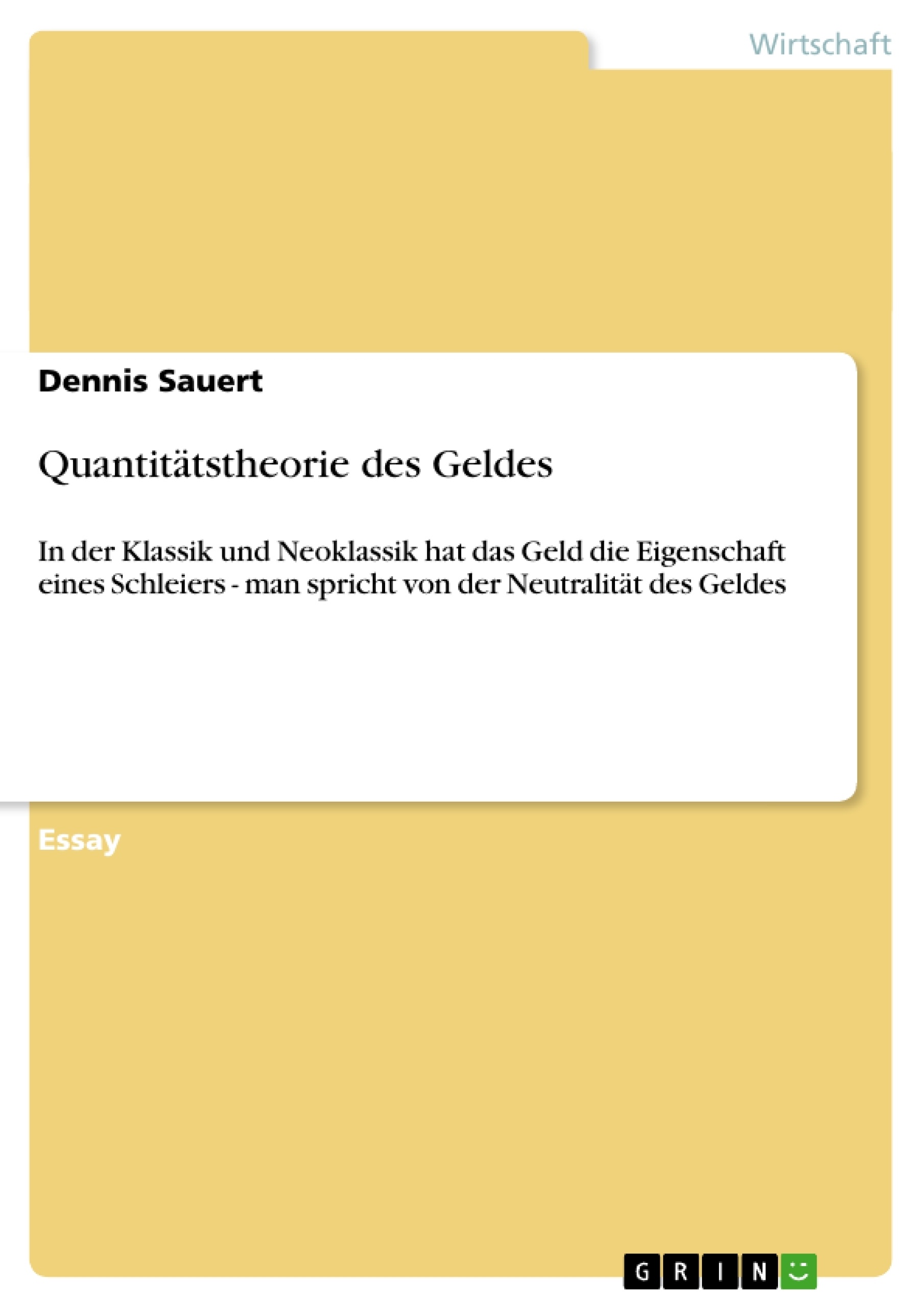In der klassischen und neoklassischen Ökonomie vertritt man die Auffassung einer strikten Trennung zwischen dem monetären und realen Sektor. Eine Expansion der Geldmenge würde also langfristig zu einem Preisanstieg führen und nicht zu einem Anstieg der realen Güter. Dieser nicht bestehende Transmissionsmechanismus in der Klassik, zwischen den beiden Sektoren, verleiht dem Geld die Annahme eines Schleiers.
Das Geld wird als „Schmiermittel des Wirtschaftsprozesses“ bezeichnet. „Ohne Geld gestalten sich die Tauschvorgänge viel umständlicher, aber ist es erst einmal eingeführt, so genügt schon ein „Tropfen“ - auf die Menge kommt es nicht an. Jedenfalls nicht, was die realen Größe anbetrifft.“ Dieses Zitat weist auf die Teilung zwischen dem realen und monetären Sektor hin. Die Aufgabe der Quantitätstheorie des Geldes ist es, den kausalen Zusammenhang zwischen dem Preisniveau und der Geldmenge zu erklären.
In der Klassik und Neoklassik hat Geld die Eigenschaft eines Schleiers — man spricht von der Neutralitlit des Geldes
In der klassischen und neoklassischen Okonomie vertritt man die Auffassung einer strikten Trennung zwischen dem monetären und realen Sektor. Eine Expansion der Geldmenge wilrde also langfristig zu einem Preisanstieg filhren und nicht zu einem Anstieg der realen Gilter. Dieser nicht bestehende Transmissionsmechanismus in der Klassik, zwischen den beiden Sektoren, verleiht dem Geld die Annahme eines Schleiers.1
Das Geld wird als „Schmiermittel des Wirtschaftsprozesses" bezeichnet. „Ohne Geld gestalten sich die Tauschvorgänge viel umständlicher, aber ist es erst einmal eingefilhrt, so genilgt schon ein „Trop-fen" - auf die Menge kommt es nicht an. Jedenfalls nicht, was die realen Gröfie anbetrifft."2 Dieses Zitat weist auf die Teilung zwischen dem realen und monetären Sektor hin. Die Aufgabe der Quanti-tätstheorie des Geldes ist es, den kausalen Zusammenhang zwischen dem Preisniveau und der Geld-menge zu erklären.
Die Quantitätstheorie wird durch die Quantitätsgleichung bzw. durch die sogenannte Fishersche Verkehrsgleichung beschrieben. Auf der linken Seite stehen mit dem Produkt der Geldmenge M und der Umlaufgeschwindigkeit v die Summe der Einkommen und auf der rechten Seite mit dem Preisni-veau P und dem realen Einkommen Y die Summe der Nominaleinkommen.3
m * v = P * Y
Die Fishersche Verkehrsgleichung setzt eine Parität der Geldmenge zu dem Nominaleinkommen (P*Y). Das bedeutet, dass mit steigender Geldmenge das Preisniveau P oder das reale Einkommen Y steigen muss, da v allgemein als konstant angesehen wird.4 Durch die Division von v und der Bildung eines Kehrwerts aus v erhält man 1/k, was die Kassenhaltung bezeichnet. Durch diese Umformung ergibt sich die Cambridge - Gleichung:
m= k * P * Y
Prinzipiell ist sie identisch mit der Quantitatsgleichung. Sie unterscheidet sich nur durch die Ersetzung der Gröfie v mit k. Die Cambridge - Gleichung gewahrt eine verhaltenslogische Erklarung der Geld-nachfrage, wahrend die Quantitatsgleichung auf den etwas mechanistischen Begriff der Umlaufge-schwindigkeit zurtickgreift.5
Erganzend ist zu erwahnen, dass das Produkt aus k, P und Y der Geldnachfrage L entspricht. Dadurch muss die Geldnachfrage im Gleichgewicht zum Geldangebot stehen.
Die Quintessenz der Quantitatstheorie ist also, dass mit steigender Geldmenge auch die Preise proportional steigen. In der klassischen — neoklassischen Theorie argumentiert man folgendermafien. Mit einem steigenden Geldangebot steigt die Realkasse (M/P). Da ein Interesse der Geldhortung nicht besteht, fragen die Wirtschaftssubjekte nun mehr Gtiter nach. Es herrscht aber ein gleich bleibendes Gtiterangebot, was im Umkehrschluss steigende Preise zur Folge hat. Der Realkassenbestand fallt somit auf sein vorhergehendes Niveau zurtick, der der unveranderten realen Geldnachfrage entspricht. Diese Erscheinung in der Quantitatstheorie wird als Cambridge — Effekt bezeichnet.
Allerdings wird die Quantitatstheorie des Geldes durch wesentliche Punkte kritisiert, die nicht ausgeb-lendet werden können.
Es stellt sich die Frage, ob die Umlaufgeschwindigkeit bzw. die Kassenhaltung tatsachlich als konstant angesehen werden kann. Konstanz wtirde bedeuten, dass die Zahlungsgewohnheiten aller Wirtschafts-subjekte in der Volkswirtschaft, wie es durch die Quantitatsgleichung unterstellt wird, gleich bleiben. Die Quantitatstheorie trifft keine Aussage, was passiert, wenn mit steigender Geldmenge die Geld-nachfrage stagniert oder unproportional steigt. Folglich kame es zu einer sinkenden Umlaufgeschwin-digkeit. Es bedarf demnach einer theoretischen Aussage die sich gegentiber der Praxis bewahren muss.6
Ein weiteres Problem ist die Akkumulation des Geldangebots durch die Vergabe von Schecks, Wech-sel und anderen Formen von Wertpapieren. Die Geldmenge bewege sich somit hin zu einer endogenen Gröfie und ware nicht mehr durch die Zentralbank exogen steuerbar.
Schliefilich ist die Bedeutung des Realkasseneffekts zweifelhaft. Denn die Theorie besagt, dass mit steigendem Geldangebot und somit der Aufwertung der Realkasse, dass Ausgabeverhalten der Wirt-schaftssubjekte beeinflusst wird. Aber dieser sogenannte Cambridge — Effekt ist fraglich.7 Preisande-rungen treten nur ein, wenn sich die Nachfrage- oder Angebotsseite verschieben. Dies setzt aber eine Anderung der Dispositionen der einzelnen Wirtschaftssubjekte voraus. Die Quantitatstheorie muss demnach nachweisen, warum die Erhöhung der Geldmenge zu einem Preisanstieg ftihrt und demnach zur Veranderung der individuellen Nachfrage oder des Angebotes. Mit ihren makroökonomischen Gröfien zeigt sie aber nicht die Entscheidungen der einzelnen Wirtschaftssubjekte auf.8
Somit ist in der Quantitatstheorie die Neutralitat des Geldes zwar formal durch die Quantitatsglei-chung richtig. In der Praxis ist die Theorie des Geldes aber mit dem realen Sektor konfrontiert, der nun nicht vernachlassigt werden kann.
[...]
1 Vgl. http://www.europawissenschaften-berlin.de/texte/Geldpolitik_Zentralbank.pdf, S. 3 ff., download am 19.12.2006
2 Felderer/ Homburg: Makroökonomik und neue Makroökonomik, 8.Aufl., Berlin 2003, S.79 ff.
3 Vgl. http://userpage.fu-berlin.de/--staderma/wochenpl2.htm, S.2 , download am 19.12.2006
4 Vgl. http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=1811, S.4, download am 19.12.2006
5 Vgl. Felderer/ Homburg: Makroökonomik und neue Makroökonomik, 8.Aufl., Berlin 2003, S. 81- 82
6 Vgl. Issing, Otmar: Einftihrung in die Geldtheorie 12. Auflage, S. 145
7 Vgl. Felderer/ Homburg: Makroökonomik und neue Makroökonomik, 8.Aufl., Berlin 2003, S. 83
8 Vgl. Issing, Otmar: Einftihrung in die Geldtheorie 12. Auflage, S. 145
- Quote paper
- Dennis Sauert (Author), 2007, Quantitätstheorie des Geldes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138910